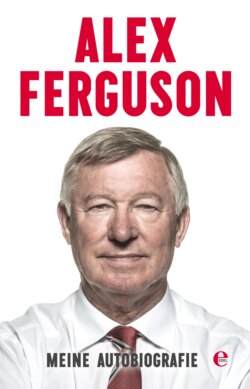Читать книгу Meine Autobiografie - Alex Ferguson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
RÜCKTRITT VOM RÜCKTRITT
ОглавлениеAm ersten Weihnachtsfeiertag 2001 war ich auf dem Sofa vor dem Fernseher eingenickt, während in der Küche eine Rebellion angezettelt wurde. Der traditionelle Versammlungsraum unserer Familie war Schauplatz eines Gesprächs, das das Leben von uns allen verändern sollte. Schließlich kam die Anführerin der Rebellion ins Zimmer und stupste mir leicht gegen den Fuß, um mich zu wecken. Im Türrahmen erblickte ich drei Kerle: meine Söhne, die sich im engen Schulterschluss aufgereiht hatten.
»Wir haben gerade eine Familienkonferenz abgehalten«, erklärte Cathy. »Und wir haben einen Entschluss gefasst. Du trittst nicht zurück.« Während ich mir das eben Gehörte kurz durch den Kopf gehen ließ, merkte ich, dass ich ihnen eigentlich gar nicht widersprechen wollte. »Erstens: Du bist gesund. Zweitens: Ich möchte dich nicht die ganze Zeit hier im Haus haben. Und drittens: Du bist dafür sowieso noch zu jung.« Zunächst führte Cathy das Wort. Aber unsere Söhne standen unmittelbar hinter ihr. Die Truppe hatte die Reihen geschlossen. »Das ist dumm von dir, Dad«, meinten meine Jungs. »Mach es nicht. Du hast jede Menge zu bieten. Du kannst bei Manchester United eine neue Mannschaft aufbauen.« Wenn ich aus diesem Komplott eine Lehre gezogen haben, dann die: nie wieder für fünf Minuten einzunicken. Das kleine Schläfchen hatte nämlich zur Folge, dass ich noch elf Jahre weitermachte.
Einer der Gründe, warum ich mich überhaupt zum Rücktritt entschlossen hatte, war eine Bemerkung von Martin Edwards nach dem Champions-League-Finale von 1999 in Barcelona. Damals hatte man ihn gefragt, ob es für mich nach dem Verzicht auf den Trainer-job im Verein einen anderen Platz geben würde, und er hatte geantwortet: »Na ja, wir wollen natürlich keine Situation wie bei Matt Busby.« Mich beeindruckte diese Antwort nicht, denn Matt Busbys und meine Zeit im Traineramt waren miteinander nicht zu vergleichen. In meiner Ära musste man an viel mehr Fronten kämpfen und sich mit Agenten, Verträgen oder Medien auseinandersetzen. Kein vernünftiger Mensch würde damit freiwillig zu tun haben wollen, nachdem er seinen Job als Trainer an den Nagel gehängt hatte. Es bestand also nicht die geringste Gefahr, dass ich mir das noch weiter antun oder als graue Eminenz im Hintergrund die Fäden ziehen würde.
Was sonst ließ mich damals überhaupt an Rücktritt denken? Nach diesem einzigartigen Abend in Barcelona hatte ich das Gefühl, den Gipfel erreicht zu haben. Zuvor hatte mein Team bei der Champions League regelmäßig versagt, doch ich hatte diesen Sieg immer vor Augen. Sobald man sich seinen Lebenstraum erfüllt hat, fragt man sich, ob man einen solchen Höhepunkt noch einmal erreichen kann. Als Martin Edwards seine Bemerkung über das Matt-Busby-Syndrom machte, war mein erster Gedanke: ›Das ist Blödsinn‹. Mein zweiter war: ›60 ist ein gutes Alter, um seinen Abschied zu nehmen.‹
Mir gingen also drei Dinge durch den Kopf: die Enttäuschung darüber, dass Martin Edwards das Thema Matt Busby überhaupt zur Sprache gebracht hatte, die Unwägbarkeit, ob ich zum zweiten Mal mit meinem Team die Champions League gewinnen könnte, und die Zahl 60, die mich allmählich verfolgte.
Der 60. Geburtstag kann einen sonderbaren Effekt haben. Man denkt, man betritt einen anderen Raum. Mit 50 Jahren hat man eine Art Schlüsselmoment erreicht. Ein halbes Jahrhundert ist rum. Aber man fühlt sich nicht wie 50. Mit 60 sagt man sich: ›Herrje, ich fühle mich wie 60. Ich bin 60!‹ Doch man muss da durch und übersteht das auch. Recht schnell wird einem bewusst, dass es sich um eine gedankliche, abstrakt rechnerische Veränderung handelt. Jetzt stehe ich dem Alter anders gegenüber. Aber damals manifestierte das Alter von 60 Jahren eine psychische Barriere in meinem Kopf. Es war für mich wie ein Hindernis, mich noch jung zu fühlen. Es veränderte das Gefühl für meine eigene Fitness, meinen Gesundheitszustand. Der Gewinn der Champions League ließ in mir das Gefühl hochkommen, dass sich meine Träume erfüllt hätten und ich jetzt zufrieden von meinem Amt zurücktreten konnte. Er war der Katalysator meiner Gedanken. Aber als ich mitbekam, dass Martin mich als lästiges Gespenst auf der Schulter des neuen Trainers sah, grummelte ich in mich hinein: ›Das ist ja lächerlich!‹
Ganz tief im Inneren war es für mich natürlich eine Erleichterung, vom Rücktritt zurückzutreten, aber ich musste dennoch mit Cathy und den Jungs über die praktische Umsetzung reden.
»Ich glaube nicht, dass ich das rückgängig machen kann. Ich habe den Verein ja schon informiert.«
»Na ja«, sagte Cathy, »meinst du nicht, dass sie dir so viel Respekt entgegenbringen und dir erlauben sollten, es dir noch mal anders zu überlegen?«
»Sie könnten den Job inzwischen ja einem anderen gegeben haben«, gab ich zu bedenken.
»Aber so gut, wie du deinen Job gemacht hast…Meinst du nicht, sie sollten dir die Chance geben weiterzumachen?«, beharrte Cathy eisern.
Am nächsten Tag rief ich Maurice Watkins, den Vereinsanwalt, an. Der lachte, als ich ihm von meiner Kehrtwende erzählte. Die Headhunter sollten sich eigentlich schon in der folgenden Woche mit einem ersten Nachfolgekandidaten treffen. Ich glaube, sie hatten Sven-Göran Eriksson als neuen Trainer von United im Visier. Das war jedenfalls meine Interpretation, die Maurice jedoch nie bestätigte. »Warum Eriksson?«, fragte ich ihn später einmal.
Er darauf vage: »Vielleicht täuschst du dich, vielleicht aber auch nicht.«
Als Nächstes nahm Maurice Kontakt zu Roland Smith auf, dem damaligen Vorsitzenden des Ligaausschusses. Als wir dann miteinander telefonierten, lautete dessen Antwort: »Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt. Habe ich Ihnen nicht gesagt, wie dumm Ihre Entscheidung war? Wir müssen uns zusammensetzen und das durchdiskutieren.«
Roland war ein erfahrener, schlauer Fuchs. Er hatte ein außergewöhnliches, sehr ereignisreiches Leben geführt, viele interessante Begegnungen gehabt und konnte die eine oder andere Geschichte zum Besten geben. Einmal erzählte er uns von einem Dinner, bei dem Margaret Thatcher und die Queen zusammentrafen. Ihre Majestät äußerte dabei den Wunsch, dass das königliche Flugzeug aufgemöbelt werden sollte. Roland kam vorbei und bemerkte, dass die beiden Damen einander den Rücken zukehrten.
»Roland«, rief die Queen, »sind Sie so nett und sagen Sie dieser Dame, dass mein Flugzeug generalüberholt werden muss?«
»Madam«, antwortete Roland, »ich kümmere mich umgehend darum.«
Etwas Ähnliches sagte er mir angesichts meines Sinneswandels jetzt ebenfalls, denn für mich war es wichtig, dass er sich sofort darum kümmerte.
Der erste Punkt, der geklärt werden musste, war mein neuer Vertrag. Mein bisheriger würde im Sommer auslaufen, und die Sache musste schnell in die Wege geleitet werden.
Um ganz ehrlich zu sein, wusste ich schon in dem Augenblick, als ich meinen Rücktritt und das Datum meines Abschieds verkündete, dass ich gerade dabei war, einen großen Fehler zu machen. Auch andere sahen das so. Bobby Robson hatte immer gesagt: »Wage es ja nicht zurückzutreten.« Bobby war ein wunderbarer Mensch. Eines Nachmittags läutete bei mir zu Hause das Telefon.
»Alex, hier ist Bobby. Störe ich?«
»Wo bist du?«, fragte ich.
»Ich bin in Wilmslow.«
»Dann komm doch einfach vorbei«, sagte ich zu ihm.
»Ich stehe schon vor deiner Tür«, antwortete er.
Bobby war ein so erfrischender Kerl. Selbst mit über 70 wollte er noch immer seinen Trainerposten bei Newcastle zurückhaben, den er bereits während der Saison 2004/05 abgeben musste. Es entsprach nicht Bobbys Wesen, dem Müßiggang zu frönen, und er weigerte sich zu akzeptieren, dass der Job bei Newcastle plötzlich jenseits seiner Fähigkeiten liegen sollte. An dieser Trotzhaltung hielt er bis zum Ende fest, und sie war Ausdruck davon, wie sehr er den Fußball liebte.
Nachdem ich mich zum Rücktritt entschlossen hatte, stoppte ich alle meine bisherigen Planungen. Doch von dem Augenblick an, als ich diesen Entschluss zurücknahm, schmiedete ich umgehend Pläne. Ich sagte mir: ›Wir brauchen eine neue Mannschaft.‹ Neue Energie durchströmte mich und ich begann sofort zu agieren. Den Scouts übermittelte ich: »Wir müssen schnell in die Gänge kommen.« Wieder mobilisierten wir unsere Kräfte, und das fühlte sich unheimlich gut an.
Ich hatte keine gesundheitlichen Probleme oder Einschränkungen, die mich am Weitermachen gehindert hätten. Als Trainer ist man manchmal verunsichert. Man fragt sich, ob man auch wirklich akzeptiert und geschätzt wird. In diesem Zusammenhang fällt mir die dreiteilige Fernsehdokumentation Arena meines Freundes Hugh McIlvanney über die drei schottischen Trainerlegenden Jock Stein, Bill Shankly und Matt Busby ein. Ein Thema in Hughs Dokumentation war das Phänomen, dass diese drei Männer für ihre Clubs allmählich zu übermächtig geworden waren und jeder auf seine Weise in seine Schranken gewiesen wurde. Ich erinnere mich, was der große Jock mir einmal über Vereinseigner und Vorstandschefs sagte: »Alex, denk immer dran, dass wir nicht sie sind. Wir sind nicht sie. Sie leiten den Verein. Wir sind ihre Angestellten.« Big Jock war sich dessen stets bewusst. Da gab es sie und da gab es uns, die Landbesitzer und die Leibeigenen.
Was sie bei Celtic mit Jock Stein veranstaltet hatten, war nicht nur widerlich, sondern lächerlich dazu. Sie verlangten von ihm, dass er sich um die Schwimmbecken kümmern sollte. Fünfundzwanzig Pokale für Celtic holen, und dann als Poolwart des Clubs enden! Ähnliches spielte sich bei Bill Shankly ab. Er wurde nie gefragt, ob er in den Vorstand von Liverpool aufrücken wollte, und in der Folge verbitterte er mehr und mehr. Er fing sogar an, zu den Spielen von Manchester United zu kommen oder sich die der Tanmere Rovers anzusehen. Er tauchte auf unserem alten Trainingsplatz, The Cliff, auf, ebenso auf dem von Everton.
Ganz gleich, wie beeindruckend deine Laufbahn auch ist, es gibt Momente, in denen du dich verletzlich und schutzlos fühlst. Allerdings war die Basis, auf der ich in meinen letzten Jahren mit David Gill zusammengearbeitet hatte, erstklassig. Wir verstanden uns ausgezeichnet. Aber ein Trainer wird stets von der Angst des Versagens begleitet und ist oft auf sich allein gestellt. Manchmal würde man alles dafür geben, mit seinen Gedanken nicht allein zu sein. Es gab Tage, da saß ich nachmittags in meinem Büro, aber niemand klopfte an meine Tür, weil alle davon ausgingen, ich wäre beschäftigt. Hin und wieder hoffte ich auf dieses Klopfen. Ich wünschte mir, Mick Phelan oder René Meulensteen würden reinschauen und sagen: »Hast du Lust auf eine Tasse Tee?« Ich musste manchmal losgehen und jemanden suchen, mit dem ich reden konnte. Als Trainer muss man sich dieser Isolation bewusst sein. Man braucht den Gedankenaustausch. Aber alle anderen denken, du bist mit wichtigeren Dingen beschäftigt und wollen deshalb nicht stören.
Bis etwa 13 Uhr kamen ständig Leute zu mir ins Büro. Die Jungs von der Nachwuchsakademie, Ken Ramsden, der Sekretär, und viele Spieler der ersten Mannschaft, die häufig über familiäre Probleme mit dir reden wollten. Für mich war das immer erfreulich, war es doch ein Ausdruck dafür, dass sie mir vertrauten. Ich sah es stets als positives Zeichen, wenn Spieler sich mir anvertrauten, selbst wenn es um die Bitte nach einem freien Tag wegen Überlastung oder um das Besprechen von Vertragsfragen ging.
Wenn ein Spieler mich um einen freien Tag bat, musste es dafür einen triftigen Grund geben, denn wer wollte schon eine Trainingseinheit bei United verpassen? Ich sagte immer ja. Ich vertraute ihnen. Denn wenn man sagte: »Nein – weshalb willst du überhaupt einen Tag frei haben?«, und der Spieler antwortete: »Weil meine Großmutter gestorben ist«, dann steckte man in der Klemme. Wenn es ein Problem gab, war ich immer bestrebt zu helfen, eine Lösung zu finden.
Ich hatte viele Mitarbeiter, die zu hundert Prozent hinter mir standen. Beispiele dafür sind Les Kershaw, Jim Ryan und Dave Bushell. Les Kershaw holte ich 1987 ins Team. Seine Verpflichtung war eine der allerbesten, die ich je vornahm. Ich stellte ihn auf Empfehlung von Bobby Charlton ein. Weil ich die Fußballszene in England nicht so gut kannte, waren Bobbys Tipps für mich immer von unschätzbarem Wert. Les hatte an Bobbys Charltons Fußballschulen gearbeitet und war als Talent-Scout für Crystal Palace tätig. Außerdem hatte er mit George Graham und Terry Venables gearbeitet. Bobby war der Meinung, Les würde liebend gern für Manchester United tätig werden. Deshalb holte ich ihn als Chefscout an Bord. Er war überschäumend und derart begeistert bei der Arbeit, dass er unentwegt redete. Er rief mich jeden Samstagabend um 18:30 Uhr an, um mir sämtliche Scouting-Berichte durchzugeben. Nach etwa einer Stunde kam Cathy meist herein und fragte: »Telefonierst du immer noch?«
In dem Augenblick, in dem man Les unterbrach, sprach er noch schneller. Was für ein Arbeitstier! Eigentlich war er promovierter Chemiker und hatte an der Universität von Manchester als Wissenschaftler gearbeitet.
Dave Bushell war ursprünglich Schuldirektor und gab für unter 15-Jährige Englischunterricht. Ich holte ihn, als Joe Brown in den Ruhestand ging. Jim Ryan zählte seit 1991 zum Stab. Mick Phelan war zunächst einer meiner Spieler und wurde schließlich mein geschätzter Co-Trainer. Er verließ uns 1995, kehrte jedoch 2000 als Trainer zurück. Paul McGuinness war seit meiner ersten Stunde bei Manchester United an meiner Seite. Er war der Sohn des ehemaligen United-Spielers Wilf McGuinness und selbst Spieler. Ich ernannte ihn zum Nachwuchstrainer.
In der Regel bringt ein Trainer seinen Assistenten mit, und dieser Assistent bleibt dann meist bei ihm. Bei United war die Situation eine andere, weil meine Assistenten im Fokus der Öffentlichkeit standen und so ins Visier anderer Vereine gerieten. Meinen Assistenten Archie Knox verlor ich 1991 zwei Wochen vor dem Finale des Europapokals der Landesmeister an die Rangers, und in Archies Abwesenheit nahm ich Brian Whitehouse mit zum Spiel nach Rotterdam.
Später ging ich auf die Suche nach einer neuen Nummer zwei. Nobby Stiles sagte: »Warum beförderst du nicht Brian Kidd?« Brian kannte den Verein und hatte das regionale Scouting-Netzwerk umgekrempelt, indem er ein paar seiner früheren Kumpel engagierte – Männer von United und Lehrer an der Akademie, die sich auf den Fußballplätzen der Umgebung gut auskannten. Das war das Beste, was Brian je auf die Beine stellte. Das Netzwerk war unglaublich erfolgreich. Deshalb gab ich Brian den Job. Er machte sich insofern gut, als er sich mit den Spielern bestens verstand und gute Trainingseinheiten zusammenstellte. Er hielt sich in Italien auf, um die Teams der Serie A zu beobachten, und kam mit jeder Menge neuer Erkenntnisse zurück.
Als er 1998 zu Blackburn wechselte, sagte ich zu ihm: »Ich hoffe, du weißt, was du da tust.« Wenn ein Trainer geht, fragt er erfahrungsgemäß immer zurück: »Was meinst du?« Im Fall von Archie Knox konnte ich Martin Edwards nicht dazu bewegen, das Angebot der Rangers zu überbieten. Was Brian Kidd anbelangte, war ich der Meinung, dass er sich nicht für den Trainerjob eignete. Steve McClaren besaß hingegen zweifellos Trainerbegabung. Zu ihm sagte ich: »Du solltest unbedingt darauf achten, dass du den richtigen Club findest, den richtigen Boss. Das ist ganz wichtig. Immer.« West Ham und Southampton waren diejenigen Clubs, die ihn damals haben wollten.
Aus heiterem Himmel bekam Steve McClaren ein Angebot von Steve Gibson, dem Vorstandsvorsitzenden von Middlesbrough, und ich gab ihm den Rat: »Keine Frage, greif zu.« Obwohl Bryan Robson seinen Job dort verloren hatte, sprach er immer in den höchsten Tönen von Steve Gibson, der jung, frisch und stets bereit war, sein Geld in den Club zu stecken. Sie hatten dort ein fantastisches Trainingsgelände. »Das ist genau der richtige Job für dich«, sagte ich deshalb zu Steve.
Steve, organisiert, taff und immer auf der Suche nach neuen Ideen, war wie gemacht für einen Trainerposten. Er war eine starke Persönlichkeit, temperamentvoll und energiegeladen.
Carlos Queiroz, ein weiterer meiner Co-Trainer, war brillant. Einfach brillant. Ein intelligenter, akribischer Mann. Die Empfehlung, ihn zu engagieren, stammte von Andy Roxburgh, und zwar zu jener Zeit, als wir begannen, nach Spielern aus südlichen Ländern Ausschau zu halten und möglicherweise einen Trainer brauchten, der nicht aus Nordeuropa stammte und der eine oder zwei andere Sprachen beherrschte. Andy war absolut überzeugt von seinem Vorschlag. Carlos Queiroz war herausragend. Er war Coach der südafrikanischen Nationalmannschaft gewesen, und deshalb bat ich Quinton Fortune eines Tages um sein Urteil. »Fantastisch«, sagte Quinton. »In welcher Hinsicht meinst du das?«, erkundigte ich mich. »In jeder Hinsicht«, antwortete Quinton. »Na ja«, dachte ich, »das soll mir genügen.«
Als Carlos 2002 nach England kam, um mit uns zu verhandeln, erwartete ich ihn in meinem Trainingsanzug. Carlos war dagegen makellos gekleidet. Er hat diese weltmännische Art an sich. Auf mich machte er einen solch umwerfenden Eindruck, dass ich ihm den Job sofort anbot. So viel Einfluss auf das Trainingsgeschehen von Manchester United hatte zuvor niemand, ohne tatsächlich Trainer des Clubs zu sein. Er übernahm Verantwortung für viele Bereiche, mit denen er sich eigentlich gar nicht hätte befassen müssen.
»Ich muss dringend mit dir reden!« Carlos hatte mich 2003 in Südfrankreich angerufen, als ich dort gerade Urlaub machte. Was war los? Hatte es jemand auf ihn abgesehen? »Ich muss einfach nur mit dir reden«, wiederholte er.
Und so flog er nach Nizza, während ich mich ins Taxi zum dortigen Flughafen setzte, wo wir uns ein ruhiges Eckchen suchten.
»Mir ist der Job bei Real Madrid angeboten worden«, sagte er.
»Ich muss dir zwei Sachen dazu sagen: Erstens, du kannst das Angebot nicht ablehnen. Zweitens, du verlässt einen wirklich guten Verein. Vielleicht bist du nicht länger als ein Jahr bei Real. Bei Man United könntest du für den Rest deines Lebens bleiben.«
»Ich weiß«, antwortete Carlos. »Ich halte es nur für eine so tolle Herausforderung.«
»Carlos, ich kann dir das nicht ausreden. Denn wenn ich es tue, und Real Madrid gewinnt nächstes Jahr die Champions League, dann wirst du sagen – da hätte ich dabei sein können. Aber ich sage dir nur, dass es ein Albtraumjob werden wird.«
Nach drei Monaten wollte er Madrid wieder verlassen. Ich erklärte ihm, dass er das nicht tun könne. Ich flog nach Spanien, um mich mit ihm zu treffen, und wir gingen zusammen zum Essen. Bei der Gelegenheit sagte ich ihm sinngemäß Folgendes: »Du kannst nicht gehen, halte durch und komm im nächsten Jahr wieder zu uns zurück.« In dieser Saison hatte ich keinen Co-Trainer engagiert, weil ich mir sicher war, dass Carlos zurückkommen würde. Ich setzte an seiner Stelle Jim Ryan und Mick Phelan, zwei gute Trainer, ein, aber ich wollte mit Blick auf eine eventuelle Rückkehr Carlos‘ keine überstürzte Entscheidung treffen. Etwa eine Woche, bevor Carlos anrief und sagte, dass es bei Madrid nicht gut lief, führte ich ein Gespräch mit Martin Jol. Er hatte außerordentlich guten Eindruck auf mich gemacht, und ich war geneigt, ihm den Job zu geben, doch dann kam der Anruf von Carlos, der mich veranlasste, mich nochmal mit Martin Jol zu treffen, um ihm zu sagen: »Ich lasse es vorläufig sein.« Den Grund konnte ich ihm damals natürlich nicht nennen.
Assistent des Trainers von Manchester United zu sein, ist eine herausragende Position. Sie ist im Fußball so etwas wie ein Sprungbrett. Als Carlos uns im Juli 2008 zum zweiten Mal verließ, zog es ihn in seine Heimat, und ich konnte verstehen, dass er nach Portugal zurückkehren wollte. Aber Carlos war einfach fantastisch. Er besaß fast alle Qualitäten, die ein Trainer von Manchester United braucht. Manchmal konnte er emotional werden. Doch von allen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, war er der Beste, daran besteht kein Zweifel. Carlos war absolut geradlinig und konsequent. Er war in der Lage dir direkt ins Gesicht zu sagen: »Ich bin mit diesem oder jenem unzufrieden.«
Er war auch gut für mich, denn er war ein Rottweiler. Er konnte in mein Büro kommen und mir sagen, dass wir etwas unternehmen müssten. Dann skizzierte er es auf dem Flipchart. »Gut, okay, Carlos, genau«, sagte ich dann oft und dachte: »Mensch, ich bin hier eigentlich beschäftigt.« Aber es ist ein guter Wesenszug bei einem Menschen, wenn er diesen Drang hat, die Dinge anzupacken.
In jenem Jahr, als ich beschloss, meine Rücktrittspläne zurückzunehmen, war die Struktur unserer Mannschaft eigentlich gut, obwohl wir Peter Schmeichel und Denis Irwin verloren hatten. Denis Irwin war ein toller Spieler. Wir nannten ihn immer Achtvon-Zehn-Denis. Denis war flink, behände und geistig rege. Er enttäuschte einen nie. Nie gab es irgendwelche negative Pressemeldungen über ihn. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Arsenal, bei dem Denis es zuließ, dass Dennis Bergkamp ein Treffer gelang, und ein Reporter zu mir kam und sagte: »Sie werden von Denis gewiss enttäuscht sein«, und ich erwiderte: »Na ja, er spielt jetzt schon jahrelang für mich, und er hat nie einen Fehler gemacht. Ich denke, wir können ihm diesen einen verzeihen.«
Die größte Herausforderung stellte die Position des Torwarts dar. Von dem Augenblick an, als Peter Schmeichel 1999 zu Sporting Lissabon wechselte – und wir van der Sar nicht zu uns holen konnten –, jonglierte ich herum und hoffte, dass sich der Richtige schon finden würde. Raimond van der Gouw war ein hervorragender, verlässlicher Keeper und ein sehr loyaler und gewissenhafter Trainer, aber er wäre nicht die erste Wahl gewesen. Mark Bosnich war meiner Meinung nach ein fürchterlicher Profi, was wir eigentlich bereits im Vorfeld hätten wissen müssen. Massimo Taibi bewährte sich einfach nicht und ging nach Italien zurück, wo er seine Karriere fortsetzte. Fabien Barthez war zwar Weltmeistertorwart, aber möglicherweise hatte die Geburt seines Kindes daheim in Frankreich Auswirkungen auf seine Konzentrationsfähigkeit, weil seine Leistungen enorm schwankten. Er war ein guter Kerl, ein prima Schlussmann und ein guter Ballfänger. Doch wenn bei einem Torwart die Konzentration nachlässt, dann hat er ein Problem.
Als die Mannschaft mitbekam, dass ich mich zurückziehen würde, ließ sie es langsamer angehen. Meine Taktik war immer, meine Spieler nervös zu halten, sie in dem Glauben zu lassen, dass es stets um eine Frage von Leben und Tod ging. Der Ansatz war das Gewinnen-Müssen. Ich ließ den Ball aus den Augen, weil ich zu weit vorausdachte und mich fragte, wer mein Nachfolger sein würde. Es ist in dieser Situation nur menschlich, dass man sich ein wenig entspannt und sich sagt: »Nächstes Jahr werde ich ja nicht mehr hier sein.«
Manchester United war an meine Anwesenheit so gewöhnt, dass nicht klar war, wie es weitergehen sollte. Das war ein Fehler. Dies wusste ich bereits im Oktober 2000. In dieser Phase sehnte ich das Ende der Saison herbei. Ich konnte sie nicht mehr genießen. Ich verwünschte mich: »Das war dumm von mir. Warum habe ich es überhaupt erwähnt?« Die Leistung, die auf dem Spielfeld geboten wurde, war nicht mehr die Gleiche. Zweifel an meiner eigenen Zukunft begannen an mir zu nagen. Wohin würde ich gehen, was würde ich machen? Ich wusste, dass ich den anstrengenden Job bei United vermissen würde.
Die Saison 2001/02 lief schlecht für uns. Wir landeten in der Meisterschaft auf dem dritten Platz und erreichten das Champions-League-Halbfinale, wo wir gegen Bayer Leverkusen den Kürzeren zogen, aber im Jahr meines Rücktritts vom Rücktritt gewannen wir keinen einzigen Pokal. Und das nach drei Premier-League-Titeln hintereinander.
Im folgenden Sommer verpflichteten wir für viel Geld Ruud van Nistelrooy und Juan Sebastián Verón. Auch Laurent Blanc kam dazu, nachdem Jaap Stam zu Lazio Rom wechselte. Sein Verkauf war jedoch ein echter Fehler, wie ich seither schon des Öfteren betont habe. Meine Entscheidung für Laurent Blanc hatte viel damit zu tun, dass wir jemanden brauchten, der mit den jüngeren Spielern gut zurechtkam und ihnen gegenüber eine gewisse Autorität besaß. Der Beginn dieser Saison war insofern höchst bemerkenswert, weil Roy Keane bei unserer 4:3-Niederlage gegen Newcastle Alan Shearer anging, was ihm einen Platzverweis einbrachte, und wir dann am 29. September einen unglaublichen 5:3-Sieg gegen die Spurs errangen, nachdem Dean Richards, Les Ferdinand und Christian Ziege Tottenham in Führung gebracht hatten, und wir zu einer unserer großartigsten Aufholjagden ansetzten.
Dieses Match habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung! Als die Spieler bei einem Rückstand von 3:0 in die Kabine schlichen, waren sie auf eine Standpauke gefasst. Stattdessen setzte ich mich hin und sagte: »Also, ich erkläre euch jetzt, was wir machen. Wir schießen das erste Tor in der zweiten Hälfte und schauen, wie weit wir dann kommen. Wir greifen sie sofort an, und wir machen das erste Tor.«
Teddy Sheringham war damals der Kapitän von Tottenham, und als die Mannschaften wieder durch den Korridor auf den Platz gingen, sah ich, wie Teddy stehen blieb und zu seinen Jungs sagte: »Lasst es auf keinen Fall zu, dass sie ein frühes Tor machen.« Diese Bemerkung werde ich nie vergessen. Wir schossen das Tor in der ersten Minute der zweiten Halbzeit.
Man konnte danach geradezu sehen, wie die Spurs in sich zusammenfielen, während wir uns zusehends aufplusterten. Es blieben noch 44 Minuten der zweiten Halbzeit. Wir kämpften weiter und schossen noch vier Tore. Einfach unglaublich! Und Tottenhams Status im englischen Fußball verlieh diesem Sieg noch mehr Glanz, als dies nach einer Fünf-Tore-Aufholjagd gegen den FC Wimbledon beispielsweise der Fall gewesen wäre. Einen großartigen Club auf diese Weise zu schlagen, hat Auswirkungen von geradezu historischer Bedeutung. Nach dem Spiel ging es in unserer Kabine hoch her: Die Spieler schüttelten die Köpfe, weil sie gar nicht recht fassen konnten, was ihnen da gerade gelungen war.
Teddy Sheringhams kurzer Appell an seine Spieler vor Beginn der zweiten Halbzeit spiegelte in gewisser Weise unseren Erfolg bei starken Gegnern durch gut getimte Gegentore wider. Es wurde auch darüber spekuliert (was wir selbst gern befeuerten), dass Treffer gegen United eine Art Provokation für unsere Mannschaft wären, die unweigerlich eine schreckliche Vergeltung nach sich ziehen müsse. Die meisten Teams konnten sich bei Spielen gegen uns deshalb nie entspannen, denn sie mussten immer mit einem Gegenschlag rechnen.
Ich tippte während der Spiele gern auf meine Uhr, um die gegnerische Mannschaft zu irritieren, nicht etwa um mein Team anzufeuern. Wenn ich für mich heute ein Fazit ziehen sollte, was das Einzigartige an meinem Trainerjob bei Manchester United gewesen ist, dann würde ich immer auf unsere letzten 15 Spielminuten verweisen. Manchmal geschah in den letzten 15 Minuten etwas geradezu Verblüffendes, so als würde der Ball förmlich ins Netz gesogen. Häufig schienen die Spieler regelrecht zu wissen, dass er in den Kasten gezogen würde. Sie wussten, dass sie einen Treffer landen würden. Es passierte zwar nicht immer, aber die Mannschaft hörte nie auf, es für möglich zu halten. Ein ungeheurer Vorteil.
Ich war immer bereit, das eine oder andere Risiko einzugehen. Mein Grundsatz war: Gerate bis zur letzten Viertelstunde nicht in Panik, bleibe bis 15 Minuten vor Schluss gelassen und dann leg dich ins Zeug.
Beim FA-Cup-Spiel gegen den FC Wimbledon verließ Peter Schmeichel kurzzeitig sein Tor, um nach vorne zu gehen, und wir ließen Denis Irwin als Bewacher einer der Wimbledon-Stürmer an der Mittellinie. Schmeichel war etwa zwei Minuten in der gegnerischen Hälfte. Wimbledon flankte den Ball übers Spielfeld auf einen ihrer großen Stürmer, und der kleine Denis lief ihm den Ball ab und schoss ihn in den Strafraum zurück. Großartig! Peter Schmeichel war sportlich überaus fit. Er und Fabien Barthez spielten gern außerhalb des Sechzehners. Vor allem Barthez war ein recht guter Spieler, hielt sich allerdings für besser, als er tatsächlich war. Auf einer Tour durch Thailand lag er mir andauernd in den Ohren, ihn als Stürmer einzusetzen, und ich gab ihm über eine Halbzeit eine Chance. Die anderen Spieler schlugen den Ball ständig in die Ecken, und Barthez kam mit hängender Zunge zurück, nachdem er dem Ball immerzu nachgerannt war. Er war völlig erledigt.
Keine Mannschaft, die den Rasen des Old Trafford betrat, kam mit der Vorstellung ins Stadion, United würde ihr dort kampflos das Feld überlassen. Man konnte uns auf heimischem Boden einfach nicht demoralisieren. Auch wenn die Gegner 1:0 oder 2:1 führten, wusste der Trainer der gegnerischen Mannschaft, dass ihm noch die letzte Viertelstunde bevorstand, in der wir wie vom Teufel besessen alles was wir hatten in die Waagschale werfen würden. Diese latente Angst vor den letzten 15 Minuten war immer präsent. Dann setzten wir alles auf eine Karte, drängten in den Strafraum und stellten die gegnerische Mannschaft gewissermaßen vor die alles entscheidende Frage: Könnt ihr damit umgehen? Jede kleine Schwäche in ihrer Abwehr vergrößerte unsere Chancen. Und das wussten sie.
Nicht immer hat das funktioniert. Doch wenn es klappte, war die Freude über den späten Sieg doppelt so groß. Dieses Risiko einzugehen hat sich immer gelohnt. Wenn wir nach der Halbzeitpause einen Rückstand aufholen wollten, kam es selten vor, dass wir geschlagen wurden, denn meist war es so, dass die gegnerische Mannschaft so viele Spieler zur Verteidigung abstellen musste, dass es ihnen schwerfiel, wirksame Konter auf die Beine zu stellen.
Zur Halbzeit gegen die Spurs sah es für uns finster aus. Aber wie ich am Ende jener Saison sagte: »In einer Krise sollte man die Jungs am besten beruhigen.« Wir erzielten fünf Treffer und gewannen das Spiel, wobei Juan Sebastián Verón und David Beckham die letzten beiden Tore schossen. Zu jener Zeit hatten wir allerdings erhebliche Torwartprobleme. Im Oktober unterliefen Fabien Barthez zwei grobe Schnitzer. Darüber hinaus verloren wir gegen Bolton 2:1 und gegen Liverpool 3:1, als Fabien den Ball mit der Faust abwehren wollte, ihn aber verfehlte. Am 25. November schlug unser französischer Torwart den Ball direkt zu Thierry Henry ab, der ins Netz traf, und verließ dann die Linie, um einen hohen Ball zu halten, den er nicht zu fassen bekam. Wieder kam Henry, und es stand 3:1.
Der Dezember 2001 begann nicht besser, denn wir verloren zu Hause gegen Chelsea 0:3. Es war unsere fünfte Liga-Niederlage in 14 Spielen. Von da an lief es aber besser. Ole Gunnar Solskjær verstand sich gut mit van Nistelrooy (Andy Cole sollte im Januar nach Blackburn wechseln), und wir eroberten Anfang 2002 die Tabellenspitze. Bei dem 2:1-Sieg über Blackburn traf van Nistelrooy zum zehnten Mal in Folge, und Ende Januar führten wir die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an.
Im Februar 2002 nahm ich dann meinen Rücktritt offiziell zurück.
Als das Thema Rücktritt endgültig vom Tisch war, verbesserte sich unsere Form beträchtlich. Wir gewannen 13 von 15 Spielen. Ich wünschte mir inständig, das Champions-League-Finale 2002 in Glasgow zu erreichen. Ich war mir derart sicher, dass wir so weit kommen würden, dass ich bereits nach geeigneten Hotels in der Stadt Ausschau hielt. Ich versuchte, das Thema runterzuspielen, war aber von dem Wunsch wie besessen, unsere Mannschaft in Hampden Park auf den Platz zu führen.
Im Halbfinale rettete Bayer Leverkusen drei Mal auf der Linie. Zwar stand es nach dem Hin- und Rückspiel gegen Bayer 3:3 unentschieden, doch nach der Auswärtstorregel lagen wir zurück, denn Michael Ballack und Oliver Neuville hatten im Old Trafford jeweils einen Treffer erzielt. Bei Leverkusen spielte damals auch der junge Dimitar Berbatov, der später von den Spurs zu uns wechselte.
Aber ich hatte meinen Job noch. Am Silvestertag, meinem Geburtstag, traf sich die ganze Familie im Alderley Edge Hotel. Es war das erste Mal seit längerer Zeit, dass wir alle wieder zusammen waren. Mark, der sich gewöhnlich in London aufhielt, war gekommen, ebenso Darren, Jason und natürlich Cathy. Alle Rebellen hatten sich um den Tisch versammelt.
Nachdem die Spieler die Nachricht erfuhren, dass ich doch bleiben würde, war ich auf allerlei bissige Kommentare gefasst. Schließlich konnte ich keine Ankündigung von dieser Tragweite machen, ohne dafür ungeschoren davonzukommen, und so durfte ich mir eine ganze Menge Sticheleien anhören.
Ryan Giggs war mit seinem Spott besonders hintersinnig: »Oh, nein, das darf doch nicht wahr sein!«, frozzelte er. »Ich habe doch gerade einen neuen Vertrag unterschrieben.«