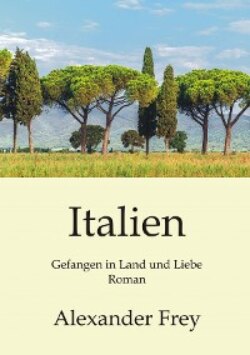Читать книгу Italien - Gefangen in Land und Liebe - Alexander Frey - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеNach Einbruch der Dunkelheit krochen wir aus unserem Versteck. Inzwischen hatten die Italiener erfahren, dass die Amerikaner Verona erreicht hatten. Sie kamen sofort und teilten uns dies mit.
„Jetzt ist es ganz aus, da können wir mit unseren Rennern nicht mehr nachkommen“, war meine erste Reaktion. „Wir müssten abwarten und versuchen, in Zivil weiterzukommen.“
„Ich gehe nach Castel-Franco hier in der Nähe“, sagte Fritz. „Ich habe da ein paar Bekannte.“
„Und ich will versuchen, nach Padua zu kommen“, sagte Paul Brandner. „Als Volksdeutscher aus Siebenbürgen kann ich mich jederzeit als Jugoslawe ausgeben, die Sprache beherrsche ich perfekt.“
„Da werde ich wohl allein gegen die Amerikaner müssen. Ich versuche es jedenfalls, nochmal nach Mantua zu kommen“, legte ich meine Vorstellung dar.
Die erste Überlegung war das Wechseln der Kleider und die Vernichtung der Waffen.
Wir verhandelten mit den Bewohnern, die sich inzwischen um uns versammelt hatten. Sie waren über Erwarten freundlich und hilfsbereit. Was wir an Kleidung benötigten, hatten sie in wenigen Augenblicken herbeigeschafft.
Währenddessen nahmen wir unsere Waffen auseinander. Die Handgranate ohne Zünder und die Maschinenpistolen-Munition flogen in die Dung Grube. Meine Maschinenpistole nahm ich auseinander und übergab sie ohne Munition dem Hausherrn für sein tapferes Verhalten.
In den Zivilsachen fühlten wir uns schon bedeutend wohler. Die Gefahr war jedoch noch nicht gebannt.
Nach und nach tauchten aus allen möglichen Winkeln immer mehr Zivilisten auf. Sie kamen aus ihren Verstecken zum Vorschein, aus Luftschutzlöchern und den in der Nähe liegenden Häusern.
Die Menge wurde immer größer, so dass wir sie nicht mehr übersehen konnten. Was hatte das zu bedeuten?
Zögernd näherten sie sich uns, um ihre Verwunderung zu zeigen. Dann brachten sie ihre Anerkennung darüber zum Ausdruck, dass wir so viel Mut bewiesen und uns so lange versteckt gehalten hatten.
Wir konnten jeder ein paar Brocken italienisch, einige der Italiener sprachen sogar ein recht verständliches Deutsch. Nach ein paar Sätzen kamen wir schon zu einem unerwartet herzlichen Ton. Die Unterhaltung wurde immer zwangloser und ausgelassener.
Man brachte uns Wein, Brot und Fleisch. Mit großem Genuss aßen und tranken wir davon. Seit Tagen hatten wir nicht mehr so gut gelebt. Die ganze Atmosphäre war wohltuend befreiend. Diese offene Unterhaltung belebte unsere Geister und ließ uns alle Angst, Unsicherheit und Gefahr der letzten Tage vergessen. Wir unterhielten uns über das bevorstehende Kriegsende, den Einmarsch der Alliierten in Verona, über die Gastarbeiter in Deutschland, die für uns Waffen bauten und die nun bald wieder in ihre Heimat zurück konnten.
Trotz dieser spontanen Herzlichkeit und des unerwarteten Entgegenkommens konnte ich mich nicht eines komischen Gefühls erwehren. Ich war mir nicht sicher, ob sie es auch wirklich Ernst meinten mit ihrer Freundlichkeit.
Plötzlich war eine Ziehharmonika da. Einer spielte, und auf der großen Steinfläche, die zum Trocknen des Getreides diente, wurde getanzt. Man lachte, scherzte und sang. Der Krieg war vergessen.
„Es lebe der Frieden!“ „Auf das Leben!“ - „Cosi la vita bene!“ sprachen die Italiener mit glänzenden Augen. Bis spät in die Nacht dauerte das kleine Volksfest. Alle schienen Freunde zu sein. Keine Spitzel mehr, kein Hass, nichts als Freude.
Am nächsten Morgen begann für ans wieder die raue Wirklichkeit. Der „Patrone“ machte uns klar, dass wir weiter müssten, da mit Verrat zu rechnen sei und er uns nicht vor der Rache der Partisanen schützen könne.
Er schlug vor, dass wir uns trennen sollten. Jeder für sich alleine hätte um so größere Chancen.
So schwer es uns fiel, mussten wir doch einsehen, dass er Recht hatte. Einer allein konnte sich immer besser durchschlagen und fiel nicht so sehr auf, wie alle drei zusammen.
Wir nahmen ohne viel Worte Abschied voneinander.
Der Patrone gab jedem von uns noch einige gute Tipps, wie wir uns am besten verhalten sollten und versorgte uns mit Verpflegung.
Ich bekam eine schöne Signorina zu diktiert und radelte mit ihr ihn Richtung Mantua. Dort wohnte die Familie von Flora, deren Adresse ich hatte und die ich ja alle gut kannte. Von da aus wollte ich mich später weiter in Richtung Alpen durchschlagen.
Wir fuhren munter drauf los, nebeneinander, hintereinander, wie es sich gerade ergab und die Straßenverhältnisse es zuließen. Während dieser Fahrt wurde mir zum ersten Mal die veränderte Kriegslage so richtig bewusst. Das ganze Gebiet, das noch bis vor wenigen Tagen von deutschen Truppen beherrscht wurde, hatten jetzt amerikanische Einheiten eingenommen.
Bei dem ersten Konvoi, dem wir kurz nach unserer Abfahrt begegneten, hatte ich noch ein ziemlich ungutes Gefühl. Da ich aber merkte, dass sie kaum Notiz von uns nahmen, hatte ich auch das schnell überwunden. Immer wieder begegneten wir neuen Fahrzeugkolonnen. Es waren hunderte von Wagen und es schien kein Ende zu nehmen.
Die Amis, mit ihren riesigen Mengen an Nachschub, wirbelten auf den trockenen Straßen hohe Staubwolken auf. Der feine Staub bedeckte unsere Gesichter und Kleidung. Wir sahen aus wie die Mehlwürmer, aber das störte uns nicht. Auch nicht das Gelächter der Fahrer, die sich über unser Aussehen amüsierten. Wir spielten ein Liebespaar und das gab mir ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit.
Andere der Soldaten winkten uns zu, wir erwiderten lachend ihre Grüße. Ich hatte nicht mehr die geringste Befürchtung, dass noch etwas schief gehen könnte. Bisher ging alles wunderbar glatt.
In mir jubelte es. Ich hätte dieses schöne tapfere Mädchen vor lauter Freude küssen mögen. Leider blieb mir dazu keine Zeit. Wir mussten so schnell wie möglich Mantua erreichen. Ich durfte den Anschluss nicht verpassen.
Zu früh gejubelt. Ein Zivilist kreuzte unseren Weg, richtete die Maschinenpistole auf uns und zwang uns zum Absteigen. Unzählige Gedankten schwirrten mir durch den Kopf. Nur mit aller Ruhe gelang es mir, meine Aufregung zu verbergen. Was blieb mir noch übrig? Links führte der Weg nach Ostiglia, rechts die Straße nach Mantua. Es war nur noch ein Katzensprung. Sollte ich jetzt, so kurz vor dem Ziel, noch aufgeben müssen?
Meine Begleiterin spurte sofort! Sie war einfach fabelhaft, ein wahres Prachtmädel. Sie redete wild auf den Zivilisten ein, ließ ihn kaum zu Wort kommen, gestikulierte mit ihren Händen in alle Himmelrichtungen. Obwohl ich kaum ein Wort verstand, war mir klar, dass sie das Blaue vom Himmel beschwor.
Ich pfiff währenddessen das italienische Kampflied „Avanti Popolo, Banderi-rosso“. In meinem Äußeren unterschied ich mich nicht von einem Italiener. Schon in der Heimat hatte man mich oft wegen meines dunklen Typs für einen Ausländer gehalten.
Der Zivilist nickte mir zu, er glaubte, in mir einen Landmann zu sehen und ließ uns passieren.
Erleichtert setzten wir unsere Fahrt die nächsten Kilometer fort. Auf der schönen, gut ausgebauten Straße, fünfzehn Kilometer vor Mantua, trennte ich mich von meiner tapferen Begleiterin.
Wir kamen überein, dass ich jetzt sicher ohne weitere Gefahr mein Ziel erreichen würde.
Sie hatte ihre Sache gut gemacht. Mit einem unbestimmten Gefühl zwischen Melancholie und Hoffnung nahm ich in dem Bewusstsein, sie nie wieder zu sehen, von ihr Abschied. Ein Gefühl, das ich schon so oft in diesen letzten Jahren verspürt hatte, wenn ich mich von Menschen, die ich nur flüchtig kennengelernt hatte, mir aber so vertraut waren, wieder trennen musste. Gleichsam ein Gefühl von Glück und Schmerz, einem Menschen begegnet zu sein, der dieses Leben um so vieles bereicherte. Allein! Aber ich hatte keine Zeit, diesem Gedanken nachzuhängen.
Das letzte Stück bis zur Stadt verlief ohne weitere Zwischenfälle.
Nur flüchtig nahm ich beim Näherkommen die Schönheiten dieser altertümlichen, romantischen Stadt wahr. Die alten Türme und Kuppeln, die Mauern des Kastells vermittelten den sicheren Eindruck über Urzeiten währender Beständigkeit.
Als ich die Brücke erreichte, die zur Stadt hereinführte, hätte ich weinen mögen. Von Niedergeschlagenheit und Verzweiflung gepackt, hielt ich wie gelähmt an.
Die Brücke, die von deutschen Soldaten gesprengt worden war, wurde nun von deutschen Gefangenen, unter Bewachung der Amerikaner, wieder repariert. Es waren die ersten deutschen Gefangenen, die ich zu Gesicht bekam. Das war endgültig das Ende.
Ich ließ mich etwas unterhalb der Brücke von einem Fischer in seinem Kahn über den See setzen, zahlte in Lire und dankte ihm dann kurz.
Auf dem Deich auf der anderen Seite stand ein Zivilist und kontrollierte die Papiere. Wieder pfiff ich das Lied der „Banderi rosso“, zupfte mein weißes Taschentuch höher aus der Revers-Tasche, „das Erkennungszeichen der Partisanen“, wie mir der Patrone versichert hatte und drückte mich um den Posten herum, als er gerade die anderen Passagiere überprüfte. Schnell radelte ich in die Stadt.
Ein unbeschreibliches Gefühl der Freude, nun endlich in Sicherheit zu sein, überkam mich.
Wenige Augenblicke später kam auch schon die Ernüchterung. Was ich nun erlebte, erforderte wirklich das Äußerste an Beherrschung, um nicht endgültig aufzugeben.
Wo ich hinsah, Soldaten über Soldaten. Die ganze Stadt schien eine einzige Lagerstätte von Militär zu sein. Auf dem großen Marktplatz vor dem alten Kastell saßen die Soldaten bei ihren Fahrzeugen. Ich schätzte ungefähr tausend. Ein wahrer Hexenkessel. Hier im Hof des Kastells zu Mantua wurde Andreas Hofer erschossen. Hier musste ich vorbei. Vorbei an den feindlichen Soldaten, die auf der Straße herum saßen. Ihre Augen fragend, lauernd und abschätzend auf mich gerichtet, beobachteten sie mich genau. Ich kam mir vor, als müsste ich Spießrutenlaufen. Ein Entkommen wäre unmöglich gewesen. Also Ruhe bewahren. Singen, pfeifen, weiterfahren, nur keine falsche Bewegung. Aber mein Äußeres gab wohl den Anschein, dass ich wie ein echter Italiener wirkte. Und das, obwohl ich noch immer meine Sprungstiefel von brauner Farbe und mein Kaki-Hemd an hatte. Nur die Jacke und Hose waren von dem Bauern. Das Haar dunkel und wellig, wie bei einem Südländer, alles dick eingepudert mit weißen Straßenstaub. An der Querstange des Rades war in einer alten Decke ein ganzes Paket Nazionali-Zigaretten eingewickelt, damit ich was zum Tauschen hatte, wenn mein weniges Geld ausgehen sollte.
Aber auch diese bangen Minuten meines jungen Lebens gingen vorüber. Es war mir kostbar. Mit meinen 21 Jahren hatte ich ja gerade erst angefangen zu leben, es erst durch die Gefahren, Ängste und Entbehrungen des Krieges richtig schätzen gelernt. Ungefähr 100 Meter hinter dem Marktplatz fand ich die Via Cailori.
Ich holte noch einmal tief Luft, bevor ich mich in das Haus wagte, in der Hoffnung, dort keinem Soldaten mehr zu begegnen.
Alles, was ich bisher erlebt hatte, wurde von einem derart ausgelassenen Geschrei überspült, wie es nur dem Temperament der Südländer eigen ist. Die alten Bekannten schrieen und tobten durcheinander, ein einziger Freudentanz wurde aufgeführt und alles war vergessen.
Ich wurde herumgereicht, als wäre ich der Stolz der ganzen Sippe, alle drückten mir die Hand, jeder wollte mich küssen.
Meine Ankunft muss sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen haben. Es kamen immer mehr Verwandte in die Küche, in der wir uns aufhielten, um mich zu begrüßen. Ich wusste gar nicht, dass die Familie so groß war.
Nach dem ersten Getränk und ein bisschen Stärkung kamen die Herren der Schöpfung ins Haus. Zu meinem Entsetzen hatte jeder eine Pistole am Gürtel hängen.
Ich kannte mich nicht mehr aus, was sollte das nun wieder? Für mich waren sie immer Zivilisten und brave Bürger gewesen, die sich um Krieg und Politik nicht kümmerten. Nun standen sie als Freiheitskämpfer vor mir. Und ich war ihnen in jeder Weise ausgeliefert. Sie konnten mit mir machen, was sie wollten.
„Was soll das Zeug?“ fragte ich besorgt, in dem ich auf ihre Waffen deutete.
„Das hat nichts zu sagen“, antworteten sie freundlich, mich beruhigend. „Freiheitskämpfer ist jeder von uns hier immer gewesen.“
„Und was soll jetzt werden?“ fragte ich, immer noch unsicher.
„Mach Dir keine Sorgen, Du hast nichts zu befürchten“, gaben sie mir aufmunternd zu verstehen. „Du hast Dich als Soldat in unserem Land uns gegenüber immer anständig geführt, also werden wir es Dir gegenüber auch so halten. Das ist doch selbstverständlich.
Du bleibst unser Gast.“
Trotz dieser gastlichen Herzlichkeit war ich mir nicht ganz sicher.
Sollte das wirklich eine Garantie für mich sein? Ich hatte kaum noch Hoffnung.
Am nächsten Morgen kam der Onkel, seines Zeichen Zweiter Bürgermeister der Stadt. Er redete auf mich ein.
„Es tut mir leid, aber Du kannst nicht bleiben, es hat keinen Sinn.
Es gibt zu viele Denunzianten, die Dich jeden Augenblick verraten könnten. Auf jeden deutschen Soldaten ist eine Kopfprämie ausgesetzt, wenn er bei Zivilisten gefunden wird. Die Gefahr ist zu groß für Dich, aber auch für die Familie. Du verstehst?“
„Ja, ich verstehe“, antwortete ich völlig niedergeschlagen.
„Unter diesen Umständen bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich werde also in ein Lager gehen.“
Ich war an einem Tiefpunkt angelangt, den auch die Wiedersehensfreude nicht mehr aufhellen konnte.
Aus der Traum von der Freiheit, der Traum, früher nach Hause zu kommen.
Ich hatte keine Lust, noch einmal Schiffbruch zu erleiden, wie hier in Mantua. Wieder auf meinen Drahtesel steigen und allein in Richtung Deutschland fahren? Am Brenner wurden alle Deutschen in Empfang genommen. Das wussten meine Bekannten und ich auch. Es war also unmöglich, auf eigene Faust weiterzumachen.