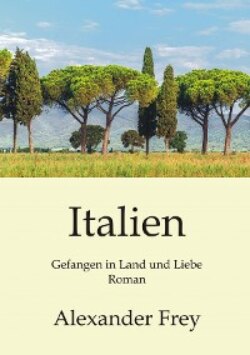Читать книгу Italien - Gefangen in Land und Liebe - Alexander Frey - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAm anderen Morgen waren sie alle wieder da. Dabei deutete Mario so ganz nebenbei an, dass ich mit ihm die in Bäckerei gehen sollte. Er liebte Überraschungen. Es machte ihm sichtlich Spaß, mir eine Freude zu bereiten. Ich bemerkte sofort, dass er bei diesem Vorschlag mit einem bestimmten Hintergedanken spielte. Es amüsierte sich jedes Mal königlich, wenn es ihm gelungen war, mich zu verblüffen.
Jetzt ließ er nicht mehr locker: „Kommen Sie mit in die Bäckerei, Korporale. Da ist eine bella Signorina. Die müssen Sie sehen, sie wird Ihnen gefallen.“
Ich wollte zunächst nicht, aber der Junge ließ mir keine Ruhe. Er zog an meiner Hand, wie ein junger Hund an der Kette. Schließlich ging ich doch mit ihm in die Bäckerei. Mein Glück!
Mario hatte nicht übertrieben. Ein bildhübsches Mädchen, ungefähr achtzehn Jahre alt, stand uns in dem kleinen, sauberen Laden gegenüber. Ihre anmutigen Bewegungen harmonierten wunderbar zu ihrer schönen, schlanken Gestalt. Dunkles Haar umrahmte das liebliche Gesicht, das von einem bezaubernden Lächeln überstrahlt war. Am auffallendsten aber waren ihre dunklen Augen, die von einem Augenblick zum anderen Ausdruck und Farbe wechselten, von dem wildesten Feuer zu romantischer Melancholie und umgekehrt.
„Bitte, geben Sie mir zwei Brötchen“, sagte ich auf italienisch. Unwillkürlich sah ich in ihre dunklen Mandelaugen und sagte auf deutsch: „Mensch, bist Du schön!“
Sie lachte, deutlich erkennbar, dass sie mich verstanden hatte. Ich wurde verlegen und fragte sie: „Sprechen Sie deutsch?“
„Nein, nur ein bisschen“, sagte sie und lächelte dabei herzerfrischend natürlich. Ich war begeistert von dieser Schönheit. Stille – langes Schweigen.
„Ich komme morgen wieder.“
„Bravo, also bis morgen“, antwortete sie.
Mario war glücklich. Er hatte es mal wieder geschafft.
„Gefällt sie Ihnen, Korporale? Was habe ich gesagt! Bella Signorina!“
„Du hast Recht, Mario, sie ist sehr schön. Morgen gehen wir wieder hin.“
„Si, Korporale, ich verstehe. Ich komme wieder mit, va bene.“
So ging das einige Tage. Ich kaufte zwei Brötchen, wir lächelten uns an, ich sah in ihre faszinierenden Augen und verließ, jedes Mal von Neuem begeistert, das kleine Geschäft. Nach einer Woche machte sie mich mit ihrer Mutter bekannt, die plötzlich im Laden stand, die Situation erkannte und sofort mit großer Überzeugungskraft auf mich einredete, um mich zum Abendessen einzuladen.
„Sie müssen unbedingt kommen. Ich bereite Ihnen Ihr Lieblingsgericht, wenn Sie wollen. Sie müssen wissen, ich koche leidenschaftlich gern. Meine Küche müssen Sie kennen lernen.“
„Danke, ich komme gern“, antworte ich schüchtern. Ich war völlig überrascht von dieser Herzlichkeit. Ja, ich war glücklich. Zufrieden machte ich mich auf den Heimweg. In unserer Unterkunft, einer Bauernstube, war es ungemütlich, kalt und schmutzig. Die Wände waren nur mit einfacher Kalkfarbe gestrichen, oben weiß, unten hellblau. Es war schon alles recht mitgenommen und die Holzbetten waren immer zu zweit übereinander montiert, so wie in jedem Landserlager.
Der einzige Platz war am Tisch, wo gelesen, gegessen und geschrieben wurde. Er war daher immer besetzt. Die Flucht nach draußen, nach Abwechslung, war darum nur zu verständlich. Für uns eine willkommene Entspannung. Manchmal liefen wir abends einige Kilometer, um auf andere Gedanken zu kommen, oder einfach mal was anderes zu sehen. Oft landeten wir in den Kneipen und waren am anderen Morgen noch halb trunken vom italienischen Wein.
Um so mehr freute ich mich über diese Einladung. Aufgeregt, wie beim ersten Stelldichein, ging ich abends zu der Bäckerei. Die ganze Familie war zu meinem Empfang versammelt und ich wurde mit einer Herzlichkeit, einer Selbstverständlichkeit, begrüßt, die ich bis dahin nirgends angetroffen hatte. Ich wurde sofort wie ein Sohn in die Familie aufgenommen.
Die Mutter brachte die herrlichsten Speisen aus der Küche. Der Vater bot mir von seinem Rotwein an. Nonno und Nonna (Opa und Oma), für ihr Alter sehr rüstig und aufgeweckt, voll am Leben teilnehmend, tranken mir zu. Flora, die hübsche Tochter des Hauses, bediente mich mit einer Fürsorge, durch die ich mich in dieser wunderbaren Familie ganz zu Hause fühlte.
Aber auch die Eltern und Großeltern standen dem in nichts nach.
„Sie müssen unbedingt wieder kommen“, ließ die Mutter in ihrer herzlichen Art nicht locker.
„Ja, danke, gerne!“ antwortete ich.
Nachdem ich vier Wochen auf herrliche Weise meine Freizeit in diesem Hause verbracht hatte, machte mir die Mutter das Angebot, hier bei ihnen zu wohnen.
„Wir haben oben noch ein hübsches Zimmer, das wird Ihnen sicher gefallen. Morgens gehen Sie dann von hier aus zu Ihrem Dienst.“
„Ja, natürlich“, stimmte Flora begeistert zu.
„Ich habe mir schon immer einen Sohn wie Sie gewünscht“, sagte der Vater. „Glauben Sie mir, Sie sind uns allen sehr willkommen.“
Ich war mehr und mehr überrascht. Glücklich, kaum begreifend, nahm ich das großartige Angebot an und zog gleich am nächsten Tag in ein nett eingerichtetes Privatzimmer.
Von diesem Tag an war ich der Sohn des Hauses, mit allen Bequemlichkeiten. Ich habe überhaupt immer sehr schnell auf die Mentalität anderer reagiert. Nun hatte ich neben Eltern und Großeltern auch noch die hübscheste Schwester, die man sich denken konnte. Schon als kleiner Junge hatte ich mir neben meinen vier Brüdern immer eine Schwester gewünscht.
Stefano, der tüchtige Vater, stand meistens in der Backstube.
Bereits nach zwei Uhr stand er auf und steckte seinen Ofen mit Reisig an, um ihn auf die richtige Temperatur zu bringen. Dann bereitete er seinen Teig vor, um pünktlich um sechs Uhr die ersten Brötchen ausliefern zu können.
Emma, seine Frau, war dann die nächste. Sie richtete die anderen Dinge, die zu erledigen waren, her. Noch halb schlafend kroch sie aus dem Bett. Und doch immer munter, lustig und gut aufgelegt.
Sie war eine großartige Frau, gutmütig bis aufs Hemd, von der man alles haben konnte. Sie nahm mich wie ihr leibliches Kind ans Herz.
Um 7.00 Uhr krochen dann auch der Nonno und die Nonna aus den Betten, um am täglichen Familienleben Anteil zu haben.
Nachdem der Nonno zunächst einen tiefen Schluck aus seiner immer in der Nähe stehenden Rotweinflasche genommen hatte, ging er zu Stefano in die Backstube. Trotz seines Alters war er noch sehr rüstig. Die Weinflasche war sein Kompagnon, und vielleicht hatte auch sie ihren Anteil an seinem hohen Alter.
Ich musste pünktlich um acht Uhr meinen Dienst beginnen. So war ich der letzte, der aus den Federn kroch, um mich sogleich, sofern ich keinen Nachtdienst hatte, an den bereits gedeckten Tisch zu setzen.
Die obligatorische Mahlzeit mit viel Milch, wenig Kaffee und reichlich Zucker, man bezeichnet sie als Kaffeelatte, schmeckte mir so schon ganz gut. Ich richtete mich nach meinen Gastgebern und tunkte die alten Brötchen in diese Süßigkeit. Das schmeckte mir ausgezeichnet.
Der Dienst wollte einfach nicht mehr vergehen. Er kam mir von Tag zu Tag länger vor, bis ich endlich wieder zu meiner geliebten Familie gehen konnte. Die Bäckerei war mein Zuhause geworden. Hier gab es jeden Abend etwas anderes, jeden Tag eine neue Überraschung und Abwechslung, ganz gleich, ob es sich nun um das Essen oder um unseren sonstigen Zeitvertreib handelte.
Emma war eine ausgezeichnete Köchin. Sie liebte es, mich zu verwöhnen und empfing mich meistens schon an der Tür.
„Rate mal, was ich Dir heute gekocht habe?“ waren dann immer ihre ersten Worte.
Ich lachte, legte den Arm um ihre Schultern, küsste ihre Wange und versuchte zu raten.
„Pasta a la Bolognese?“
„No, heute bekommst Du Hühnchen. Salvatore war heute bei uns und hat einige mitgebracht. Viele Grüße soll ich Dir von ihm bestellen, er mag Dich.“
„Danke Emma“, sagte ich, „Du bist großartig!“
„Und hinterher bekommst Du noch einen Vino buono, molto buono, Du hast nie einen besseren getrunken.“
„Komm, gehen wir rein, jetzt hast Du mich richtig neugierig gemacht, außerdem habe ich einen Mordshunger.“
Emma verstand es, ihre Kochkunst anzubieten und sie hatte wahrlich ein unheimliches Geschick darin, den richtigen Geschmack zu treffen.
Dann, nach dem ausgedehnten Mahl, es handelte sich dabei immer um eine längere Sitzung, die über eine oder sogar mehrere Stunden ging, widmete ich mich der Tochter des Hauses, Flora.
„Hast Du heute keine Lust, italienisch zu lernen?“ fragte sie vorsichtig, wenn ich dann meist vom Essen derart mitgenommen war, dass ich träge auf dem Stuhl saß und mich kaum rühren konnte.
„Nonna, mach dem Rudi schnell einen Espresso“, sagte sie dann zur Oma. Alle Achtung, der Kaffee hatte es in sich und half mir auch gleich wieder auf die Beine.
Dann begann Floras große Stunde: „Das ist eine Gabel. Das ist ein Löffel. Ich wohne hier im Haus.“ usw. Bis tief in die Nacht ging das so.
Die Eltern dagegen zogen sich meist früh zurück. Nonna lag müde auf der Tischkante und Nonno hatte seine Weinmenge intus und war schon lange zuvor in tiefen Schlaf versunken. Nur wir zwei waren noch wach, redeten miteinander, so gut einer den anderen verstehen konnte und fanden uns mehr und mehr in inniger Verbundenheit.
Nein, es war nicht nur die Sprache, das Erlernen der Sprache, das uns miteinander verband. Es war mehr, allein das Beisammensein! Das Erkennen des anderen Menschen, einer anderen Mentalität, die Art und die Sitten des Südländers, wie nur er es versteht, sich zu geben und zu unterhalten. Bei einer so hübschen und liebenswerten Lehrerin machte natürlich das Lernen auch Spaß. Es fiel mir leicht. Ich las in den Illustrierten, sie verbesserte, brachte den richtigen Tonfall hinein und las vor. Dann tobten wir wie kleine Kinder. Balgten in der Küche wie übermütige Jungen. Ich half beim Abwasch, spionierte in den Kochtöpfen und naschte aus der Speisekammer.
Wenn ich Sonntags im Hause war, legte ich leichte Tanzmusik auf. In der Küche, in der wir uns meist aufhielten, stand ein alter Plattenspieler. Dann tanzten wir nach den einschmeichelnden Melodien und vergaßen die Küche, den Kampf und den Krieg, waren nur noch wir selbst, ganz einfach wir selbst, unbeschwert und glücklich.
Mir gefielen die schönen italienischen Melodien. Ich konnte ihnen stundenlang zuhören und mit meiner schönen Gesellschafterin träumen.
Die Oma war besessen von Caruso und Gigli. Sie schwärmte von ihnen wie ein junges Mädchen. Ich mochte sie auch. Sie wirkten herrlich beruhigend, romantisch, südländisch. Aber ich mochte auch besonders gern Glenn Miller, der gerade sehr modern war und überall gespielt wurde. Leider war das Anhören dieser Musik für uns streng verboten.
Mitten im Krieg erlebte ich innerhalb dieser Familie unvergleichlich schöne Wochen friedlichster Harmonie.
Am 3.1.1945 hieß es plötzlich beim Appell: „Die Kompanie wird heute Abend um 22.00 Uhr verlegt.“
Ich war wie erstarrt. Das kam einfach zu überraschend, zu schnell, zu hart und zu plötzlich. Mir blieb nach meinem Dienst kaum Zeit, um Abschied zu nehmen.
Und wieder war ich zutiefst von meinen Gastgebern überrascht. Auch sie berührte diese Nachricht wie ein Schock. Emma lag im Bett. Als sie hörte, dass ich fort musste, war sie hellwach. Sie stand in ihrem schlichten Nachthemd in der Tür, die Augen weit aufgerissen, also wollte sie sagen, das stimmt doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, mach keine Witze.
Flora lag bei der Nonna im Doppelbett, ihre Augen unter dem Bettzeug verborgen, weinte Herz erschütternd, genau wie Oma, die inzwischen aufgestanden war. Selbst der Opa kam aus seinem Zimmer, vorsichtig lauschend, worum es ging. Als er endlich begriffen hatte, was gespielt wurde, fand er kaum Worte. Seine knöchernen, abgearbeiteten Hände, die schon so viel erlebt hatten, unter anderem den Krieg mit Österreich, sie zitterten, fassten nach mir. Dann drückte er mir beide Wangen, als wollte er sagen, du bist noch zu jung zum Sterben, du darfst nicht weggehen, du musst erst ein Mann werden. Ich wusste, wie ihm zu Mute war. Ich hatte die Schlacht um Anzio-Nettuno mitgemacht. War auf dem Rückweg von Rom bis Perugia zu Fuß gelaufen. Hatte dann wieder bei Florenz gekämpft und fast alle Kameraden verloren und war selbst nur durch viel Glück am Leben geblieben.
So hatte ich die liebenswerte, mir unendlich teure Bekanntschaft dieser wunderbaren Menschen hier gemacht. Nur durch Zufall war ich noch am Leben. Eines der vielen Wunder, die man nicht erklären kann. Die besten Freunde waren gefallen, aus 30 wurden 20, aus 20 dann 10, am Ende blieben drei oder vier.
Ich wusste also, was es bedeutete, an die Front zu müssen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte nicht als Feigling dastehen, auch wenn ich sinngemäß die Hosen oft bis zum Kragen voll hatte.
Emma stopfte mir eine große Salami in den Beutel und Stefano holte noch einige Brötchen dazu. Ich zog mich langsam zurück zur Tür. Umarmte einen nach den anderen.
„Ich komme wieder!“
Oma legte mir mit zitternden Händen ein silbernes Kettchen um den Hals, wobei ihr dicke Tränen aus den Augen kullerten.
„Es soll Dir Glück bringen, Dich beschützen“, schluchzte sie.
Ich stand in der Tür und drehte mich zum Gehen um. Da stürzte Flora wie ein Inferno auf mich zu, stürmisch umarmte sie mich:
„Versprich, dass Du wieder kommst, auch wenn Ihr den Krieg verliert“, flehte sie mich an, „versprich es ...“
„Ich verspreche es, so wahr ich hier stehe! Ich komme wieder und wenn es zwanzig Jahre dauern sollte!“
So schwer es mir fiel, ich musste mich losreißen, um es mir nicht selbst noch schwerer zu machen. Ein solches Haus, so voller Liebe und Herzlichkeit, voller Frieden und menschlicher Verbundenheit, hatte ich bis dahin nie in meinem Leben gekannt und nie mehr erlebt. So gesehen war es mein größtes Erlebnis in all den Jahren, die ich im fremden Land verbrachte.