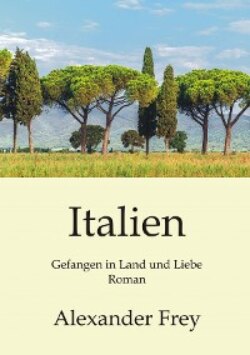Читать книгу Italien - Gefangen in Land und Liebe - Alexander Frey - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEndlich waren wir nach harten Kämpfen bei Florenz und dem Futa-Paß in ein kleines Dorf verlegt worden, das etwa 10 km hinter der Front lag.
Der Alte war sehr nervös, schon den ganzen Tag rannte er umher und untersuchte jeden Winkel des kleinen Hauses, in dem sein „Bataillonsstab“ neu untergebracht worden war. Schließlich fand er, was er vermutet hatte, eine doppelte Wand in der Garage.
„Rommel, kommen Sie her, holen Sie eine Brechstange und reißen Sie die Wand hier auf !“
Rommel, der Fahrer des Alten, nahm Haltung an und sagte kurz: „Zu Befehl Herr Major, die Wand aufreißen!“
In Wirklichkeit hieß der Fahrer natürlich nicht Rommel, sondern Schulz, aber den Namen Rommel hatte man ihm verliehen, weil er den Alten aus Afrika gerettet hatte, und zwar mit dem Schwimmwagen. Unterwegs wurden sie dann von einem Schiff aufgefischt und nach Italien gebracht. Seit dieser Zeit waren Rommel, der Schwimmwagen und der Alte eine Gemeinschaft auf Biegen und Brechen.
Der Spitzname passte gut zu dem blonden Fahrer, der flink wie ein Wiesel war und immer den Wagen in fahrbereitem Zustand hatte. In einer Zeit, in der Ersatzteile knapp waren, war das schon eine ganz tolle Leistung.
Ohne Schwimmwagen war der Alte nie unterwegs, seit Afrika!
„Und Sie, meine Herren, helfen dem Fahrer“, sprach der Alte uns an, die wir noch mit dem Einräumen beschäftigt waren.
„Jawohl, Herr Major“, kam es 12fach zurück.
Wir, diese 12 Mann, waren die Sicherungsgruppe des Bataillonskommandeurs und immer in seiner Nähe, seit Florenz. Einzige Aufgabe: Bewachung des Gefechtsstandes, Sondereinsätze! Man munkelte, der Alte wolle sich noch das Ritterkreuz mit uns verdienen, das Deutsche Kreuz in Gold hatte er in Afrika erhalten.
„Mensch schau her“, rief Rommel, „da haben wir die Bescherung, alles voll mit Wein und Schnaps.“
„Toll, der Alte hatte schon immer eine gute Nase, das gibt ein Fest.“ Schon waren wir in das Versteck eingedrungen, holten Flasche um Flasche aus der engen Nische.
„Wie viele sind es jetzt“, fragte Rommel. „40 Stück“, antworteten wir anderen, „alles gute Sachen“.
„Drei Mann an die Wand gegenüber“, befahl Rommel, „da ist bestimmt noch etwas drin.“
Mit drei Mann rissen wir die gegenüberliegende Wand auf. Der Schweiß lief uns in Strömen von der Stirn, aber wir gaben nicht nach. Kaum hatten wir die ersten Steine aus der zweiten Mauer gebrochen, waren wir platt vor Staunen. Auch hier war vor der eigentlichen Wand ein Hohlraum von ca. 50 cm, der gefüllt war mit besten Delikatessen. Rommel stürzte ins Haus: „Melde gehorsamst, die Wände sind aufgebrochen, 80 Flaschen Wein, Cognac und 300 Eier, sauber eingelegt, entdeckt!“
Freudestrahlend kam der Alte aus dem Haus, hinter ihm Leutnant Schulze, ein sympathischer Offizier, der schon lange bei unserer Einheit war und mit uns durch Dick und Dünn ging.
„Schulze, Sie verteilen die Sachen da. 12 Flaschen für die Sicherungsgruppe, dazu 50 Eier.“
Auch der Stabsarzt war aufmerksam geworden, ein Schmunzeln war über sein Gesicht gelaufen, als er die vielen Dinge sah, die wir da geangelt hatten. Mit Kennerblick holte er einige besondere Flaschen Cognac aus dem Sortiment und trug sie ins Haus.
„So, meine Herren, der Rest geht an die Front, damit die auch mal einen guten Tropfen bekommen“, sagte der Alte und verschwand mit einigen Kostbarkeiten.
Unteroffizier Richter hatte das Kommando bei der Sicherungsgruppe, er befahl, die Flaschen und Eier in unser Quartier zu bringen, welches gegenüber, in einem palastähnlichen Gebäude war. Hier hausten wir, primitiv und anspruchslos, wie die Vandalen. Das einzige Möbelstück war ein großer Holztisch, schwer und massiv, der in der Mitte des Raumes stand. Rundherum lagen Stroh und Gepäck, die Schlafstätten, die wir notdürftig hergerichtet hatten. Wir wussten, es geht doch bald weiter, die Front war nahe, das Ende der Schlacht um den Futa-Paß war zu erkennen. Die Verluste auf unserer Seite waren hoch, nicht tragbar für die Deutsche Heeresführung.
400 Bomber hatten unseren Abschnitt in ein einziges Trümmerfeld verwandelt, es war kaum Zeit, die Toten zu bestatten. Die Verluste in unserem Bataillon waren sehr groß, der Infanterie-Einsatz gegen die gut ausgeruhten amerikanischen Truppen forderte weitere Opfer.
Um so verständlicher war es, dass wir die gefundenen Flaschen als ein Geschenk des Himmels empfanden und tüchtig davon Gebrauch machten.
Gegen Abend schoss sich der Ami auf unseren Abschnitt ein, die schweren Granaten der Artillerie sausten in regelmäßigen Abständen heulend über unser Quartier.
Unteroffizier Richter öffnete mit Bedacht die erste Flasche: „Lasst es Euch gut schmecken, Prost, Kameraden!“
Immer mehr Flaschen lagen auf oder unter dem Tisch, alle waren total blau.
Kleine Flammen zuckten auf dem schweren Bauerntisch, sie tanzten hin und her, einmal größer, dann wieder kleiner, hellblau, grünlich, wie Spiritus-Flammen.
Brandner hatte damit angefangen, den Schnaps auf den Tisch zu gießen und mit dem Feuer zu spielen.
„Mann, Du steckst uns die ganze Bude in Brand, bist Du verrückt?“ Brandner lallte, halb auf dem Tisch liegend: „Macht doch nichts, wir sind sowieso bald im Eimer, hörst Du die Granaten nicht? Sie kommen immer näher. Im nächsten Augenblick kann der ganze Palast einstürzen.“
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, der Alte stand mitten im Raum, breitbeinig, die Hände in der Hüfte abgestützt.
„Ich brauche dringend zwei Mann für einen Sondereinsatz.“
Unteroffizier Richter wollte Meldung machen, aber der Alte winkte leicht ab, „schon in Ordnung, Richter, wer ist nicht blau?“
„Alle, Herr Major“, gab Richter zurück und versuchte gerade zu stehen und Haltung anzunehmen.
„In spätestens einer halben Stunde will ich zwei Mann und zwar einigermaßen nüchtern, wie, ist mir egal, wir brauchen dringend Sprengmunition.“ Und schon war er draußen. -
Richter hatte nun eine schwere Verantwortung, wen sollte er nehmen? Sein Blick, der vom Alkohol getrübt war, ging durch die Runde, blieb bei mir und Fischer hängen.
„Ihr zwei seid noch einigermaßen intakt, unter die kalte Dusche mit Euch und rüber zum Chef.“
Das kalte Wasser tat uns gut, der brummende Kopf jedoch blieb.
Der Chef sah uns von oben bis unten an: „So, meine Herren, Sie fahren mit drei LKWs nach Piacenza und holen 12 Tonnen Sprengmunition. Wir brauchen das Zeug schnellstens, hier sind die Papiere, viel Glück!“
Rommel sauste mit uns durch die Nacht. Der kühle frische Fahrtwind im offenen Schwimmwagen tat uns gut. Nach einer halben Stunde meldeten wir uns beim KFZ-Meister, der sogleich die Wagen mit Fahrer zur Verfügung stellte.
Ich bekam das Kommando über die drei Wagen und natürlich die Verantwortung über den Ablauf des Transportes.
„Und passen Sie auf die Jagdbomber auf, wir brauchen die Wagen, die Munition und die Leute, sonst können Sie Ihr Testament machen.“
„Jawohl, Herr Oberfeldwebel“, kam es von mir zurück und schon saß ich beim Fahrer Rohling im ersten Wagen, einem 3,5-Tonner Fiat. Ein zweiter 3,5-Tonner folgte uns. Den Schluss machte der 6-Tonner, in dem Fischer als Beifahrer saß und den Anschluss halten musste.
Rohling war ein guter Fahrer, das merkte ich sofort. Er kannte sich auch in der finsteren Nacht in dem Gelände gut aus.
Niemals zuvor hatte ich ihn kennengelernt, niemals zuvor war ich hinter der Front eingesetzt gewesen. Es war daher eine gute Abwechslung, ein völlig neues Gefühl. Ich machte es mir im Wagen bequem und drückte mich in meine linke Ecke (der Wagen hatte Rechtssteuerung).
Rohling war Kettenraucher und zog eine Zigarette nach der anderen in seine Lungenflügel. Die Packung „Nil“ in Großformat war mir sofort aufgefallen, sie lag griffbereit auf dem Armaturenbrett.
„Rauchst Du?“
„Nein, Danke, selten, außerdem brummt mir der Kopf von der Sauferei. Wir haben nämlich 80 Flaschen Wein und Cognac gefunden und einen drauf gemacht.“
„Was hat denn da der Alte gesagt?“
„Och, der Alte ist in Ordnung. Der hatte uns schon letzte Woche oben auf dem Futa-Pass eine Sonderration Rum mit Tee verschrieben, um die Stimmung zu halten.“
„So kenn´ ich den ja gar nicht! Vor Monaten hat er uns noch die weißen Halstücher vom Hals gerissen und drei Tage Bau aufgebrummt.“
„Stimmt“, gab ich zurück, „und bei Abano gab er mir den Befehl, bis zur letzten Patrone zu kämpfen, weil ich Meldung machte, dass Amis mit 5 Panzern vor unserem Kompanieabschnitt standen und wir keine Panzerfäuste zur Verfügung hatten.“
„Und wie ging das dann weiter?“ wollte Rohling wissen.
„Ja“, sagte ich, „der Pätzold hat zwei und der Bauer einen mit der Gewehrgranate abgeschossen, die Artillerie einen und der Letzte ist abgehauen.“
„Am anderen Morgen standen 7 Stück vor der Kompanie, angegriffen haben sie zum Glück nicht. Die hatten anscheinend die Hosen gestrichen voll, wir aber auch, was die Amis aber Gott sei Dank nicht wussten.“
„Der Alte hat dann den beiden Jungs das Ritterkreuz 2 und das Ehrenkreuz 1 an die Brust geheftet. Später bekamen sie dann noch die Panzerabschußstreifen auf die Ärmel genäht. Heute sind sie beide bei uns in der Sicherungsgruppe beim Stab. Pätzold ist schon zum Unteroffizier ernannt worden.“
„Wie lange bist Du schon bei dem Haufen?“ fragte Rohling.
„Ich? Seit der Neuaufstellung in Perugia Anfang Januar 44“.
„Dann sind wir zwei ja zur gleichen Zeit gekommen und trotzdem haben wir uns nie gesehen.“ „Ja, das finde ich auch komisch, aber ich war immer vorne im Einsatz.
„Also dann gönne ich Dir mal ein paar ruhige Tage. Kannst in Piacenza mit mir in ein Bordell gehen, da gibt es prima Bienen, die stehen ausgezeichnet.“
„Nee, danke“, sagte ich, „mein Kopf brummt wie ein ganzes Bienenhaus und Frauen hatte ich hier in Italien noch nicht.“
„Wat, soo grün bist Du noch?“
„Ja, leider!“
„Nimm wenigstens eine von meinen Zigaretten, die Nacht ist lang.“ Dankend lehnte ich ab, ich hatte genug zu tun, mich wach zu halten.
Die Straße war eng, mehr ein Feldweg. Wir waren kurz vor Bologna und die Sicht bei den Tarnscheinwerfern sehr schlecht, trotzdem erkannten wir beide fast zur selben Zeit eine Gestalt vor uns. Ein Krad-Melder mit seinem dunkelgrünen Gummimantel, der ganz braun glänzte, schwankte uns entgegen und hob zum Zeichen, dass wir anhalten sollten, die Hand.
„Mensch, was ist denn das?“ sagte ich zu Rohling, der sofort gehalten hatte und aus den Wagen gesprungen war.
Nun war auch ich hellwach und sofort bei dem verwundeten Landser, der vor dem Wagen zusammenbrach, mit der einen Hand nach hinten zeigte und nur noch die Worte „da hinten liegt noch einer“, herausbrachte, dann dämmerte er in eine Ohnmacht. Die braune Farbe, die wir von oben bis unten auf seinem Gummimantel gesehen hatten, war Blut.
Die anderen beiden Wagen waren aufgefahren und hielten an.
„Wir müssen sofort zurück“, sagte ich kurz, „hier sind Partisanen.“
„Den Verwundeten müssen wir sofort zurückbringen, sonst stirbt uns der arme Kerl unten den Händen!“
„Die Schweine“, kam es aus Rohling hervor, „erst schießen sie unsere Leute zusammen und dann türmen sie in die dunkle Nacht, nicht zu fassen!“
„Wollen wir nicht zuerst nach dem anderen Krad-Fahrer sehen?“
fragte ich Fischer und die anderen Fahrer. Aber alle waren sich einig, dass wir erst Verstärkung holen und den Burschen den Arsch warm machen müssen.
Also machten wir mit unseren Fahrzeugen kehrt und hielten in der ersten Ortschaft vor der Kirche an. Ich klingelte den Pfarrer aus dem Bett, der schlaftrunken seinen dicken Bauch durch die Türe schob. „Was ist los?“ fragte er ängstlich.
„Wir haben einen verwundeten deutschen Soldaten auf dem Lastwagen, den wir nicht transportieren können, bitte versorgen Sie ihn.“
„Si,si, va bene, subito (ja, ja, ist gut, bin schon da)“ kam es spontan zurück, „ich werde helfen.“
Langsam trugen wir den Schwerverletzten in das Gebäude, wo nun auch die Haushälterin erschien und Verbandsmaterial her schaffte.
„Wer war da?“ fragte der Pfarrer. „Partisanen“, gab ich kurz zurück. Er murmelte: „Oh Dio mio (oh mein Gott).“
„Versuchen Sie, einen Arzt zu bekommen, wir sind in einer Stunde zurück.“ Er versprach es und erleichtert fuhren wir zum Tross, wo wir alles, was Beine hatte, aus den Betten holten.
Schwer bewaffnet suchten wir das ganze Gelände ab. Von Partisanen und dem Krad keine Spur.
„Wo steckt nur der zweite Mann?“ fragte mich der Oberfeldwebel, der mit uns gekommen war. „Der muss hier irgendwo liegen, aber wo?“
Wir wollten schon umkehren, als wir endlich das Krad am Hang hängen sahen. „Dort unten liegt was, tatsächlich, es ist das gesuchte Krad.“
Kaum waren wir am Fahrzeug, da bewegte sich in dem Beiwagen etwas. „Gott sei Dank, er lebt“ sagte der Oberfeldwebel.
„Was, er lebt?“ fragten wir ungläubig, „das ist ein Wunder!“
„Ich hatte Glück“, sagte der Beifahrer, ich stellte mich tot, da sind sie abgehauen.“
„Sie sind aber verletzt?“ fragte der Oberfeldwebel. „Ja, am Bein und an der Schulter.“
„Mann, haben Sie einen Dusel und auch noch die Nerven, sich tot zu stellen.“
„Es war meine einzige Rettung, Herr Oberfeldwebel“, kam es trocken zurück.
Schnell war das Krad am Wagen angehängt und der Verwundete vorsichtig auf der Ladefläche untergebracht. An der Kirche machten wir Halt, der Pfarrer stand schon in der Türe, er hatte uns kommen hören.
„Wie sieht es aus, alles in Ordnung?“ fragte der Oberfeldwebel den Pfarrer. „Si, Marschallo, der Dottore war hier, der Verwundete muss sofort in ein Lazarett, er hat viel Blut verloren.“
„Danke, Signore, vielen Dank!“ gab der Oberfeldwebel zurück und legte dabei die Hand an den Stahlhelm.
„Ja, Rohling, dann nehmen Sie die beiden Verletzten gleich mit in das Lazarett nach Bologna“, richtete er sich nun an meinen Fahrer.
„Ich hoffe, dass Sie nicht noch mal überfallen werden, es ist ja bald Tag.“
„Jawohl, Herr Oberfeldwebel“, kam es zurück und schon fuhren wir in Richtung Bologna und die anderen vom Tross zurück zu ihrem Standort.
Alles ging glatt, die Matratzen hatten wir auf der Ladefläche festgebunden, um den Verwundeten unnötige Qualen zu ersparen.
„Das war vielleicht eine Nacht“, sagte Heinz Rohling, „das hat uns gerade noch gefehlt, wir sollten schon bald in Piacenza sein.“
„Jetzt müssen wir halt am Tage fahren“, sagte ich kurz. „Ein Leben retten, ist wichtiger!“
„Und die Jagdbomber am Tage?“ fragte Rohling. „Ich pass´ schon auf“, gab ich zurück.
Kaum waren wir in Bologna angekommen, fing es an zu regnen.
„Schnell, fahr schnell, die Verletzten hinten auf der Pritsche werden nass“.
Bald hatten wir das Lazarett gefunden. Heinz war schon oft hier gewesen. Er kannte jede Straße, jede Dienststelle in der Stadt.
Ich blieb im Wagen und wendete, um keine Minute zu verlieren.
Wir müssen unseren Auftrag erfüllen, dachte ich, sonst sind die Amis an unserem Gefechts-Stand, bevor die Munition vorne ist.
Endlich waren wir auf der Via Emilia (alte Römerstraße) Richtung Piacenza. Heinz rauchte eine Zigarette nach der anderen, ich musste das Fenster öffnen.
„Kannst Du mich ablösen?“
„Aber gerne, wenn Du mir zutraust, dass ich den Schlitten nicht in den Graben fahre.“
Wir wechselten die Plätze, langsam rollte ich in Richtung Norden.
Nur keine Schnitzer, dachte ich, sonst ist es Aus mit uns beiden.
Praxis hatte ich nur vom Pkw und das war schon lange her.
Kurz vor der Stadt setzte sich Rohling wieder ans Steuer. Das Munitionsdepot war schnell erreicht. Sie legten uns alte italienische Holzkastenminen auf die Wagen, dicht an dicht, bis zur Höhe der Pritschen.
„Alles in Ordnung, Sie können fahren“, quakte ein vollgefressener Hauptmann.
Außerhalb der Stadt parkten wir, um vor der Fliegersicht geschützt zu sein, unter großen Bäumen. Es hatte aufgehört zu regnen. Richtung Front konnten wir wegen der Flieger nicht mehr fahren.
„Gehst Du mit ins Soldatenheim?“ fragte Rohling. Ich verneinte.
„Ich bleibe hier bei den Fahrzeugen und halte freiwillig Wache.“
„Gut, also, bis dann!“
„ … und viel Spaß bei den Nutten!“ rief ich hinterher.
Aber sie waren schon zu beschäftigt, sie hörten es nicht mehr.
Gegen Abend kamen sie alle zurück, freudestahlend, glücklich, man konnte es förmlich von den Gesichtern ablesen.
„Mann, da hast Du heute was verpasst“, sagte Heinz.
„Ich, wieso?“
„Das war toll, frisch gebadet, gut gegessen und ein tolles Mädchen, einmalig!“
„Oh, mir geht es auch ganz gut“, sagte ich und lächelte dabei verstohlen.
„Was hast Du getrieben in der langen Zeit?“ wollte er wissen.
„Ich, ach nichts, es war sehr schön, so alleine. Ich habe viel gedöst, mich mit einem hübschen Mädchen unterhalten, es war sehr nett.
„Wie, mit einem italienischen Mädchen?“
„Ja, natürlich!“
„Sie kam an den Wagen und wollte wissen, ob ich tatsächlich ein Fallschirmjäger sei, weil wir einen fallenden Kometen auf unserem Wagen haben.“
„Ach, unser Divisionszeichen, das hat sie gekannt?“
„Ja, sie hat einen Bruder bei der italienischen Fallschirmtruppe, bei der Einheit „Nembo“. Und diese Einheit lag bei Nettuno neben uns. Sie hatte ein Bild dabei, aber leider kannte ich ihn nicht.“
„War das alles?“
„Natürlich nicht, wir haben uns noch lange unterhalten und dann kam sie zu mir in den Wagen.“
„Da seht mal diesen grünen Jungen, amüsiert sich mit einer hübschen Italienerin, während wir dafür zahlen müssen.“
„Hoffentlich ist Dir nichts passiert, sonst sitzt Du nächste Woche im Bau wegen Wehrkraftzersetzung.“
„Komm, hör auf, Du willst mir nur Angst machen, wird schon gut gehen.“
„Du wirst schon sehen, in drei Tagen hast Du einen Tripper am Arsch. Der Alte sperrt Dich sofort ein.“
Plötzlich hatte ich mehr Angst als vorne im Schützengraben. Mir wurde anders bei den Worten des Fahrers; aber der hatte natürlich Erfahrung und nicht ganz Unrecht.
Endlich waren wir glücklich an der Front gelandet mit allen drei Fahrzeugen. „Ihr müsst die Munition sofort an die Brücke bringen, die Trupps warten schon auf Euch“, kam es kurz von der Ordonanz.
Na, dann man los, zum Himmelfahrtskommando.
Vorsichtig fuhren wir mit den drei Wagen in das Frontgebiet.
Ohne Licht, jeden Granateinschlag ausweichend, fast lautlos. Wir mussten höllisch aufpassen, drei Einschläge fielen links von uns in den Hang.
Die Minuten wurden zu Stunden, hundert Meter zum Kilometer, immer weiter, wie lange noch?
„Wo sind die nur? Keine Sau zu sehen!“
„Weiter, Heinz, immer der Straße nach, pass auf, ein Schlagloch!
Schon wieder ein gewaltiges Loch.“
Wir mussten doch schon vorne in der Hauptkampflinie sein. Oder waren wir schon beim Ami?
Wie tot lag die Straße da, sie wand sich in engen Kurven um den Berg. Im fahlen Mondlicht konnte man das Tal erkennen, das in meinen Erinnerungen eine Augenweide war, aber heute?
Ein Totengrab tat sich vor uns auf, still und verschwiegen, nur von den amerikanischen Granaten unterbrochen, die neben uns und hinter uns einschlugen.
„Ein Volltreffer, und wir brauchen keine Holzkreuze mehr“, sagte ich ganz leise, als wollte ich nicht, dass es die da drüben hörten.
Endlich eine kleine Brücke, ich stieg aus, kein Mensch weit und breit, verdammter Mist! Wo muss das Zeug denn hin?
„Heinz, wir müssen weiter, hier ist niemand!“
„Das kann nicht sein, es muss hier sein!“
„Nein“, bestimmt nicht!“
Die anderen Wagen hatten den Befehl, im Abstand von 500 Metern zu fahren. Auch sie waren unsicher, rufen war nicht möglich, also weiter.
„Wir sind bestimmt schon beim Ami“, sagte Heinz. „Nee, wir sind bald in Florenz“, gab ich zurück.
„Spare Dir Deine Witze, pass lieber auf die Straße auf. Hier sind schon viele runter gefallen und nicht mehr rauf gekommen.“
Endlich ein Mensch, mitten auf der Straße. Er trug Fallschirmjägermontur mit dem bekannten kurzen Stahlhelm.
„Halt Jungs, Ihr kommt gerade recht, drei Tonnen werden hier abgeladen, der Rest kommt weiter nach vorne, etwa bis zur nächsten Biegung da unten am Hang.“
Wir fuhren bis unten an den Knick der Straße, der zweite Wagen folgte uns und der dritte wurde oben abgeladen.
„Was habt Ihr vor?“ fragte ich einen der Kumpels.
„Das Zeug fliegt morgen in die Luft, dann kann der Ami zusehen, wie er weiter kommt.“
„Bei dieser Ladung geht doch der ganze Hang mit.“
„Noch besser, dann dauert es länger, bis er repariert ist.“
Immer mehr Landser kamen zum Vorschein, wie Gespenster tauchten sie aus der dunklen Nacht auf. Alle fassten mit an, Kiste um Kiste zu entladen. Heinz und ich hatten großes Interesse daran schnell wegzukommen und schufteten schwer.
„Du, Heinz, wenn die da droben einen Volltreffer bekommen, kannst Du den Wagen gleich anzünden, dann ist es aus mit uns, wir sitzen in der Falle.“
„Denk nicht daran, nur schnell abladen und dann nichts wie weg von hier, verdammt eisenhaltige Luft in dieser Ecke.“
Zum Glück orgelten die Salven der Geschütze immer über uns hinweg. Endlich war es soweit, alles war abgeladen. Nun mussten wir nur noch einen Platz zum Wenden finden. Hier ging es nicht, wir mussten bis oben zurückstoßen. Langsam, Meter um Meter stieß Heinz den Wagen in der Gefahrenzone zurück.
„Helft uns schnell abladen“, riefen die anderen uns zu, „Ihr könnt hier nicht vorbei.“
Also nochmals das gleiche: „Ein bisschen dalli, meine Herren, es eilt.“
Die Stimme kam mir bekannt vor. War das nicht Unteroffizier Müller, den ich mal als Zugführer bei Abano hatte, nachdem Leutnant Schulz verwundet worden war?
Er war es, aber die Zeit war knapp und für eine Wiedersehensfeier hatten wir nicht den richtigen Ort gewählt.
„Macht, dass Ihr wegkommt, wenn die da drüben etwas merken, kracht es und der ganze Haufen Munition fliegt in die Luft. Nicht auszudenken, was dann hier los ist.“
Schon waren auch die letzten Kisten abgeladen. Wir hatten unseren Auftrag erfüllt. Es galt nur noch, heil zurückzukommen, die Wagen waren so wertvoll wie wir selbst. Je weiter wir ins Hinterland fuhren, um so stärker war der Artilleriebeschuss in der Nähe der Fahrzeuge. Es war wie ein Spießrutenlaufen, links Einschlag, rechts Einschlag, weiter, immer weiter, nur nicht anhalten. -
Endlich geschafft. „Befehl ausgeführt, 12 Tonnen Sprengmunition ins Frontgebiet gefahren zum Sprengen der Brücken.“
Der Chef war kurz wie immer: „Danke, abtreten.“
Fast sechs Jahre dauerte dieser Krieg nun schon, wir hassten ihn alle, jeder wartete mit Sehnsucht auf sein Ende.
Aber wir waren schon glücklich, überhaupt noch am Leben zu sein. Immer wieder, wenn wir die Berichte im Radio hörten, fragten wir uns, welchen Sinn dieser Krieg noch habe. Nein, unser Einsatz in Italien war sicher kein Vergnügen und dennoch wollten wir nicht mit unseren Kameraden in den endlosen Weiten Russlands tauschen, vermochten wir uns Stalingrad kaum vorzustellen: Hunger, eisige Kälte, Schnee über Schnee, von der Zivilisation kaum berührte Landstriche und ein unerbittlicher Feind.
Der Kampf um den Berg und die Stadt Cassino war einer der härtesten Kämpfe dieses Krieges. Sicher nicht mit Stalingrad zu vergleichen, aber er stand ihm an Härte nicht viel nach.
Und doch, selbst unter den erbittertsten Kämpfen, bewahrte sich dieses Land seine immer gerühmte Schönheit, von den größten Dichtern aller Zeiten besungen.
Noch als Landser, mitten im Krieg und Kampf, konnten wir unsere Augen kaum davor verschließen.Vielleicht der einzige Wert dieser sonst so unerfüllten Zeit der verlorenen Jahre. Nicht ganz, zumindest nicht für alle, verloren. Alles ist Hoffnung unerschöpflicher Möglichkeiten. Wenigstens uns Jungen hat dieser Krieg für unser ganzes Leben geprägt, hat uns mehr über den Menschen in seinen Schwächen und Stärken, im Guten, wie im schier Unfassbaren, Unverständlichen gelehrt, als es die größten Weisen vermochten.
Wenn nur diese verflixten Partisanen nicht gewesen wären. Sie machten den Krieg erst recht zur Hölle. Durch ihren Einsatz hinter der Front wurden zu viele Truppenteile gebunden, die dadurch nicht an der Front eingesetzt werden konnten. Ein schwerwiegender Nachteil für die kämpfende Truppe, aber auch gleichzeitig für die in Ruhestellung liegenden Teile, da sie nur all zu oft zum Einsatz gegen die nächtlichen Überfälle der Partisanen herangezogen wurden. Hier zeigten sich die größten Enttäuschungen. In den meisten Fällen war der Feind nicht auszumachen, kam es kaum zu einer Berührung und wir mussten wieder unverrichteter Dinge umkehren, in dem Bewusstsein, aus allen Ecken und Winkeln ständig von den Augen des Feindes beobachtet zu werden.
Ein paar Tage später wurde ich mit einigen Kameraden noch weiter zurückverlegt. Tagsüber sollten wir neu angekommene Soldaten zum Fronteinsatz ausbilden und nachts einen Fährbetrieb über den Po betreiben. Die Neuen, die aus der Heimat, Frankreich oder Dänemark kamen, waren überwiegend von der Luftwaffe und ihren Nebeneinheiten, wie der Flak und den Nachrichtenabteilungen.
Wir lagen zwischen Borgoforte und Mantua. Als Ausbildungs-Programm bauten wir Fähren bis zu zehn Tonnen Nutzlast. Schon wegen der starken Fliegerangriffe konnten wir den Fährbetrieb über den Po tagsüber nicht aufrechterhalten. So waren wir Tag und Nacht in Bereitschaft und der Erholungsprozess durch diese beiden Tätigkeiten laufend unterbrochen.
Dennoch nutzte ich die wenige freie Zeit während meiner Ausbildertätigkeit am Po und lernte die ersten Brocken italienisch. Ich hatte irgendwie Glück und bekam immer sehr schnell guten Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung. Die einfachen Bauern waren immer sehr nett und hilfsbereit. Auch die Wirtsleute waren immer zu einem freundlichen Wort aufgelegt.
Obwohl die Italiener unsere Verbündeten waren, musste ich mit umso mehr Schwierigkeiten bei unseren Vorgesetzten rechnen, je besser ich mich mit der einheimischen Bevölkerung verstand. Schließlich lernte ich die Sprache auch besonders durch die Kinder, die uns beim Bau der Fähren oder während des Dienstes zusahen. Ich erinnerte mich an meine eigene Kindheit, wenn Soldaten auf einem Platz in unserer nächsten Umgebung waren. Dann konnte wir nicht schnell genug zu ihnen kommen. Uns interessierte alles, was da geschah. Egal, ob es ein Auto war, das wir bewunderten, ein Motorrad oder eine Feldküche. Die Soldaten waren für uns Jungen einfach eine Sensation. Nicht anders erging es auch den kleinen Italienern, die uns gespannt zusahen und keinen Augenblick aus den Augen ließen. Dabei mussten wir noch höllisch aufpassen, dass die Jungen nicht mit unseren Waffen in Berührung kamen, die natürlich scharf geladen waren und sie gerade am meisten interessierten.
Manchmal konnte ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass diese Kinder direkt dazu beauftragt waren, uns zu beobachten, um die Partisanen über unsere gesamten Vorhaben zu unterrichten. Wer eignete sich besser und unverdächtiger dazu, uns zu bespitzeln, als gerade Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren?
Wenn es überhaupt so war, eine Vermutung, die sich nie nachweisen ließ, dann handelte es sich nur um einige wenige Jungen, die dafür ausgesucht waren.
Der kleine Mario, der für uns immer die Brötchen und den Wein holte, war sicher kein heimlicher Beobachter. Er war mein kleiner Freund geworden.
Mario war ein typischer kleiner Italiener. Sehr aufgeweckt und kess, aber auch sehr anhänglich und zutraulich. Er war der Flinkste der Jungen, die da immer um uns herum waren und uns verfolgten wie die Läuse an der Front. Immer war er zur Stelle, hatte immer etwas einzukaufen und wollte immer alles wissen.
Am liebsten hätte er auch gerne mal mit einer Pistole oder der Maschinenpistole geschossen. Der brennende Wunsch ließ sich nur zu deutlich von seinen Augen ablesen, wenn er die Waffen betrachtete.
Wir gingen an den Ufern des Flusses auf die Jagd.
„Ich weiß, wo Wiesel sind“, rief Mario und hatte seine helle Freude.
Tatsächlich zeigte er mir am Deich einen Bau. Noch bevor wir ihn ganz erreichten, stürzte das aufgeschreckte Tier auch schon heraus, dass ich um Sekunden zu spät kam und mit einer 9 mm Baretta-Pistole daneben schoss.
Das Wiesel war zu schnell und sah immer wieder an einer anderen Stelle hinter den herumliegenden Steinen hervor, so dass ich nicht zum Schuss kam.
Schließlich verfolgten Mario und die anderen Jungen es und waren dabei so aktiv und voller Begeisterung, dass es für mich unmöglich war zu schießen, ohne Gefahr zu laufen, einen der Jungen zu treffen.
„Bleibt doch stehn“, rief ich den Jungen zu. „So können wir es nie erwischen.“
Aber die Jungen hörten mich überhaupt nicht. Das Wiesel entkam.
„Das macht Spaß!“ strahlte Mario. „Suchen wir weiter. Wir finden bestimmt noch was.“
„Heute nicht mehr“, sagte ich. „Dafür ist es heute schon zu spät.“
„Schade, das war so schön“, machte Mario seiner Enttäuschung Luft.
Nach und nach machten sich die Jungen auf den Heimweg, obwohl ihnen deutlich anzusehen war, dass sie nun erst recht keine Lust hatten, nach Hause zu gehen. Aber die Sonne stand schon tief am Himmel und für uns war an diesem Tag der Dienst auch schon lange zu Ende.