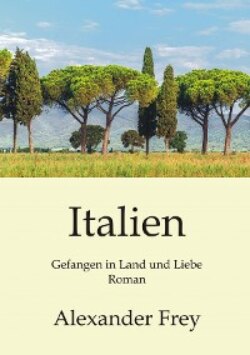Читать книгу Italien - Gefangen in Land und Liebe - Alexander Frey - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLaute Hilfeschreie in italienisch rissen mich aus dem Halbschlaf. Ich war sofort hellwach und spähte über den vor uns strömenden Fluss.
Es war morgens gegen 4.00 Uhr. Zwischen Dämmerung und Morgen waren nur schemenhafte Umrisse zu erkennen. Es war sehr kühl und feucht. Vom Flussufer stiegen leichte Dunstschwaden auf. Die Hilferufe kamen vom Fluss. Als sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, erkannte ich eine Frau, die im Wasser auf einem Brett trieb. Das Brett war groß genug um sie zu halten, vor ihrem Kopf hielt sie einen Koffer, in dem wohl all ihre Habseligkeiten waren.
Weder ich, noch meine Kameraden, die inzwischen auch wach geworden waren, konnten der Frau helfen. Die reißenden Fluten des Stromes zogen sie so schnell an uns vorbei, dass es unmöglich gewesen wäre, sie zu erreichen. Selbst wenn wir ein Boot gehabt hätten, wäre es uns nicht gelungen, es so schnell klar zu bekommen. Und einen so guten Schwimmer, selbst wenn er es unter Einsatz seines Lebens versucht hätte, gab es wohl auf der ganzen Welt nicht.
Wir mussten hilflos mitansehen, wie sie weiter stromabwärts getrieben wurde und allmählich unseren Blicken entschwand. Vielleicht war es eine Dame, die mit einem deutschen Offizier reiste und nun allein gelassen worden war oder ihren Geliebten bereits in den kalten Wellen des Po verloren hatte. Was spielte das jetzt für eine Rolle?
Ich hatte in den letzten Jahren viele Kameraden sterben sehen, aber das war etwas anderes. Wenn auch niemand an den Tod dachte, so mussten wir doch immer damit rechnen. Und trotz allem, noch im stärksten Feuergefecht, suchte man immer noch nach einer Möglichkeit um zu helfen. Aus den gefährlichsten Situationen sind unzählig viele gerettet worden.
Hier aber tatenlos zusehen zu müssen, sich seiner eigenen Ohnmacht nur zu bewusst, wie ein Menschenleben verloren ging, machte uns die ganze Sinnlosigkeit dieses Treibens um so deutlicher.
Jeder wollte überleben. Jetzt erst recht. Diese klagenden Hilferufe hatten uns zu neuem Lebensmut angefacht. Alles in uns begann sich zu regen. Unser Geist arbeitete fieberhaft. Es war uns nur zu klar, in welcher Gefahr wir uns befanden. Wollten wir nicht jeden Moment von dem uns verfolgenden Feind überrollt werden, galt es, so schnell wie möglich den Fluss zu überqueren. Das war unsere einzige Chance.
Unsere Hirnzellen arbeiteten wieder wie in alten Tagen, trotz enormer Anstrengungen und Qualen, denen wir in den letzten Tagen ausgesetzt gewesen waren.
Wir rissen unsere Kleider vom Leibe, rieben uns mit Motoröl ein und versuchten, den Fluss zu durchschwimmen.
Die Maschinenpistolen und die Uniformen steckten wir in ein Fass, umwickelten dieses mit Telefonkabel, verbanden es mit unseren Koppeln und wollten so, mit drei Mann an einem Fass festgebunden, versuchen hinüber zu schwimmen.
Das war leicht gesagt. Die starke Strömung riss uns sofort mit dem schweren Fass zur Seite und drohte uns alle zu ertränken. Es konnte jeden Moment umschlagen und sich voll Wasser füllen. Wie ein Klotz wäre es dann untergegangen und hätte uns mit sich in die Tiefe gerissen. Ob wir noch dazu gekommen wären, rechtzeitig unsere Koppel zu öffnen, war nur zu zweifelhaft.
Es blieb uns keine Wahl. Wir mussten wieder zurück an Land. Schnell wurden die Kleider wieder angezogen, um unsere unterkühlten Körper zu wärmen. Nun kam zu der bisherigen Angst auch noch die Unterkühlung hinzu. Wir mussten jetzt schnell handeln. In der Ferne hörten wir schon die mahlenden Geräusche der Panzerfahrzeuge, die am Abend bis auf wenige hundert Meter an uns herangekommen waren. Die sind dann aber doch noch zum Stillstand gekommen, bevor sie uns erreichen und vernichten konnten.
Was sollten wir tun? In amerikanische Gefangenschaft gehen? Ohne Waffen und Uniform über den Po schwimmen? Auf ein Wunder warten?
Die Brücken waren von den Alliierten zerstört. Die Motorboote zum Teil versenkt oder lagen am nördlichen Ufer und waren für uns uns nicht zu erreichen.
Die ganze Nacht hatten wir am Südufer verbracht in der einzigen Hoffnung, dem Amerikaner doch noch zu entkommen.
Eine der furchtbarsten Nächte meines Lebens, wie wir vor uns hin dösten, uns vor Hunger krümmten und vor Kälte zitterten. Hinter uns krachten unendliche Mengen explodierender Munition in die Luft, weil die meisten Landser ihre Lastwagen in Brand gesteckt hatten, damit sie nicht in Feindes Hand gelangten. Es war ein gespenstischer Anblick, den ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde. Soweit das Auge reichte: Militärwagen, Flakgeschütze und Panzerfahrzeuge.
Alles brannte und flog detonierend in die Luft. Was sollten jetzt noch Gedanken? Alle weiteren Fragen und Überlegungen nahmen uns die ersten Jagdbomber ab, die bereits ihre Runden über uns drehten.
Es gab nur noch eins: Rüber! Wir mussten auf die andere Seite. Keiner von uns wollte in einem Gefangenen-Camp landen. Aber selbst um uns darüber Gedanken zu machen, hatten wir jetzt keine Zeit.
Ein am Ufer treibendes Schlauchboot der deutschen Wehrmacht löste für den Moment unsere brennendsten Probleme.
War es wirklich ein Wunder oder ein ganz gewöhnlicher Zufall? Fritz, der seine Augen überall zu haben schien, hatte es als erster entdeckt.
„Jungs, da, das ist die Rettung“, rief er uns zu und wies auf das Boot.
Die Freude war unbeschreiblich.
Sofort stürzte sich ein guter Schwimmer in die eiskalten Fluten und riskierte für uns sein Leben. Nur mit äußerster Anstrengung erreichte er das Boot. Ein zweiter folgte und mit vereinten Kräften zogen sie das kostbare Stück an Land.
„Jungs, Ihr seid großartig“, empfing sie Fritz.
„Schon gut, dafür darfst Du bei der nächsten Gelegenheit eine Runde schmeißen“, bekam er zur Antwort.
„Geht in Ordnung!“
Es handelte sich um ein größeres Schlauchboot, in dem gut sechs Mann Platz hatten. Unser Optimismus bekam aber schnell wieder einen Dämpfer. Eine Kammer des Bootes war nicht mehr ganz dicht und nicht ausreichend mit Luft gefüllt, außerdem fehlten die Ruder. Zum Glück fanden wir an den brennenden Fahrzeugen einige Spaten, diese benutzten wir als Paddel.
„Los, das kriegen wir schon hin“, rief ich meinen Kameraden zu. Wir machten so gut es ging das Boot wieder flott. Jeder versuchte sich nützlich zu machen, wo er nur konnte.
„Jungs, Ihr müsst gegen den Strom rudern, sonst kommen wir nie rüber“, spornte ich die Kumpels an. „Immer schräg zum Strom, wegen der Drift.“
Unter meiner Anleitung besetzten wir das Boot und versuchten vorsichtig, mit gemeinsamen Schlägen, das andere Ufer zu erreichen.
Da die meisten Kameraden, die im Boot saßen, nicht im Schlauchbootfahren ausgebildet waren, drehten wir uns zunächst einige Male im Kreis. Schließlich, mit viel Geduld und kräftigen Kommandos von mir und Brandner, kamen wir dann doch gut auf der anderen Seite an.
Diese erste Überfahrt verlief sogar besser als erwartet.
Aber wir mussten wieder zurück. Auf der anderen Seite warteten die Kameraden. Paul Brandner erklärte sich bereit, nochmal mit mir nach drüben zu rudern.
Auch diese Fahrt verlief recht gut. Obwohl die Luft schon in größeren Mengen entwichen war, kamen wir ohne Schaden und besondere Schwierigkeiten hin und zurück.
Aber wir wollten alles oder nichts.
Also ging die Fahrt nochmals an das südliche Ufer. Dort warteten noch immer einige Landser.
Inzwischen war es schon so hell, dass wir befürchten mussten, von den Jagdbombern entdeckt und angegriffen zu werden. Die Überquerungen wurden immer schwieriger. Bei den letzten beiden Überfahrten hockten oder saßen wir schon zum Teil bis zu den Knöcheln im Wasser. Doch wen störte das? Die Hauptsache war, gerettet zu sein.
Verliefen die ersten Überfahrten auch relativ schweigsam, so waren wir während der letzten, in dem Bewusstsein, auch den letzten Mann gerettet zu haben, um so ausgelassener und beredter.
Es wurden schon wieder die ersten Witze gemacht und von einer besseren Zukunft geträumt.
Das Resultat unserer Übersetzung: 14 Soldaten und drei schöne Fahrräder, die wir drüben am Fluss gefunden hatten.
Glücklich darüber, dass wir alle das Nordufer erreicht hatten, stürzten wir uns sofort in das nächste Haus, nur wenige Meter vom Fluss entfernt.
An einem offenem Kamin trockneten wir die nassen Sachen und nahmen ein wenig Milch und Weißbrot zu uns, das uns von den verschüchterten italienischen Frauen angeboten wurde.