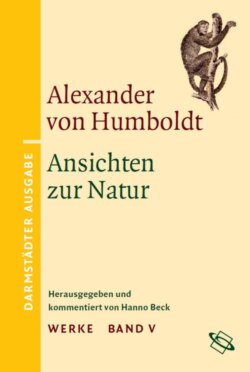Читать книгу Werke - Alexander Humboldt - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erläuterungen und Zusätze
Оглавление1 (S. 3) Der See Tacarigua.
Wenn man durch das Innere von Südamerika, von der Küste von Caracas oder Venezuela bis gegen die brasilianische Grenze, vom 10. Grade nördlicher Breite bis zum Äquator vordringt, so durchstreicht man zuerst eine hohe Gebirgskette (die Küstenkette von Caracas), die von Westen gegen Osten gerichtet ist; dann die großen baumleeren Steppen oder Ebenen (los Llanos), welche sich vom Fuße der Küstenkette bis an das linke Ufer des Orinoco ausdehnen; endlich die Bergreihe, welche die Katarakte von Atures und Maipures veranlaßt. Zwischen den Quellen des Rio Branco und Rio Essequibo läuft nämlich diese Bergreihe, welche ich Sierra Parime nenne, von den Katarakten östlich gegen das holländische und französische Guyana fort. Sie ist der Sitz der wunderbaren Mythen des Dorado und ein in viele Jöcher rostförmig geteiltes Massengebirge. An sie grenzt südwärts die waldreiche Ebene, in welcher der Rio Negro und Amazonenstrom sich ihr Bette gebildet haben. Wer von diesen geographischen Verhältnissen näher unterrichtet sein will, vergleiche die große Karte von la Cruz-Olmeçilla (1775), aus der fast alle neueren Karten von Südamerika entstanden sind, mit der Karte von Columbia, welche, nach meinen eigenen astronomischen Ortsbestimmungen entworfen, ich im Jahr 1825 herausgegeben.
Die Küstenkette von Venezuela ist geographisch betrachtet ein Teil der peruanischen Andenkette selbst. Diese teilt sich in dem großen Gebirgsknoten der Magdalena-Quellen (Breite 1° 55′ bis 2° 20′) südlich von Popayan in drei Ketten, deren östlichste in die Schneeberge von Merida ausläuft. Diese Schneeberge senken sich gegen den Paramo de las Rosas in das hügelige Land von Quibor und El Tocuyo, welches die Küstenkette von Venezuela mit den Kordilleren von Cundinamarca verbindet. Die Küstenkette läuft mauerartig ununterbrochen von Portocabello bis zum Vorgebirge Paria hin. Ihre mittlere Höhe ist kaum 750 Toisen. Doch erheben sich einzelne Gipfel, wie die mit Befarien (den rotblühenden amerikanischen Alpenrosen) geschmückte Silla de Caracas (auch Cerro de Avila genannt) bis 1350 Toisen [2638m] über dem Meeresspiegel. Das Ufer der Terra firma trägt Spuren der Verwüstung. Überall erkennt man die Wirkung der großen Strömung, welche von Osten gegen Westen gerichtet ist und welche, nach Zerstückelung der Karibischen Inseln, den Antillen-Meerbusen ausgefurcht hat. Die Erdzungen von Araya und Chuparipari, besonders die Küste von Cumana und Neu-Barcelona, bietet dem Geologen einen merkwürdigen Anblick dar. Die Klippen-Inseln Boracha, Caracas und Chimanas ragen turmähnlich aus dem Meer hervor und bezeugen den furchtbaren Andrang der einbrechenden Fluten gegen die zertrümmerte Gebirgskette. Vielleicht war das Antillen-Meer, wie das mittelländische, einst ein Binnenwasser, das plötzlich mit dem Ozean in Verbindung trat. Die Inseln Kuba, Haiti und Jamaica enthalten noch die Reste des hohen Glimmerschiefergebirges, welches diesen See nördlich begrenzte. Es ist auffallend, daß gerade da, wo diese drei Inseln sich einander am meisten nähern, auch die höchsten Gipfel emporsteigen. Man möchte vermuten, der Hauptgebirgsstock dieser Antillen-Kette habe zwischen Kap Tiburon und Morant Point gelegen. Die Kupferberge (Montañas de Cobre) bei Santiago de Kuba sind noch ungemessen, aber wahrscheinlich höher als die Blauen Berge von Jamaica (1138 Toisen) [2257m], welche etwas die Höhe des Gotthard-Passes übertreffen. Meine Vermutungen über die Talformen des Atlantischen Ozeans und über den alten Zusammenhang der KontinenteXVIII habe ich schon in einem in Cumana geschriebenen Aufsatze: ›Fragment d’un Tableau géologique de l’Amérique méridionale‹, genauer entwickelt (Journal de Physique, Messidor an IX). Merkwürdig ist es, daß Christoph Kolumbus selbst in einem seiner offiziellen Berichte auf den Zusammenhang zwischen der Richtung des Äquinoctial-Stromes und der Küstengestaltung der Großen Antillen aufmerksam macht (Examen critique de l’hist. de la Géographie, T. III, p. 104–108).
Der nördliche und kultiviertere Teil der Provinz Caracas ist ein Gebirgsland. Die Uferkette ist wie die der Schweizer Alpen in mehrere Joche oder Bergreihen geteilt, welche Längentäler einschließen. Unter diesen ist am berühmtesten das anmutige Tal von Aragua, welches eine große Menge Indigo, Zucker, Baumwolle und, was am auffallendsten ist, selbst europäischen Weizen hervorbringt. Den südlichen Rand dieses Tals begrenzt der schöne See von Valencia, dessen alt-indischer Name Tacarigua ist. Der Kontrast seiner gegenüberstehenden Ufer gibt ihm eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Genfer See. Zwar haben die öden Gebirge von Guigue und Guiripa einen minder ernsten und großartigen Charakter als die Savoyischen Alpen; dagegen übertreffen aber auch die mit Pisang-Gebüschen, Mimosen und Triplaris dicht bewachsenen Ufer des Tacarigua alle Weingärten des Waadtlandes an malerischer Schönheit. Der See hat eine Länge von etwa 10 Seemeilen (deren 20 auf einen Grad des Äquators gehen); er ist voll kleiner Inseln, welche, da die Verdampfung des Wasserbehälters stärker als der Zufluß ist, an Größe zunehmen. Seit einigen Jahren sind sogar Sandbänke als wahre Inseln hervorgetreten. Man gibt ihnen den bedeutsamen Namen der neu erschienenen, Las Aparecidas. Auf der Insel Cura wird die merkwürdige Art Solanum gebaut, deren Früchte eßbar sind und die Willdenow im Hortus Berolinensis (1816, Tab. XXVII) beschrieben hat. Die Höhe des Sees Tacarigua über dem Meer ist fast 1400 Fuß (genau nach meinen Messungen 230 Toisen) geringer als die mittlere Höhe des Tals von Caracas. Der See nährt eigene Fischarten, (s. meine Observations de Zoologie et d’Anatomie comparée, T. II, p. 179–181), und gehört zu den schönsten und freundlichsten Naturszenen, die ich auf dem ganzen Erdboden kenne. Beim Baden wurden wir, Bonpland und ich, oft durch den Anblick der Bava geschreckt: einer unbeschriebenen, etwa 3 bis 4 Fuß langen krokodilartigen Eidechse (Dragonne?) von scheußlichem Ansehen, aber dem Menschen unschädlich. In dem See von Valencia fanden wir Typha (Rohrkolben), die mit der europäischen Typha angustifolia ganz identisch ist: ein sonderbares, für die Pflanzen-Geographie wichtiges Faktum!
Um den See in den Tälern von Aragua werden beide Varietäten des Zuckerrohrs, das gemeine, Caña criolla, und das neu eingeführte der Südsee, Caña de Otaheiti [= Tahiti] kultiviert. Letzteres hat ein weit lichteres, angenehmeres Grün, so daß man schon in großer Entfernung ein Feld tahitischen Zuckerschilfes von dem gemeinen unterscheidet. Cook und Georg Forster haben das Zuckerrohr von Otaheiti zuerst beschrieben, aber, wie man aus Forsters trefflicher Abhandlung von den eßbaren Pflanzen der Südsee-Inseln ersieht, den Wert dieses kostbaren Produkts wenig gekannt. Bougainville brachte es nach Ile de France, von wo aus es nach Cayenne, und seit 1792 nach Martinique, Santo Domingo oder Haiti, und nach mehreren der Kleinen Antillen kam. Der kühne, aber unglückliche Kapitän Bligh verpflanzte es mit dem Brotfruchtbaum nach Jamaica. Von Trinidad, einer dem Kontinent nahen Insel, ging das Zuckerrohr der Südsee nach der nahegelegenen Küste von Caracas über. Es ist für diese Gegenden wichtiger als der Brotfruchtbaum geworden, der ein so wohltätiges, an Nahrungsstoff reiches Gewächs, wie der Pisang ist, wohl nie verdrängen wird. Das Zuckerrohr von Otaheiti ist dazu viel saftreicher als das gewöhnliche, dem man einen ostasiatischen Ursprung zuschreibt. Es gibt auf gleichem Flächenraum ein Dritteil Zucker mehr als die Caña criolla, deren Rohr dünner und enger gegliedert ist. Da überdies die Westindischen Inseln großen Mangel an Brennmaterial zu leiden anfangen (auf der Insel Kuba werden die Zuckerpfannen mit Orangenholz geheizt), so ist das neue Zuckerrohr um so wichtiger, als es ein dickeres, holzreicheres Rohr (bagaso) liefert. Wäre nicht die Einführung dieses neuen Produkts fast gleichzeitig mit dem Anfang des blutigen Negerkrieges in St. Domingo gewesen, so würden die Zuckerpreise in Europa damals noch höher gestiegen sein, als sie ohnedies schon die verderbliche Störung des Landbaues und des Handels hatte steigen lassen. Eine wichtige Frage ist, ob das Zuckerrohr von Otaheiti, seinem vaterländischen Boden entrissen, allmählich ausarten und in gemeines Zuckerrohr übergehen wird. Die bisherigen Erfahrungen haben gegen die Ausartung entschieden. Auf der Insel Kuba bringt eine Caballeria, d. i. ein Flächenraum von 34.969 Quadrattoisen, 870 Zentner Zucker hervor, wenn die Caballeria mit otaheitischem Zuckerrohr bepflanzt ist. Sonderbar genug, daß dieses wichtige Erzeugnis der Südsee-Inseln gerade in demjenigen Teil der spanischen Kolonien gebaut wird, welcher von der Südsee am entferntesten ist! Man schifft von den peruanischen Küsten in 25 Tagen nach Otaheiti, und doch kannte man zur Zeit meiner Reise in Peru und Chile noch nicht das otaheitische Zuckerrohr. Die Einwohner der Osterinsel, welche großen Mangel an süßem Wasser leiden, trinken Zuckerrohr-Saft und (was physiologisch sehr merkwürdig ist) auch Seewasser. Auf den Sozietäts[Gesellschafts]-, Freundschafts- und Sandwich[= Hawaii]-Inseln wird das hellgrüne und dickrohrige Zuckerschilf überall kultiviert.
Außer der Caña de Otaheiti und der Caña criolla baut man in Westindien auch ein rötliches afrikanisches Zuckerrohr an. Man nennt es Caña de Guinea. Es ist weniger saftreich als das gemeine asiatische. Doch hält man den Saft der afrikanischen Abänderung zu der Fabrikation des Zuckerbranntweins für besonders geeignet.
Mit dem lichten Grün des tahitischen Zuckerschilfes kontrastiert in der Provinz Caracas sehr schön der dunkle Schatten der Kakao-Pflanzungen. Wenige Bäume der Tropenwelt sind so dicklaubig als Theobroma Cacao. Dieses herrliche Gewächs liebt heiße und feuchte Täler. Große Fruchtbarkeit des Bodens und InsalubritätXIX der Luft sind in Südamerika wie in Südasien unzertrennlich miteinander verbunden. Ja man bemerkt, daß je nachdem die Kultur eines Landes zunimmt, je nachdem die Wälder vermindert, Boden und Klima trockner werden, auch die Kakao-Pflanzungen weniger gedeihen. So werden sie in der Provinz Caracas minder zahlreich, während sie sich in den östlichen Provinzen von Neu-Barcelona und Cumana, besonders in dem feuchten, waldigen Erdstrich zwischen Cariaco und dem Golfο triste, schnell vermehren.
2 (S. 3) Bänke nennen die Eingeborenen die Erscheinung.
Die Llanos von Caracas sind mit einer mächtigen, weit verbreiteten Formation von altem Konglomerat ausgefüllt. Wenn man aus den Tälern von Aragua über das südlichste Bergjoch der Küstenkette von Guigue und Villa de Cura gegen Parapara herabsteigt, so trifft man aufeinanderfolgend: Gneis und Glimmerschiefer; ein wahrscheinlich silurisches Übergangsgebirge von Tonschiefer und schwarzem Kalkstein; Serpentin und Grünstein in kugelig abgesonderten Stücken; endlich dicht an dem Rande der großen Ebene kleine Hügel von augithaltigem Mandelstein und Porphyrschiefer. Diese Hügel zwischen Parapara und Ortiz erschienen mir als vulkanische Ausbrüche an dem alten Meerufer der Llanos. Weiter nördlich stehen die grotesken, weitberufenen, höhlenreichen Klippen, Morros de San Juan genannt, welche eine Art Teufelsmauer bilden, von kristallinischem Korn, wie gehobener Dolomit. Sie sind daher mehr als Teile des Ufers denn als Inseln in dem alten Meerbusen zu betrachten. Ich nenne die Llanos einen Meerbusen: denn wenn man ihre geringe Erhabenheit über dem jetzigen Meeresspiegel, ihre dem ost-westlichen Rotations-Strome gleichsam geöffnete Form und die Niedrigkeit der östlichen Küste zwischen dem Ausfluß des Orinoco und des Essequibo betrachtet, so kann man wohl nicht zweifeln, daß das Meer einst dies ganze Bassin zwischen der Küstenkette und der Sierra de la Parime überschwemmte, und westlich bis an das Gebirge von Merida und Pamplona (wie durch die lombardischen Ebenen an die Cottischen und Penninischen Alpen) schlug. Auch ist die Neigung oder der Abfall der amerikanischen Llanos von Westen gegen Osten gerichtet. Ihre Höhe bei Calabozo, in 100 geographischen Meilen Entfernung vom Meer, beträgt indessen kaum 30 Toisen: also noch 15 weniger als die Höhe von Pavia, und 45 weniger als die von Mailand in der lombardischen Ebene, zwischen den schweizerisch-lepontinischen Alpen und den ligurischen Apenninen. Die Erdgestaltung erinnert hier an Claudians Ausdruck: „curvata tumore parvo planities“. Die Horizontalität (Söhligkeit) der Llanos ist so vollkommen, daß in vielen Teilen derselben in mehr als 30 Quadratmeilen kein Teil einen Fuß höher als der andere zu liegen scheint. Denkt man dazu die Abwesenheit alles Gesträuches, ja in der Mesa de Pavones selbst aller isolierten Palmenstämme, so kann man sich ein Bild entwerfen von dem sonderbaren Anblick, welchen diese meergleiche, öde Fläche gewährt. So weit das Auge reicht, ruht es fast auf keinem Gegenstand, der einige Zolle erhaben ist. Wäre hier nicht wegen des Zustandes der untern Luftschichten und des Spiels der Strahlenbrechung der Horizont stets unbestimmt begrenzt und wellenförmig zitternd, so könnte man mit dem Sextanten Sonnenhöhen über dem Saume der Ebene wie über dem Meerhorizont nehmen. Bei dieser großen Söhligkeit des alten Seebodens sind die Bänke um so auffallender. Es sind gebrochene Flözschichten, welche prallig ansteigen, 2 bis 3 Fuß höher als das umliegende Gestein, und sich in einer Länge von 10 bis 12 geographischen Meilen einförmig ausdehnen. Diese Bänke geben kleinen Steppenflüssen ihren Ursprung.
Auf der Rückreise vom Rio Negro, als wir die Llanos de Barcelona durchstrichen, fanden wir häufige Spuren von ErdfällenXX. Statt der hohen Bänke sahen wir hier einzelne Gips-Schichten 3 bis 4Toisen tiefer als das umliegende Gestein. Ja weiter westlich, nahe bei der Einmündung des Caura-Stroms in den Orinoco, versank im Jahr 1790 (bei einem Erdbeben) ein großer Strich dicken Waldes östlich von der Mission von S. Pedro de Alcantara. Es bildete sich dort in der Ebene ein See, der über 300 Toisen im Durchmesser hatte. Die hohen Bäume (Desmanthus, Hymenäen und Malpighien) blieben lange grün und belaubt unter dem Wasser.
3 (S. 3) Man glaubt den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen.
Die Aussicht auf die ferne Steppe ist um so auffallender, als man lange im Dickicht der Wälder an einen engen Gesichtskreis und mit diesem an den Anblick einer reichgeschmückten Natur gewöhnt ist. Unauslöschlich wird mir der Eindruck sein, den uns die Llanos gewährten, als wir sie auf der Rückkehr vom Oberen Orinoco, von einem Berge, der dem Ausfluß des Rio Apure gegenüber liegt, bei dem Hato del Capuchino, zuerst in weiter Ferne wiedersahen. Die Sonne war eben untergegangen. Die Steppe schien wie eine Halbkugel anzusteigen. Das Licht der aufgehenden Gestirne war gebrochen in der Schicht der unteren Luft. Weil die Ebene durch die Wirkung der scheitelrechten Sonnenstrahlen übermäßig erhitzt wird, so dauert das Spiel der strahlenden Wärme, des aufsteigenden Luftstroms und der unmittelbaren Berührung ungleich dichter Schichten der Atmosphäre die ganze Nacht über fort.
4 (S. 4) Nackte Felsrinde.
Ungeheure Landstrecken, in denen bloß nacktes Gestein plattenförmig zu Tage ansteht, geben den Wüsten Afrikas und Asiens einen eigenen Charakter. Im Schamo, der die Mongolei (die Bergkette Ulangom und Malakha-Oola) vom nordwestlichen China trennt, heißen diese Felsbänke Tsy. Auch in der Waldebene des Orinoco trifft man sie, von dem üppigsten Pflanzenwuchse umgeben (Relation hist., T. II, p. 279). Mitten in diesen ganz vegetationsleeren, kaum mit einigen Lichenen bedeckten, granitischen und syenitischen Steinplatten von einigen tausend Fuß Durchmesser finden sich kleine Inseln von Dammerde, mit niedrigen, immerblühenden Kräutern bedecktXXI. Sie geben diesen Stellen in der Waldung oder am Rande derselben das Ansehen kleiner Gärten. Die Mönche am Oberen Orinoco halten die ganz söhligen, nackten Steinebenen, wenn sie von großer Ausdehnung sind, sonderbarerweise für Fieber und andere Krankheiten erregend. Manche Missions-Dörfer sind wegen einer solchen, sehr weit verbreiteten Meinung verlassen und an andere Orte verlegt worden. Sollten die Steinplatten (laxas) bloß durch größere Wärmestahlung oder auch chemisch auf den Luftkreis wirken?
5 (S. 4) Llanos und Pampas von Südamerika und Grasfluren am Missouri.
Unsere physikalische und geognostische Ansicht des westlichen Gebirgslandes von Nordamerika ist durch die kühnen Reisen des Major Long, durch die trefflichen Arbeiten seines Begleiters, Edwin James, und am meisten durch die vielumfassenden Beobachtungen des Kapitän Frémont mannigfaltig berichtigt worden. Alle eingezogenen Nachrichten setzen nun in ein klares Licht, was ich in meinem Werke über Neu-Spanien von den nördlichen Gebirgsketten und Ebenen nur als Vermutungen entwickeln konnte. In der Naturbeschreibung wie in historischen Untersuchungen stehen die Tatsachen lange einzeln da, bis es gelingt, durch mühsames Nachforschen sie miteinander in Verbindung zu setzen.
Die Ostküste der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist von Südwest gegen Nordost gerichtet, wie jenseits des Äquators die brasilianische Küste vom La Plata-Strom an bis gegen Olinda hin. In beiden Ländern streichen in einer geringen Entfernung vom Litoral zwei Gebirgszüge mehr parallel untereinander, als sie es der westlich gelegenen Andenkette (den Kordilleren von Chile und Peru) oder den nord-mexikanischen Rocky MountainsXXII sind. Das Gebirgssystem der südlichen Erdhälfte, das brasilianische, bildet eine isolierte Gruppe, deren höchste Gipfel (Itacolumi und Itambe) sich nicht über 900Toisen erheben. Nur die östlichen, dem Meere näheren Bergjöcher sind regelmäßig von SSW nach NNO gerichtet; gegen Westen nimmt die Gruppe an Breite zu, indem ihre Höhe beträchtlich vermindert wird. Die Hügelketten der Parecis nähern sich den Flüssen Itenes oder Guaporé, wie die Berge von Aguapehi und San Fernando (südlich von Villabella) sich dem Hochgebirge der Anden von Cochabamba und Santa Cruz de la Sierra nahen.
Eine unmittelbare Verbindung der beiden Bergsysteme an der atlantischen und Südsee-Küste (der brasilianischen und peruanischen Kordilleren) findet nicht statt; die Niederung der Provinz Chiquitos, ein von Norden gegen Süden gerichtetes Längental, gleichmäßig geöffnet in die Ebenen des Amazonen- und Plata-Stroms, trennt das westliche Brasilien von den östlichen Alto Perú. Hier, wie in Polen und Rußland, bildet ein oft unbemerkbarer Erdrücken (slawisch Uwaly) die Wasserscheidungslinie zwischen dem Pilcomayo und Madeira, zwischen dem Aguapehi und Guaporé, zwischen dem Paraguay und dem Rio Tapajos. Die Schwelle (seuil) zieht sich von Chayanta und Pomabamba (Br. 19°–20°) gegen Südost hin, durchsetzt die Niederung der dem Geographen seit Vertreibung der Jesuiten fast wieder unbekannt gewordenen Provinz Chiquitos, und bildet in nordöstlicher Richtung, wo nur einzelne Berge sich erheben, die divortia aquarum [Wasserscheide] an den Quellen des Baures und bei Villabella (Br. 15°–17°).
Dieser für den Verkehr der Völker und ihre wachsende Kultur so wichtigen Wasserscheidungslinie entspricht in der nördlichen Hemisphäre von Südamerika eine zweite (Br. 2°–3°), welche das Flußgebiet des Orinoco von dem Flußgebiet des Rio Negro und Amazonasflusses trennt. Man möchte diese Erhebungen in den Ebenen, diese Schwellen (terrae tumores nach Frontin) gleichsam wie unentwickelte Bergsysteme betrachten, welche bestimmt waren, zwei isoliert scheinende Gruppen, die Sierra Parime und das brasilianische Hochland, an die Andenkette von Timana und Cochabamba anzuknüpfen. Solche bisher wenig beachtete Verhältnisse begründen die von mir aufgestellte Einteilung von Südamerika in drei Niederungen oder Flußgebiete: die des Orinoco (im unteren Laufe), des Amazonenstromes und des Rio de la Plata; Niederungen, von denen (wie bereits oben bemerkt) die äußersten Steppen oder Grasfluren sind, die mittlere aber, zwischen der Sierra Parima und der brasilianischen Berggruppe, als Waldebene (Hylaea) zu betrachten ist.
Will man mit gleich wenigen Zügen ein Naturbild von Nordamerika entwerfen, so hefte man erst den Blick auf das anfangs schmale, dann an Höhe und Breite zunehmende Bergjoch der Andenkette: in Panama, Veragua, Guatemala und Neu-Spanien [Mexiko], von Südost gegen Nordwesten gerichtet. Dieses Bergjoch, ein Sitz früherer Menschenkultur, setzt dem allgemeinen tropischen Meeresstrom wie der schnellern Handelsverbindung zwischen Europa, West-Afrika und dem östlichen Asien gleiche Hindernisse entgegen. Seit dem 17. Breitengrad, seit dem berufenen Isthmus von Tehuantepec wendet es sich ab von der Küste des Stillen Meeres, und wird, von Süden gegen Norden streichend, eine Kordillere des inneren Landes. In Nord-Mexiko bildet das Kranich-Gebirge (Sierra de las Grullas) einen Teil der Rocky Mountains. Hier entspringen westlich der Columbia-Fluß und der Rio Colorado von Kalifornien; östlich der Rio roxo de Natchitoches, der Canadian River, der Arkansas und der (seichte) Platte-Fluß, welchen unwissende Geographen neuerdings in einen silberverheißenden Plata-Strom umgewandelt haben. Zwischen den Quellen dieser Ströme erheben sich (Br. 37° 20′ bis 40° 13′) drei Schreckhörner von glimmerarmem und hornblendereichem Granit: die spanischen Pics, James oder Pikes Pic, und Big Horn oder Longs Pic genannt. (S. mein Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, 2ème éd., T. I, p. 82 und 109.) Ihre Höhe übertrifft alle Gipfel der nordmexikanischen Andenkette, welche überhaupt, von dem Parallel des 18. und 19. Grades, oder von der Gruppe des Orizaba (2717T.) [5700m] und Popocatepetl (2771T.) [5452m] an bis nach Santa Fé und Taos in Neu-Mexiko hin, nirgends in die ewige Schneegrenze reicht. James Pic (Br. 38° 48′) soll 1798 Toisen hoch sein; aber von dieser Höhe sind nur 1335 T. trigonometrisch gemessen, die übrigen 463 T. gründen sich bei Abwesenheit aller Barometer-Beobachtungen auf ungewisse Schätzungen der Flußgefälle. Da fast nie eine trigonometrische Messung am Meeresspiegel selbst unternommen werden kann, so sind die Bestimmungen unersteigbarer Höhen immer zum Teil trigonometrisch, zum Teil barometrisch. Die Schätzungen der Gefälle der Flüsse, ihrer Schnelligkeit und der Länge ihres Laufs sind so trügerisch, daß die Ebene am Fuß der Rocky Mountains zunächst den im Text genannten Berggipfeln vor der wichtigen Expedition des Kapitän Frémont bald 8000, bald nur 3000 Fuß hoch geschätzt worden ist (Longs Expedition, Vol. II, p. 36, 362, 382, App., p. XXXVII). Aus einem ähnlichen Mangel von barometrischen Messungen war so lange die wahre Höhe des Himalaya ungewiß geblieben; dagegen jetzt wissenschaftliche Kultur in Ostindien dergestalt zugenommen hat, daß, als Kapitän Gerard sich auf dem Tarhigang, nahe am Sutledj, nördlich von Shipke zu der Höhe von 18.210 Pariser Fuß erhob, er drei Barometer zerbrechen konnte und ihm doch noch vier ebenso genaue übrig blieben (Critical Researches on philology and geography, 1824, p. 144).
Im Nord-Nord-Westen von Spanish, James, Longs und Laramie Pics hat Frémont auf den Expeditionen, welche er auf Befehl der Regierung der Vereinigten Staaten in den Jahren 1842 bis 1844 gemacht, den höchsten Gipfel der ganzen Kette der Rocky Mountains aufgefunden und barometrisch gemessen. Dieser Schneegipfel gehört zu der Gruppe der Windfluß-Berge (Wind-River Mountains). Er führt auf der großen Karte, welche der Chef des topographischen Bureaus zu Washington, der Oberst Abert, herausgegeben, den Namen Fremonts Peak, und liegt unter 43° 10′ Br. und 112° 35′ Länge, also fast 5° ½ nördlicher als Spanish Peak. Seine Höhe ist nach einer unmittelbaren Messung 12.730 Pariser Fuß. Frémonts Peak ist demnach 324 Toisen höher als nach Longs Angabe James Peak, welcher seiner Position nach mit Pikes Peak der eben erwähnten Karte identisch ist. Die Wind-River Mountains bilden die Wasserscheide (divortia aquarum) zwischen beiden Meeren. „Von dem Kulminationspunkte“, sagt Kapitän Frémont in seinem offiziellen Berichte (Report of the Exploring Expedition to the Rocky Mountains in the year 1842, and to Oregon and North California in the years 1843–44, p. 70), „sahen wir auf der einen Seite zahllose Alpenseen und die Quellen des Rio Colorado, welcher durch den Golf von Kalifornien seine Wasser der Südsee zuführt; auf der anderen Seite das tiefe Tal des Wind River, wo die Quellen des Gelbstein-Flusses (Yellowstone River) liegen, eines der Hauptzweige des Missouri, der sich bei St. Louis mit dem Missisippi vereinigt. Gegen Nordwest erheben ihr mit ewigen Schnee bedecktes Haupt die Trois Tetons, in denen sich der eigentliche Ursprung des Missouri befindet, unfern der Quellwasser des Oregon oder Columbia-River, nämlich des Zweiges, welcher Snake River oder Lewis Fork genannt wird.“ Zum Erstaunen der kühnen Bergbesteiger wurde die Höhe von Frémonts Peak von Bienen besucht. Vielleicht waren sie, wie die Schmetterlinge, welche ich in noch viel höheren Regionen in der Andenkette, ebenfalls in dem Bereich des ewigen Schnees, gesehen, unwillkürlich durch den aufsteigenden Luftstrom heraufgezogen. Auch fern von den Küsten in der Südsee habe ich großflüglige Lepidopteren auf die Schiffe fallen sehen, von Landwinden weit in das Meer getrieben.
Frīmonts Karte und geographische Untersuchungen umfassen den ungeheuren Länderstrich von der Mündung des Kansas River in den Missouri bis zu den Wasserfällen des Columbia und den Missionen Santa Barbara und Pueblo de los Angeles in Neu-Kalifornien: Ein Längenunterschied von 28° (an 340 geogr. Meilen) zwischen den Parallelen von 34° bis 45° nördlicher Breite. Vierhundert Punkte sind durch Barometer-Messungen hypsometrisch und großenteils auch astronomisch bestimmt worden: so daß eine Länderstrecke, welche mit den Krümmungen des Weges an 900 geographische Meilen betrug, von der Mündung des Kansas-Flusses bis zum Fort Vancouver und zu den Küsten der Südsee (fast 180 Meilen mehr als die Entfernung von Madrid bis Tobolsk) in einem Profile über die Meeresfläche hat können dargestellt werden. Da ich glaube, der Erste gewesen zu sein, der es unternommen hat, die Gestaltung ganzer Länder (die Iberische Halbinsel, das Hochland von Mexiko und die Kordilleren von Südamerika) in geognostischen Profilen darzustellen (die halb-perspektivischen Projektionen eines sibirischen Reisenden, des Abbé Chappe, waren auf bloße und meist sehr alberne Schätzungen von Flußgefällen gegründet); so ist es mir eine besondere Freude, die graphische Methode, welche die Erdgestaltung in senkrechter Richtung, die Erhebung des Starren über dem Flüssigen, darstellt, auf die großartigste Weise angewandt zu sehen. Unter den mittleren Breiten von 37° bis 43° bieten die Rocky Mountains außer den großen Schneegipfeln, welche mit der Höhe des Pics von Teneriffa zu vergleichen sind, Hochebenen in einer Ausdehnung dar, wie man sie kaum sonst auf der Erde findet, und welche an Breite von Osten nach Westen die mexikanische Hochebene fast um das Doppelte übertreffen. Von dem Gebirgsstock, der etwas westlich vom Fort Laramie anfängt, bis jenseits der Wasatch Mountains erhält sich ununterbrochen eine Anschwellung des Bodens von fünf- bis siebentausend Fuß über dem Meeresspiegel; ja sie füllt noch von 34° bis zu 45° Breite den ganzen Raum zwischen den eigentlichen Rocky Mountains und der kalifornischen Schneekette der Küste aus. Dieser Raum, eine Art von breitem Längental wie das des Sees von Titicaca, wird von den, der westlichen Gegenden sehr kundigen Reisenden Joseph Walker und Kapitän Frémont the Great Basin genannt; es ist eine Terra incognita von wenigstens 8000 geographischen Quadratmeilen, dürre, fast menschenleer, und voll Salzseen, deren größter 3940 Pariser Fuß über dem Meeresspiegel erhaben ist und mit dem schmalen Utah-See zusammenhängt (Frémont, Report of the Exploring Expedition, p. 154 und 273–276). In den letzteren fließt der wasserreiche Felsen-Fluß (Timpan Ogo in der Utah-Sprache) [Provo River]. Der Pater Escalante hat Frémonts Great Salt Lake im Jahr 1776 auf seiner Wanderung von Santa Fé del Nuevo Mexiko nach Monterey in Neu-Kalifornien entdeckt und ihm, Fluß und See verwechselnd, den Namen Laguna de Timpanogo gegeben. Als solche habe ich dieselbe in meine Karte von Mexiko eingetragen, was zu vielem unkritischen, schon von dem kenntnisvollen amerikanischen Geographen Tanner gerügten Streit über die vorgegebene Nicht-Existenz eines großen salzigen Binnenwassers Anlaß gegeben hat. (Humboldt, Atlas Mexicain, plch. 2; Essai politique sur la Nouv. Esp., T. I, p. 231, T. II, p. 243, 313 und 420; Frémont, Upper Califonia, 1848, p. 9; vgl. auch noch Duflot de Mofras, Exploration de l’Orégon, 1844, T. II, p. 40.) Gallatin sagt ausdrücklich in der Abhandlung über die einheimischen Volksstämme in der Archaeologia Americana, Vol. II, p. 140: »General Ashley and Mr. J. S. Smith have found the Lake Timpanogo in the same latitude and longitude nearly as had been assigned to it in Humboldt’s Atlas of Mexico.«
Ich verweile geflissentlich bei diesen Betrachtungen über die wunderbare Anschwellung des Bodens in der Region der Rocky Mountains, weil sie ohne allen Zweifel durch ihre Ausdehnung und Höhe einen großen, bisher unbeachteten Einfluß auf das Klima der ganzen Nordhälfte des Neuen Kontinents in Süden und Osten ausüben muß. In der großen ununterbrochenen Hochebene sah Frémont alle Nächte im Monat August das Wasser sich mit Eis belegen. Nicht geringer ist die Wichtigkeit der Erdgestaltung hier für den sozialen Zustand und die Fortschritte der Kultur in dem großen nordamerikanischen Freistaat. Ungeachtet die Wasserscheide eine Höhe erreicht,welche der der Pässe vom Simplon (6170 F.) [2005 m], vom Gotthard (6440 F.) [2108 m] und vom Großen Bernhard (7476 F.) [2449 m] nahe kommt, ist doch das Ansteigen so gedehnt und allmählich, daß dem Verkehr auf Fuhrwerk und Wagen aller Art zwischen dem Missouri- und Oregon-Gebiet, zwischen den Atlantischen Staaten und den neuen Ansiedlungen am Oregon oder Columbia-Flusse, zwischen den Küsten, die Europa und China gegenüberliegen, nichts entgegensteht. Die Entfernung von Boston bis zum alten Astoria an der Südsee, am Ausfluß des Oregon, ist auf geradem Wege nach Unterschied der Längengrade 550 geogr. Meilen, ungefähr ⅙ weniger als die Entfernung von Lissabon zum Ural bei Katharinenburg [Swerdlowsk]. Bei einem so sanften Ansteigen der Hochebene, die vom Missouri nach Kalifornien und in das Oregon-Gebiet führt (von Fort und Fluß Laramie am nördlichen Zweige des Platte River bis Fort Hall am Lewis Fork des Columbia River waren alle gemessenen Lagerplätze fünf- bis siebentausend, ja in Old Park 9760 Pariser Fuß hoch!), hat man nicht ohne Mühe den Kulminationspunkt, den der divortia aquarum, bestimmt. Er befindet sich südlich von den Wind-River Mountains, ziemlich genau in der Mitte des Weges vom Mississippi zum Litoral der Südsee, in einer Höhe von 7027 Fuß: Also nur 450 Fuß niedriger als der Paß des Großen Bernhard. Die Einwanderer nennen diesen Kulminationspunkt den South Paß (Frémonts Report, p. 3, 60, 70, 100 und 129). Er liegt in einer anmutigen Gegend, wo viele Artemisien, besonders A. tridentata (Nuttall), Aster-Arten und Kakteen das Glimmerschieferund Gneis-Gestein bedecken. Astronomische Bestimmungen geben: Br. 42° 24′, L. 111 ° 46′. Adolf Erman hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß das Streichen der großen ostasiatischen Aldan-Gebirgskette, welche das Lena-Gebiet von den Zuflüssen des Großen Ozeans (der Südsee) trennt, als größter Kreis auf der Erdkugel verlängert, durch viele Gipfel der Rocky Mountains zwischen 40° und 55° Breite geht. „Eine amerikanische Bergkette und eine asiatische scheinen dergestalt nur Teile von derselben auf kürzestem Wege ausgebrochenen Spalte.“ (Vgl. Erman, Reise um die Erde, Abt. I, Bd. 3, S. 8, Abt. II, Bd. 1, S. 386, mit dessen Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland, Bd. VI, S. 671.)
Von den Rocky Mountains, die sich gegen den lang beeisten Mackenzie-Strom herabsenken, und von dem Hochlande, auf dem sich einzelne Schneegipfel erheben, ist ganz zu unterscheiden das westlichere, höhere Gebirge des Litorals, die Reihe der kalifornischen Seealpen, die Sierra Nevada de California. So unverständig ausgewählt auch die leider allgemein eingeführte Benennung Fels-Gebirge (Rocky Mountains) für die nördlichste Fortsetzung der mexikanischen Zentralkette ist, so scheint es mir doch nicht ratsam sie, wie man häufig versucht, Oregon-Kette zu nennen. Allerdings liegen in derselben die Quellwasser der drei Hauptäste (Lewis, Clarks and North Fork), welche den mächtigen Oregon oder Columbia-Fluß bilden; aber derselbe Fluß durchbricht auch die kalifornische Kette der mit ewigem Schnee bedeckten Seealpen. Der Name Oregon-Distrikt wird politisch und offiziell auch für das kleinere Ländergebiet westlich von der Litoral-Kette gebraucht, da wo das Fort Vancouver und die Walahmuttischen Ansiedlungen (Settlements) liegen; und es ist vorsichtiger, den Namen Oregon weder der Zentralnoch Litoral-Kette zu geben. Dieser Name hat übrigens einen berühmten Geographen, Herrn Malte-Brun, zu einem Mißverständnis der seltensten Art verleitet. Er las auf einer alten spanischen Karte: „und noch weiß man nicht (y aun se ignora), wo die Quelle dieses Flusses (des jetzt so genannten Columbia-Flusses) ist“; und glaubte in dem Worte ignora den Namen des Oregon zu erkennen. (S. mein Essai polit. sur la Nouv. Espagne, T. II, p. 314.)
Die Felsen, welche bei dem Durchbruch der Kette die Katarakte des Columbia bilden, bezeichnen die Fortsetzung der Sierra Nevada de California vom 44. bis zum 47. Breitengrad (Frémont, Geographical Memoir upon Upper-California, 1848, p. 6). In dieser nördlichen Fortsetzung liegen die drei Kolosse Mount Jefferson, Mount Hood und Mount St. Helens, welche sich bis 14.540 Par. Fuß über die Meeresfläche erheben. Die Höhe dieser Litoral-Kette (Coast Range) übersteigt also weit die der Rocky Mountains. „Auf einer achtmonatelangen Reise, die wir längs den Seealpen machten“, sagt Kapitän Frémont (Report, p. 274), „haben wir unablässig Schneegipfel im Angesicht gehabt; ja, wenn wir die Rocky Mountains im South Paß in einer Höhe von 7027 Fuß übersteigen konnten, so fanden wir dagegen in den Seealpen, welche in mehrere Parallelketten geteilt sind, die Pässe volle 2000 Fuß höher"; also nur 1170 Fuß unter dem Gipfel des Ätna. Überaus merkwürdig ist es auch, und an die Verhältnisse der östlichen und westlichen Kordilleren von Chile mahnend, daß nur die dem Meere nähere Bergkette, die kalifornische, jetzt noch brennende Vulkane darbietet. Die Kegelberge Regnier [Mount Rainier] und St. Helens sieht man fast ununterbrochen rauchen; und am 23. November 1843 hatte der letztere Vulkan einen Aschenauswurf, der in 10 Meilen Entfernung die Ufer des Columbia wie mit Schnee bedeckteXXIII. Zu der vulkanischen kalifornischen Kette gehören auch noch im hohen Norden des russischen Amerika der Eliasberg (nach La Pérouse 1980, nach Malaspina gar 2792Toisen hoch) und der Mount Fair Weather (Cerro de Buen Tiempo, 2304 Toisen). Beide Kegelberge werden für noch tätige Vulkane gehalten. In den Rocky Mountains hat Frémonts für Botanik und Geognosie gleich tätige Expedition ebenfalls vulkanische Produkte (verschlackten Basalt, Trachyt, ja wirklichen Obsidian) gesammelt; ein alter ausgebrannter Krater wurde etwas östlich vom Fort Hall (Br. 43 ° 2′, L. 114° 50′) aufgefunden, aber von noch tätigen, Lava und Asche ausstoßenden Vulkanen war keine Spur. Man darf damit nicht verwechseln das noch wenig aufgeklärte Phänomen rauchender Hügel: smoking hills, côtes brûlées, terrains ardents in der Sprache englischer Ansiedler und französisch sprechender Eingeborener. „Reihen von niedrigen konischen Hügeln“, sagt ein genauer Beobachter, Herr Nicollet, „sind, fast periodisch, oft zwei bis drei Jahre lang mit dichtem schwarzen Rauch bedeckt. Flammen sind nicht dabei sichtbar. Das Phänomen zeigt sich vorzüglich in dem Gebiete des oberen Missouri, und noch näher dem östlichen Abfall der Rocky Mountains, wo ein Fluß bei den Eingeborenen Mankizitah-watpa, d.i. Fluß der rauchenden Erde, heißt. Verschlackte pseudo-vulkanische Produkte, eine Art Porzellan-Jaspis, finden sich in der Nähe der rauchenden Hügel.“ Seit der Expedition von Lewis und Clark hatte sich besonders die Meinung verbreitet, daß der Missouri wirklichen Bimsstein an seinen Ufern absetze. Man hat feinzellige weißliche Massen mit Bimsstein verwechselt. Professor Ducatel wollte die Erscheinung, die man hauptsächlich in der Kreide-Formation beobachtet, „einer Wasserzersetzung durch Schwefelkiese und einer Reaktion auf Braunkohlen-Flöze“ zuschreiben. (Vgl. Frémonts Report, p. 164, 184, 187, 193 und 299, mit Nicollets Illustration of the Hydrographical Basin of the Upper Mississippi River, 1843, p. 39–41.)
Wenn wir am Schluß dieser allgemeinen Betrachtungen über die Gestaltung von Nordamerika noch einmal den Blick auf die Erdräume heften, welche die zwei divergierenden Küstenketten von der Zentralkette scheiden, so finden wir auffallend kontrastierend im Westen zwischen der Zentralkette und den Südsee-Alpen von Kalifornien eine dürre und menschenleere Hochebene von fünf- bis sechstausend Fuß Erhebung über dem Meeresspiegel; im Osten zwischen den Alleghenys, deren höchste Gipfel, Mount Washington und Mount March, sich, nach Lyell, 6240 und 5066 Fuß hoch erheben, und den Rocky Mountains die reich bewässerte, fruchtbare, vielbewohnte Mississippi-Niederung, deren größerer Teil, mehr denn zweimal so hoch wie die lombardische Ebene, die Höhe von 4–600 Fuß erreicht. Die hypsometrische Konstitution dieses östlichen Tieflandes, d.h. sein Verhältnis zu dem Niveau des Meeresspiegels, ist erst in der neuesten Zeit durch die vortrefflichen Arbeiten des talentvollen, der Wissenschaft durch einen frühen Tod entzogenen, französischen Astronomen Nicollet aufgeklärt worden. Seine in den Jahren 1836–1840 aufgenommene große Karte des oberen Mississippi gründet sich auf 240 astronomische Breiten- und 170 barometrische Höhenbestimmungen. Die Ebene, welche das Becken des Mississippi einschließt, ist identisch mit der nördlicheren kanadischen; eine und dieselbe Niederung erstreckt sich vom Golf von Mexiko bis an das arktische Meer. (Vgl. meine Relation historique, T. III, p. 234, und Nicollet, Report to the Senate of the United States, 1843, p. 7 und 57.) Wo das Tiefland wellenförmig ist und die Hügel (Côteaux des Prairies, Côteaux des Bois nach der einheimischen, noch immer unenglischen Nomenklatur)XXIV zwischen 47° und 48° Breite in zusammenhängenden Reihen auftreten, teilen diese Reihen und sanften Anschwellungen des Bodens die Wasser zwischen der Hudsonbai und dem mexikanischen Meerbusen. Eine solche Wasserscheide bezeichnen die Missabay [Mesabi]-Höhen nördlich vom Oberen See (Lake Superior oder Kichi Gummi), und westlicher die sogenannten Hauteurs de Terres, in denen die wahren, erst 1832 entdeckten Quellen des Mississippi, eines der größten Ströme der Welt, liegen. Die höchsten dieser Hügelketten erreichen kaum 1400 bis 1500 Fuß. Von der Mündung (Old French Balize) bis St. Louis, etwas südlich von dem Zusammenfluß des Missouri und Mississippi, hat der letztere nur 357 Fuß Gefälle, trotz einer Itinerar-Distanz von mehr als 320 geographischen Meilen. Der Spiegel des Lake Superior liegt 580 Fuß hoch; und da seine Tiefe in der Nähe der Magdalenen-Insel genau 742 Fuß beträgt, so ist sein Seeboden 162 Fuß unter der Oberfläche des Ozeans. (Nicollet, p. 99, 125 und 128.)
Beltrami, welcher sich 1825 von der Expedition des Major Long getrennt hatte, rühmte sich die Quellen des Missisippi im See Caß aufgefunden zu haben. Der Fluß durchströmt nämlich in seinem obersten Laufe vier Seen, deren zweiter der See Caß ist. Der äußerste heißt der Itasca-See (Br. 47° 13′, L. 97° 22′) und ist erst 1832 auf der Expedition von Schoolcraft und Lieutenant Allen für die wahre Quelle des Mississippi erkannt worden. Dieser, später so mächtige Strom ist bei seinem Ausfluß aus dem See Itasca, welcher eine sonderbare Hufeisenform hat, nur 16 Fuß breit und 14 Zoll tief. Erst durch die wissenschaftliche Expedition von Herrn Nicollet im Jahr 1836 sind die Lokalverhältnisse durch astronomische Ortsbestimmungen erschöpfend aufgeklärt worden. Die Höhe der Quellen, d.h. der letzten Zuflüsse, welche der See Itasca von dem Scheidegebirge, Hauteur de terre genannt, empfängt, ist 1575 Fuß über dem Meeresspiegel. Ganz nahe dabei und zwar am südlichen Abfall desselben Scheidegebirges liegt der Elbow-See, in welchem der kleine Red River of the North, der Hudsonbai nach vielen Krümmungen zufließend, seinen Ursprung hat. Ähnliche Quellverhältnisse von Flüssen, die ihre Wasser der Ostsee und dem Schwarzen Meere zuführen, zeigen die Karpaten. Zwanzig kleinen Seen, welche in Süden und Westen des Itasca sich zu engen Gruppen vereinigen, hat Herr Nicollet die Namen berühmter Astronomen, intimer Feinde und Freunde, gegeben, die er in Europa zurückgelassen. Die Karte wird ein geographisches Album, welche an das botanische Album der ›Flora peruviana‹ von Ruiz und PavonXXV erinnert, in der die Namen neuer Pflanzengeschlechter dem Hofkalender und dem jedesmaligen Wechsel der Oficiales de la Secretaria angepaßt wurden.
Östlich vom Mississippi herrschen noch teilweise dichte Waldungen, westlich nur Grasfluren, in denen der Buffalo (Bos americanus) und der Bisamstier (Bos moschatus) herdenweise weiden. Beide Tiere, die größten der Neuen Welt, dienen den nomadischen Indianern, den Apaches Llaneros und Apaches Lipanos, zur Nahrung. Die Assiniboins erlegen in den sogenannten Bisonparks, künstlichen Gehegen zum Eintreiben der wilden Herden, bisweilen in wenigen Tagen sieben- bis achthundert Bison (Maximilian Prinz zu Wied, Reise in das innere Nord-Amerika, Bd. I, 1839, S. 443). Der amerikanische Bison, von den Mexikanern Cibolo genannt, wird meist bloß der Zunge (eines gesuchten Leckerbissens) wegen getötet. Er ist keineswegs eine bloße Spielart des Auerochsen der Alten Welt: obwohl andere Tierarten, z.B. das Elen (Cervus alces) und das Rentier (Cervus tarandus), ja selbst der kurzleibige Polarmensch, den nördlichen Teilen aller Kontinente gleichsam als Beweise ihres ehemaligen, langdauernden Zusammenhanges gemein sind. Den europäischen Ochsen nennen die Mexikaner im aztekischen Dialekt quaquahue, ein gehörntes Tier, von quaquahuitl, Horn. Ungeheure Rindshörner, welche in alten mexikanischen Gebäuden unweit Cuernavaca, südwestlich von der Hauptstadt Mexiko, gefunden worden sind, scheinen mir dem Bisamstier angehört zu haben. Der kanadische Bison kann zur Ackerarbeit gezähmt werden. Er begattet sich mit dem europäischen Ochsen; es war lange ungewiß, ob der Bastard selbst fruchtbar sei und sich fortpflanze. Albert Gallatin, der sich, ehe er in Europa als ein ausgezeichneter Diplomat auftrat, durch eigene Anschauung eine große Kenntnis des unkultivierten Teiles der Vereinigten Staaten verschafft hatte, versichert, daß die fruchtbare Vermischung des amerikanischen Buffalo mit europäischem Rindvieh gar nicht zu leugnen sei: “the mixed breed was quite common fifty years ago in some of the northwestern counties of Virginia; and the cows, the issue of that mixture, propagated like all others.“ „Ich erinnere mich nicht“, fügt Gallatin hinzu, „daß ausgewachsene Bisons gezähmt wurden; aber Hunde fingen damals bisweilen junge Bison-Kälber ein, die man aufzog und mit den europäischen Kühen austrieb. Bei Monongahela war lange alles Rindvieh von dieser Bastardrasse. Man klagte, daß sie wenige Milch gebe.“ Die Lieblingsnahrung des Bison ist Tripsacum dactyloides (Buffalo Gras in Nord-Carolina genannt) und eine unbeschriebene, dem Trifolium repens nahe verwandte Kleeart, welche Barton mit dem Namen Trifolium bisonicum bezeichnete.
Ich habe schon an einem anderen Ort (Kosmos, Bd. II, S. 488) darauf aufmerksam gemacht, daß nach einer Angabe des sehr glaubwürdigen Gomara (Historia general de las Indias, cap. 214) im Nordwesten von Mexiko unter 40° Breite noch im sechzehnten Jahrhundert ein indianischer Volksstamm lebte, dessen größter Reichtum in Herden gezähmter Bisons (bueyes con una giba) bestand. Und trotz dieser Möglichkeit, den Bison zu zähmen, trotz der vielen Milch, die er gibt, trotz der Herden von Lamas in den peruanischen Kordilleren fand man bei der Entdeckung von Amerika kein Hirtenleben, keine Hirtenvölker. Kein Zeugnis der Geschichte redet dafür, daß je diese Zwischenstufe des Völkerlebens hier vorhanden gewesen. Merkwürdig ist es auch, daß der nordamerikanische Buffalo oder Bison einen Einfluß auf die geographischen Entdeckungen in unwegsamen Gebirgsgegenden ausgeübt hat. Die Bisons wandern in Herden von mehreren Tausenden, ein milderes Klima suchend, im Winter in die Länder südlich vom Arkansas-Flusse. Ihre Größe und unbehilfliche Gestaltung macht es ihnen auf diesen Wanderungen schwer, über hohe Gebirge zu kommen. Wo man einen vielbetretenen Bison-Pfad (buffalo-path) findet, muß man ihm folgen, weil er gewiß den bequemsten Paß über die Berge angibt. So haben Buffalo-Pfade die besten Wege durch die Cumberland Mountains in den südwestlichen Teilen von Virginien und Kentucky, in den Rocky Mountains zwischen den Quellen des Yellowstone und Platte River, zwischen dem südlichen Zweige des Columbia und dem kalifornischen Rio Colorado vorgezeichnet. Aus den östlichen Gegenden der Vereinigten Staaten (die wandernden Tiere betraten vormals die Ufer des Mississippi und des Ohio weit über Pittsburgh hinaus) hat europäische Ansiedlung die Bisons allmählich zurückgejagt. (Archaeologia Americana, Vol. II, 1836, p. 139.)
Von der Granitklippe Diego Ramirez, von dem vieldurchschnittenen Feuerlande, das östlich silurische Schiefer, westlich dieselben Schiefer durch unterirdisches Feuer zu Granit metamorphosiert enthält (Darwin, Journal of researches into the geology and natural history of the countries visited 1832–1836 by the Ships Adventure and Beagle, p. 266), bis zu dem nördlichen Polar-Meere hin haben die Kordilleren eine Länge von mehr als 2000 geographischen Meilen. Sie sind nicht die höchste, aber die ausgedehnteste Bergkette unserer Erde: aus einer Spalte hervorgehoben, die meridianartig von Pol zu Pol eine Hälfte unseres Planeten durchläuft, an Erstreckung die Meilenzahl übertreffend, welche man im Alten Kontinent von den Säulen des Herkules bis zum Eiskap der Tschuktschen im nordöstlichen Asien zählt. Wo die Anden in mehrere Parallelketten geteilt sind, bieten im ganzen die dem Meere näheren Ketten vorzugsweise die tätigeren Vulkane dar; mehrfach wird aber auch bemerkt, daß, wenn die Erscheinungen des unterirdischen Feuers in einer Bergreihe verschwinden, das Feuer in einer anderen, parallel streichenden ausbricht. Der Regel nach folgen die Ausbruchkegel der Richtungs-Achse der Kette; aber im mexikanischen Hochlande stehen die tätigen Vulkane auf einer Querspalte, die von Meer zu Meer ost-westlich gerichtet ist (Humboldt, Essai politique, T. II, p. 173). Wo durch Erhebung der Bergmassen bei der alten Faltung der Erdrinde der Zugang zu dem geschmolzenen InnernXXVI geöffnet worden ist, fährt das Innere fort, auf die mauerartig emporgehobene Masse mittels des Spaltengewebes zu wirken. Was wir eine Bergkette nennen, ist nicht auf einmal gehoben und zu äußerer Erscheinung gebracht. Gebirgsketten sehr verschiedener Altersfolge haben sich überlagert und auf früh gebahnten Wegen durchdrungen. Verschiedenartigkeit der Gebirgsarten entsteht durch Erguß und Hebung eines Eruptions-Gesteins, wie durch die verwickelten und langsamen Prozesse der Umwandlung auf dampferfüllten, wärmeleitenden Spalten.
Für die kulminierenden höchsten Punkte der ganzen Kordilleren des Neuen Kontinents sind eine Zeitlang, von 1830 bis 1848, gehalten worden:
der Nevado de Sorata [oder Illampu], auch Ancohuma oder Tusubaya genannt (südliche Breite 15° 52′), etwas südlich von dem Dorfe Sorata oder Esquibel, in der östlichen Kette von Bolivia, hoch 3949 Toisen oder 23.692 Pariser Fuß [6550 m];
der Nevado de Illimani, westlich von der Mission Yrupana (südliche Breite 16° 38′), hoch 3753 Toisen oder 22.518 Pariser Fuß [6882 m], ebenfalls in der östlichen Kette von Bolivia;
der Chimborazo (südliche Breite 1° 27′) in der Provinz Quito, 3350 Toisen oder 20.100 Pariser Fuß [6310 m].
Der Sorata und Illimani sind vorerst von Pentland, einem ausgezeichneten Geognosten, gemessen worden, und zwar 1827 und 1838. Seit dem Erscheinen seiner großen Karte von dem Becken der Laguna de Titicaca, im Juni 1848, wissen wir aber, daß die obigen Angaben der Höhen des Sorata und Illimani um 3718 und 2675 Pariser Fuß zu groß sind. Die Karte gibt dem Sorata 21.286, dem Illimani 21.149 engl. Fuß, d. i. nur 19.974 und 19.843 Pariser Fuß. Eine genauere Berechnung der trigonometrischen Operationen von 1838 hat Herrn Pentland diese neuen Resultate dargeboten. Auf der westlichen Kordillere gibt derselbe 4 Pics an zu 20.360 bis 20.971 Par. Fuß. Der Pic Sahama wäre also 871 Fuß höher als der Chimborazo, aber 796 F. niedriger als der Aconcagua.
6 (S. 4) Die Wüste am Basaltgebirge Harudsch [Harudz el-Asuad].
Nahe bei den ägyptischen Natron-Seen, welche zu Strabos Zeiten noch nicht in sechs Behälter getrennt waren, erhebt sich eine Hügelkette. Sie steigt gegen Norden prallig an und zieht sich von Osten gegen Westen über Fezzan hinaus, wo sie sich endlich an die Atlaskette anzuschließen scheint. Sie trennt im nordöstlichen Afrika (wie der Atlas im nordwestlichen) Herodots bewohntes meernahes Libyen von dem tierreichen Berberland oder Biledulgerid. An den Grenzen von Mittel-Ägypten ist der ganze Erdstrich südlich vom 30. Breitengrade ein Sandmeer, in dem quellen- und vegetationsreiche Inseln, als Oasen, zerstreut liegen. Die Zahl dieser Oasen, deren die Alten nur drei zählten und die Strabo mit den Flecken der Pantherfelle vergleicht, hat durch die Entdeckung neuerer Reisender beträchtlich zugenommen. Die dritte Oase der Alten, jetzt Siwa genannt, war der Hammonische Nomos: ein Priesterstaat und Ruheplatz für die Karawanen, die Tempel des gehörnten Ammon und den, wie man wähnte, periodisch kühlen Sonnenbrunnen einschließend. Die Trümmer von Ummibida (Omm-Beydah) gehören unstreitig zu der befestigten Karawanserei am Ammon-Tempel, und daher zu den ältesten Denkmälern, welche aus den Zeiten aufdämmernder Menschenbildung auf uns gekommen sind. (Caillaud, Voyage à Syouah, p. 14; Ideler in den Fundgruben des Orients, Bd. IV, S. 399–411.)
Das Wort Oasis [Oase] ist ägyptisch und mit Auasis und Hyasis gleichbedeutend (Strabo, lib. II, p. 130, lib. XVII, p. 813, Cas.; Herod., lib. III, cap. 26, p. 207, Wessel.). Abulfeda nennt die Oase el-Wah. In den späteren Zeiten der Cäsaren schickte man Missetäter in die Oasen. Man verbannte sie auf die Inseln im Sandmeer gleichsam wie die Spanier und Engländer ihre Verbrecher auf die Malwinen oder nach Neu-Holland [Australien] schicken. Durch den Ozean ist fast leichter zu entkommen als durch die Wüste, welche die Oasen umgibt. Letztere nehmen durch Versandungen an Fruchtbarkeit ab.
Es wird behauptet, das kleine Gebirge Harudsch (Harudje [Harudz el-Asuad]) bestehe aus Basalthügeln von grotesker Form (Ritters Afrika, 1822, S. 885, 988, 993 und 1003). Es ist der Mons ater des Plinius; und in seiner westlichsten Erstreckung, wo es das Soudah-Gebirge heißt, hat es mein unglücklicher Freund, der kühne Reisende Ritchie, untersucht. Diese Basalt-Ausbrüche in tertiärem Kalkstein, diese Hügelreihen, wie auf Gangspalten mauerartig erhoben, scheinen den Basalt-Ausbrüchen im Vicentinischen analog zu sein. Die Natur wiederholt dieselben Phänomene in den entlegensten Erdstrichen. In den, vielleicht zur alten Kreide gehörigen Kalkstein-Formationen des weißen Harudsch (Harudje el-Abiad) fand Hornemann eine ungeheure Menge versteinerter Fischköpfe. Auch bemerkten Ritchie und Lyon, daß der Basalt der Soudah-Berge an mehreren Stellen, wie der am Monte Berico, innigst mit kohlensaurer Kalkerde gemengt war: Ein Phänomen, das wahrscheinlich mit dem Durchbruch durch Kalkstein-Schichten zusammenhängt. Lyons Karte gibt in der Nähe selbst Dolomit an. In Ägypten haben neuere Mineralogen wohl Syenit und Grünstein, aber nicht Basalt entdeckt. Sollten daher die antiken Gefäße, welche man hier und da von wahrem Basalt findet, ihr Material zum Teil diesem westlichen Gebirge verdanken? Sollte dort auch Obsidius lapis vorkommen? Oder sind Basalt und Obsidian am Roten Meer zu suchen? Der Strich vulkanischer Ausbrüche des Harudsch an dem Saume der afrikanischen Wüste erinnert übrigens den Geologen an die augithaltigen blasigen Mandelsteine, Phonolithe und Grünstein-Porphyre, welche man nur an der nördlichen und westlichen Grenze der Steppen von Venezuela und der Arkansas-Ebenen (gleichsam an den alten Uferketten) findet. (Humboldt, Relation historique, T. II, p. 142; Longs Expedition to the Rocky Mountains, Vol. II, p. 91 und 405.)
7 (S. 4) Wo ihn plötzlich der tropische Ostwind verläßt und das Meer mit Seetang bedeckt ist.
Es ist eine merkwürdige, aber den Schiffahrern allgemein bekannte Erscheinung, daß in der Nähe der afrikanischen Küste (zwischen den Kanarischen und Kapverdischen Inseln, besonders zwischen dem Vorgebirge Bojador und dem Ausfluß des Senegal), statt des unter den Wendekreisen allgemein herrschenden Ost- oder Passatwindes, oft ein Westwind weht. Die Ursache dieses Windes ist die weit ausgedehnte Wüste Sahara. Über der erhitzten Sandfläche verdünnt sich die Luft und steigt senkrecht in die Höhe. Um diesen luftdünnen Raum auszufüllen, strömt die Meeresluft zu; und so entsteht an den westlichen Küsten Afrikas bisweilen ein Westwind, der den nach Amerika bestimmten Schiffen entgegen ist. Diese fühlen, ohne den Kontinent zu sehen, die Wirkung des wärmestrahlenden Sandes. Bekanntlich beruht auf demselben Grunde der Wechsel der Land- und Seewinde, welche an allen Küsten zu bestimmten Stunden des Tages und der Nacht abwechselnd wehen.
Die Anhäufung des Seetangs in der Nähe der westlichen Küsten von Afrika wird schon im Altertum häufig erwähnt. Die örtliche Lage dieser Anhäufung ist ein Problem, das mit den Vermutungen über die Ausdehnung der phönizischen Schiffahrt im innigen Zusammenhang steht. Der Periplus, den man dem Scylax von Caryanda zuschreibt und der nach den Untersuchungen von Niebuhr und Letronne sehr wahrscheinlich zur Zeit Philipps von Makedonien kompiliert worden ist, beschreibt schon eine Art Tang-Meer, Mar de Sargasso, eine Fülle von Fucus jenseits Cerne; aber die bezeichnete Lokalität scheint mir sehr verschieden von der, welche in dem Werke ›De mirabilibus auscultationibus‹ angegeben ist, das lange und mit Unrecht den großen Namen des Aristoteles geführt hat. (Vgl. Scyl. Caryand. Peripl., in: Hudson, Vol. II, p. 53, mit Aristot. de mirab. auscult., in Opp. omnia ex rec. Bekkeri, p. 844 § 136.) „Von dem Ostwinde getrieben“, sagt der Pseudo-Aristoteles, „kamen nach viertägiger Fahrt von Gades aus phönizische Schiffer in eine Gegend, wo das Meer mit Schilf und Seetang (ϱύον ϰαὶ φῦϰος) bedeckt gefunden wurde. Der Seetang wird von der Ebbe entblößt und von der Flut überschwemmt.“ Ist hier nicht von einer seichten Stelle zwischen dem 34. und 36. Breitengrade die Rede? Ist eine Untiefe durch vulkanische Revolution dort verschwunden? Vobonne gibt Klippen nördlich von Madeira an. (Vgl. auch Edrisi, Geogr. Nub., 1619, p. 157.) Im Scylax heißt es: „Das Meer über Cerne hinaus ist wegen großer Seichtigkeit, wegen des Schlammes und des Seegrases nicht mehr zu befahren. Das Seegras liegt eine Spanne dick und ist oberwärts spitzig, so daß es sticht.“ Der Seetang, welchen man zwischen Cerne (der phönizischen Lastschiff-Station Gaulea; nach Gosselin die kleine Insel Fedallah an der nordwestlichen Küste von Mauretanien) und dem Grünen Vorgebirge [Kap Verde] findet, bildet jetzt keineswegs eine große Wiese, eine zusammenhängende Gruppe, mare herbidum, wie jenseits der Azoren. Auch in der poetischen Küstenbeschreibung des Festus Avienus (Ora maritima, v. 109, 122, 388 und 408), die, wie es Avienus sehr bestimmt selbst (v. 412) angibt, mit Benutzung von phönizischen Schiffsjournalen verfaßt ist, wird des Hindernisses des Seetangs mit großer Ausführlichkeit erwähnt; aber Avienus setzt das Hindernis weit nördlicher, gen Jerne, die heilige Insel:
Sic nulla late flabra propellunt ratem,
Sic segnis humor acquoris pigri stupet.
Adjicit et illud, plurimum inter gurgites
Exstare fucum, et saepe virgulti vice
Retinere puppim …
Haec inter undas multa caespitem jacet,
Eamque late gens Hibernorum colit.
Wenn der Tang (fucus), der Schlamm (πηλός), die Seichtigkeit des Meeres und die ewige Windstille stets bei den Alten als Eigentümlichkeiten des westlichen Ozeans jenseits der Herkules-Säulen angegeben werden, so muß man besonders wegen der angeblichen Windstille wohl geneigt sein, punische List zu vermuten, die Neigung eines großen Handelsvolkes, durch Schreckbilder die Konkurrenz in der Schiffahrt nach Westen zu verhindern. Aber auch in echten Büchern (Aristot. Meteorol., II, 1, 14) beharrt der StagiritXXVII bei dieser Meinung von der Abwesenheit des Windes und sucht die Erklärung einer falsch beobachteten Tatsache oder, um mich richtiger auszudrücken, eines mythischen Schiffergerüchts in einer Hypothese über die Meerestiefe. Das stürmische Meer zwischen Gades und den Inseln der Seligen (Cadix und den Canarien) kann wahrlich nicht mit dem nur von sanften Passatwinden (vents alisés) bewegten Meere verglichen werden, welches zwischen den Wendekreisen eingeschlossen ist und welches von den Spaniern sehr charakteristisch (Acosta, Historia natural y moral de las Indias, lib. III, cap. 4) El Golfo de las Damas genannt wird.
Nach meinen sorgfältigen Untersuchungen und der Vergleichung vieler englischer und französischer Schiffsjournale begreift der alte und so unbestimmte Ausdruck Mar de Sargasso zwei Fucus-Bänke, deren eine, die größere, langgedehnte und östlichere, zwischen den Parallelen von 19° und 34° in einem Meridian 7 Grade westlich von der azorischen Insel Corvo liegt, während die kleinere, rundliche, westlichere Bank zwischen den Bermuden und Bahama-Inseln (Br. 25° – 31°, L. 68° – 76°) gefunden wird. Die Haupt-Achse der kleinen Bank, welche die Schiffe durchschneiden, die vom Baxo de Plata (Caye d’Argent) nördlich von St. Domingo nach den Bermuden segeln, scheint mir nach Ν 60° Ο gerichtet. Eine Transversal-Bande von Fucus natans, zwischen Br. 25° und 30° ostwestlich gedehnt, vereint die große und kleine Bank. Ich habe die Freude gehabt zu sehen, daß diese Angaben von meinem verewigten Freunde, dem Major Renneil, in seinem großen Werke über die Meeresströmungen angenommen und durch viele neue Beobachtungen bestätigt worden sind. (Vgl. Humboldt, Relation historique, T. I, p. 202, und Examen critique, T. III, p. 68–99, mit Rennell, Investigations of the Currents of the Atlantic Ocean, 1832, p. 184.) Beide Gruppen von Seetang nehmen samt der Transversal-Bande unter dem alten Namen Sargasso-Meer begriffen zusammen eine Oberfläche (area) ein, welche sechs- bis siebenmal die von Deutschland übertrifft.
So gewährt die Vegetation des Ozeans das merkwürdigste Beispiel gesellschaftlicher Pflanzen einer einzigen Art. Auf dem festen Lande bieten die Savannen oder Grasebenen von Amerika, die Heideländer (ericeta), die Wälder des Nordens von Europa und Asien, die gesellig wachsenden Zapfenbäume, Betulineen und Salicineen eine minder große Einförmigkeit dar als jene Thalassophyten. Unsere Heideländer zeigen im Norden, neben der herrschenden Calluna vulgaris, Erica tetralix, Ε. ciliaris und Ε. cinerea; im Süden Erica arborea, E. scoparia und E. mediterranea. Die Einförmigkeit des Anblickes, welchen der Fucus natans gewährt, ist mit keiner anderen Assoziation gesellschaftlich auftretender Spezies zu vergleichen. Oviedo nennt die Fucus-Bänke Wiesen, Praderias de yerva. Wenn man erwägt, daß Pedro Velasco, gebürtig aus dem spanischen Hafen Palos, dem Flug gewisser Vögel von Fayal aus nachsteuernd, schon 1452 die Insel Flores entdeckte, so scheint es wegen der Nähe der großen Fucus-Bank von Corvo und Flores fast unmöglich, daß nicht ein Teil der ozeanischen Wiese sollte vor Columbus von portugiesischen, durch Stürme gegen Westen getriebenen Schiffen gesehen worden sein. Doch erkennt man aus der Verwunderung der Reisegefährten des Admirals, als sie vom 16. September 1492 bis zum 8. Oktober ununterbrochen von Seegras umgeben waren, daß die Größe des Phänomens damals noch nicht den Seeleuten bekannt war. Der Besorgnisse, welche die Anhäufung des Seetangs erregte, und des Murrens seiner Gefährten erwähnt Kolumbus in dem von Las Casas exzerpierten Schiffsjournal zwar nicht. Er spricht bloß von den Klagen und dem Murren über die Gefahr der so schwachen und beständigen Ostwinde. Nur der Sohn Fernando Colon bemüht sich, die Besorgnisse des Schiffsvolks in der Lebensbeschreibung des Vaters etwas dramatisch auszumalen.
Nach meinen Untersuchungen hat Kolumbus die große Fucus-Bank im Jahr 1492 in Br. 28,5°, im Jahr 1493 in Br. 37°, und beide Male in der Länge von 40°–43° durchschnitten. Dies ergibt sich mit ziemlicher Gewißheit aus der von Kolumbus aufgezeichneten Schätzung der Geschwindigkeit und „täglich gesegelten Distanz“: freilich nicht durch Auswerfen der Logleine, sondern durch Angabe des Ablaufens der halbstündigen Sanduhren (ampolletas). Eine sichere und bestimmte Angabe des Logs, der Catena della poppa, finde ich erst für das Jahr 1521 in Pigafettas Reisejournal der Magellanischen Weltumseglung. (Kosmos, Bd. II, S. 296 und 469–472.) Die Bestimmung des Schiffsortes in den Tagen, wo Kolumbus die große Tangwiese durchstrich, ist um so wichtiger, als sie uns lehrt, daß seit 450 Jahren die Hauptanhäufung der gesellschaftlich lebenden Thalassophyten (möge sie Folge der Lokalbeschaffenheit des Meeresgrundes oder Folge der Richtung des zurücklaufenden Golfstromes sein) an demselben Punkte geblieben ist. Solche Beweise der Beständigkeit großer Naturphänomene fesseln zwiefach die Aufmerksamkeit des Physikers, wenn wir dieselbe in dem allbewegten ozeanischen Element wiederfinden. Obgleich nach Stärke und Richtung lang herrschender Winde die Grenzen der Fucus-Bänke beträchtlich oszellieren, so kann man doch noch für jetzt, für die Mitte des 19. Jahrhunderts, den Meridian von 41 ° Länge westlich von Paris für die Hauptachse der großen Bank annehmen. In der lebhaften Einbildungskraft des Kolumbus heftete sich die Idee von der Lage dieser Bank an die große physische Abgrenzungslinie, welche nach ihm „die Erdkugel in zwei Teile schied, und mit der Konfiguration des Erdkörpers, mit Veränderungen der magnetischen Abweichung und der klimatischen Verhältnisse in innigem Zusammenhange stehen“ sollte. Kolumbus, wenn er seiner Länge ungewiß ist, orientiert sich (Februar 1493) nach dem Erscheinen der ersten schwimmenden Tangstreifen (de la primera yerva) am östlichen Rande der großen Corvo-Bank. Die physische Abgrenzungslinie wurde durch den mächtigen Einfluß des Admirals schon am 4. Mai 1493 in eine politische, in die berühmte Demarkationslinie zwischen dem spanischen und portugiesischen Besitzrechte, umgewandelt. (Vgl. mein Examen critique, T. III, p. 64–99, und Kosmos, Bd. II, S. 316–318.)
8 (S. 4) Die nomadischen Tibbus und Tuaregs.
Diese beiden Nationen bewohnen die Wüste zwischen Bornu, Fezzan und Nieder-Ägypten. Sie sind uns erst durch Hornemanns und Lyons Reisen genauer bekannt geworden. Die Tibbus oder Tibbous schwärmen in dem östlichen, die Tuaryks (Tuaregs) in dem westlichen Teil des großen Sandmeeres. Die ersteren werden von anderen Stämmen wegen ihrer Beweglichkeit Vögel genannt. Die Tuaregs unterscheidet man in die von Agades und Tagazi. Sie sind oft Karawanenführer und Handelsleute. Ihre Sprache ist die der Berber, und sie gehören unstreitig zu den primitiven libyschen Völkern. Die Tuaregs bieten eine merkwürdige physiologische Erscheinung dar. Einzelne Stämme derselben sind nach Beschaffenheit des Klimas weiß, gelblich, ja fast schwarz: doch immer ohne Wollhaar und ohne negerartige Gesichtszüge. (Exploration scientifique de l’Algérie, T. II, p. 343.)
9 (S. 5) Der Schiffs der Wüste.
In orientalischen Gedichten wird das Kamel das Landschiff oder das Schiff der Wüste (Sefynet el-badyet) genannt; Chardin, Voyages, nouv. éd. par Langlès, 1811, T. III, p. 376.
Aber das Kamel ist nicht bloß der Träger in der Wüste und ein länderverbindendes Mittel der Bewegung; es ist auch, wie Carl Ritter in seiner vortrefflichen Abhandlung über die Verbreitungssphäre der Tierart ausgeführt hat, „die Hauptbedingung des nomadischen Völkerlebens auf der Stufe patriarchalischer Völkerentwicklung in den heißen regenlosen oder sehr regenarmen Länderstrichen unseres Planeten. Kein Tierleben ist so eng anschließend mit einer gewissen primitiven Entwicklungsstufe des Menschenlebens durch Naturbande gepaart und durch so viele Jahrtausende hindurch historisch festgestellt als das des Kamels im Beduinenstande“. (Asien, Bd. VIII, Abt. 1, 1847, S. 610 und 758.) „Dem Kulturvolk der Karthager war das Kamel durch alle Jahrhunderte seiner blühendsten Existenz bis zum Untergange des Handelsstaates völlig unbekannt; erst bei den Maurusiern tritt es im Heeresgebrauch mit den Zeiten der Cäsaren im westlichen Libyen auf, vielleicht sogar erst in Folge der kommerziellen Verwendung durch die Ptolemäer im Niltale. Die Guanchen, Bewohner der kanarischen Inseln, wahrscheinlich dem Berberstamm verwandtXXVIII, kannten die Kamele nicht vor dem 15. Jahrhundert, in welchem die normannischen Eroberer und Ansiedler sie einführten. Bei dem wahrscheinlich sehr geringen Verkehr der Guanchen mit der afrikanischen Küste mußte die Kleinheit ihrer Boote sie schon an dem Transport großer Tiere hindern. Der eigentliche, in dem Inneren von Nord-Afrika verbreitete Berberstamm, zu dem, wie eben erinnert worden, die Tibbus und Tuaregs gehören, verdankt wohl nur dem Kamelgebrauch durch das ganze wüste Libyen samt den Oasen nicht allein den gegenseitigen Verkehr, sondern auch seine Rettung von völligem Untergang, seine volkstümliche Erhaltung bis auf den heutigen Tag. Dagegen ist der Kamelgebrauch dem Negerstamm fremd geblieben; denn nur mit den Eroberungszügen der Beduinen durch den ganzen Norden Afrikas und mit den religiösen Missionen ihrer Weltbekehrer drang wie überall so auch bei ihnen das nutzbare Tier des Nedschd, der Nabatäer und der ganzen aramäischen Zone gegen Westen vor. Die Goten brachten Kamele schon im vierten Jahrhundert an den unteren Istros (Donau), wie die Ghazneviden sie in noch größeren Scharen bis zum Ganges nach Indien verpflanzten.“ In der Verbreitung durch den afrikanischen Kontinent muß man zwei Epochen unterscheiden: die der LagidenXXIX, welche durch Cyrene auf das ganze nordwestliche Afrika wirkte, und die mohammedanische Epoche der erobernden Araber.
Ob die Haustiere, welche den Menschen am frühesten begleiten, Rinder, Schafe, Hunde, Kamele, noch in ursprünglich wildem Zustande gefunden werden, ist lange problematisch geblieben. Die Hiongnu im östlichen Asien gehören zu den Völkern, welche am frühesten die wilden Kamele zu Haustieren gezähmt haben. Der kompilierende Verfasser des großen chinesischen Werkes ›Si-yu-wen-kien-lo‹ (Historia regionum oeeidentalium, quae Si-yu vocantur, visu et auditu cognitarum) versichert, daß in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Ost-Turkestan noch außer wilden Pferden und Eseln auch wilde Kamele umherschwärmten. Auch Hadschi Chalfa spricht in seiner im 17. Jahrhundert geschriebenen türkischen Geographie von sehr gebräuchlichen Jagden auf wilde Kamele in den Hochebenen von Kaschgar, Turfan und Khotan. Schott übersetzt aus einem chinesischen Autor, Ma-dschi, daß wilde Kamele sich finden in den Ländern nördlich von China und westlich vom Flußbette des Hoang-ho, in Ho-si oder Tangut. Nur Cuvier (Regne animal, T. I, p. 257) bezweifelt die jetzige Existenz des wilden Kamels in Inner Asien. Er glaubt, sie seien verwildert, da Kalmücken und andere buddhistische Religionsverwandte, „um sich ein Verdienst für jene Welt zu machen“, Kamele und andere Tiere in Freiheit setzen. Die Heimat des wilden arabischen Kamels war nach griechischen Zeugnissen zu den Zeiten des Artemidor und Agatharchides von Cnidus der Ailanitische Golf der Nabatäer. (Ritter, a.a.O., S. 670, 672 und 746.) Überaus merkwürdig ist die Entdeckung fossiler Kamelknochen der Vorwelt in den Siwalik-Hügeln (dem Vorgebirge des Himalaja) durch Kapitän Cautley und Doktor Falconer im Jahr 1834. Sie finden sich mit vorweltlichen Knochen von Mastodonten, wirklichen Elefanten, Giraffen und einer riesenhaften, 12 Fuß langen und 6 Fuß hohen Landschildkröte, Colossochelys (Humboldt, Kosmos, Bd. I, S. 292). Das Kamel der Vorwelt ist Camelus sivalensis genannt worden, ohne doch beträchtliche Unterschiede von den ägyptischen und bactrischen, noch lebenden, ein- und zweibuckligen Kamelen gezeigt zu haben. Aus Teneriffa wurden ganz neuerlich erst 40 Kamele auf Java eingeführt (Singapore-Journal of the Indian Archipelago, 1847, p. 206). Der erste Versuch ist in Samarang gemacht worden. Ebenso sind die Rentiere erst im letztverflossenen Jahrhundert aus Norwegen in Island eingeführt. Man fand sie nicht bei der ersten Ansiedlung trotz der Nähe des östlichen Grönland und der schwimmenden Eismassen. (Sartorius von Waltershausen, Physischgeographische Skizze von Island, 1847, S. 41.)
10 (S. 5) Zwischen dem Altai und dem Kuen-lun.
Das große Hochland, oder wie man gewöhnlich sagt, das Gebirgsplateau von Asien, welches die kleine Bucharei, die Dsungarei, Tibet, Tangut und das Mongolen-Land der Chalchas und Oloten einschließt, liegt zwischen dem 36. und 48. Grade der Breite wie zwischen den Meridianen von 79° und 116°. Irrig ist die Ansicht, nach der man sich diesen Teil von Inner-Asien als eine einzige ungeteilte Bergfeste, als eine buckelförmige Erhebung vorstellt: Kontinuierlich, wie die Hochebenen von Quito und Mexiko und zwischen sieben- und neuntausend Fuß über dem Meeresspiegel erhaben. Daß es in diesem Sinne kein ungeteiltes Gebirgsplateau von Inner-Asien gibt, habe ich bereits in meinen Untersuchungen über die Gebirge von Nord-Indien‹ entwickelt. (Humboldt, Premier Memoire sur les Montagnes de l’lnde, in den Annales de Chimie et de Physique, T. III, 1816, p. 303; second Memoire, T. XIV, 1820, p.5–55.)
Früh schon hatten meine Ansichten über die geographische Verbreitung der Gewächse und über den mittleren Wärmegrad, welcher zu gewissen Kulturen erforderlich ist, mir die Kontinuität eines großen Plateaus der Tartarei zwischen der Himalaja- und Altai-Kette sehr zweifelhaft gemacht. Man charakterisierte dieses Plateau noch immer so, wie es von Hippokrates (de aëre et aquis, § XCVI, p. 74) geschildert ward: „als die hohen und nackten Ebenen Skythiens, welche ohne von Bergen gekrönt zu sein, sich verlängern und bis unter die Konstellation des Bären erheben“. Klaproth hat das unverkennbare Verdienst gehabt, daß er uns zuerst in einem Teil Asiens, welcher mehr als Kaschmir, Βaltistan und die Tibetanischen heiligen Seen (Manasa [Manasarovar] und Ravanahrada [Ranasdal] zentral ist, die wahre Position und Verlängerung zweier großer und ganz verschiedener Gebirgsketten, des Kuen-lun und Tian-shan, kennen lehrte. Allerdings war bereits von Pallas die Wichtigkeit des Himmelsgebirges (Tian-shan) geahndet worden, ohne daß er seine vulkanische Natur kannte; aber, befangen in den zu seiner Zeit herrschenden Hypothesen einer dogmatischen und phantasiereichen Geologie, im festen Glauben an „strahlenförmig sich ausbreitende Ketten“, erblickte jener vielbegabte Naturforscher im Bogdo-Oola (Mons augustus, Kulminationspunkt des Tian-shan) „einen solchen Zentralknoten, von dem aus alle anderen Bergketten Asiens in Strahlen ausgehen und welcher den übrigen Kontinent beherrscht"!
Die irrige Meinung von einer einzigen, unermeßlichen Hochebene, welche ganz Zentral-Asien erfülle (Plateau de la Tartarie), ist in der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich entstanden. Sie war das Resultat historischer Kombinationen und eines nicht hinlänglich aufmerksamen Studiums des berühmten venezianischen Reisenden wie der naiven Erzählungen jener diplomatischen Mönche, welche im 13. und 14. Jahrhundert (Dank sei es der damaligen Einheit und Ausdehnung des Mongolen-Reiches!) fast das ganze Innere des Kontinents, von den Häfen Syriens und denen des Kaspischen Meeres bis zu dem vom Großen Ozean bespülten östlichen Gestade Chinas durchziehen konnten. Wenn die genauere Kenntnis der Sprache und der altindischen Literatur bei uns älter als ein halbes Jahrhundert wäre, so würde sich die Hypothese dieses Zentral-Plateaus auf dem weiten Raume zwischen dem Himalaja und dem südlichen Sibirien ohne Zweifel auch auf eine uralte und ehrwürdige Autorität gestützt haben. Das Gedicht Mahabharata scheint in dem geographischen Fragment Bhischmakanda den Meru nicht sowohl einen Berg als eine ungeheure Anschwellung des Bodens zu nennen, welche zugleich die Quellen des Ganges, des Bhadrasoma (Irtysch) und des gabelteiligen Oxus [Amu-darja] mit Wasser versorgt. Zu diesen physikalisch-geographischen Ansichten mischten sich in Europa Ideen aus anderen Gebieten, mythische Träume über den Ursprung des Menschengeschlechts. Die hohen Regionen, von denen sich die Wasser sollten zuerst zurückgezogen haben (den Hebungs-Theorien waren die meisten Geologen lange abhold), mußten auch die ersten Keime der Zivilisation empfangen haben. Systeme einer sintflutbewußten hebraisierenden Geologie, gegründet auf lokale Traditionen, begünstigten diese Annahmen. Der innige Zusammenhang zwischen Zeit und Raum, zwischen dem Beginn der sozialen Ordnung und der plastischen Beschaffenheit der Erdoberfläche, verlieh dem als ununterbrochen fingierten Hochland, dem Plateau der Tartarei, eine eigentümliche Wichtigkeit, ein fast moralisches Interesse. Positive Kenntnisse, welche die späte Frucht wissenschaftlicher Reisen und direkter Messungen waren, wie ein gründliches Studium der asiatischen Sprachen und Literatur, besonders der chinesischen, haben allmählich die Ungenauigkeit und die Übertreibungen in jenen wilden Hypothesen erwiesen. Die Gebirgsebenen (ὀϱοπέδια) von Zentral-Asien werden nicht mehr als die Wiege der menschlichen Gesittung und der Ursitz aller Wissenschaften und Künste betrachtet. Es ist verschwunden das alte Volk von Baillys Atlanten, von welchem d’Alembert den glücklichen Ausdruck braucht: „daß es uns alles gelehrt hat, ausgenommen seinen Namen und sein Dasein“. Die ozeanischen Atlanter wurden ja schon zur Zeit des Posidonius nicht minder spöttisch behandelt (Strabo, lib. II, p. 102, und lib. XIII, p. 598 Casaub.).
Ein beträchtlich hohes, aber in seiner Höhe sehr ungleiches Plateau zieht sich mit geringer Unterbrechung von SSW nach NNO vom östlichen Tibet gegen den Gebirgsknoten Kentei südlich vom Baikal-See unter den Namen Gobi, Scha-mo (Sandwüste), Scha-ho (Sandfluß) und Hanhai hin. Diese Anschwellung des Bodens, wahrscheinlich älter als die Bergketten, die sie durchschneidet, liegt, wie wir bereits oben bemerkt, zwischen 79° und 116° östlicher Länge von Paris. Sie ist, rechtwinklig auf ihre Längenachse gemessen, im Süden zwischen Ladak, Gertop und dem Großlama-Sitz Lhasa 180, zwischen Hami im Himmelsgebirge und der großen Krümmung des Hoangho an der Inschan Kette kaum 120; im Norden aber zwischen dem Khangai, wo einst die Weltstadt Karakorum lag, und der Meridiankette Khin-gan-Petscha (in dem Teil der Gobi, welchen man durchstreicht, um von Kiachta über Urga nach Peking zu reisen) an 190 geographische Meilen lang. Man kann der ganzen Anschwellung, die man sorgfältig von den östlichen weit höheren Bergketten unterscheiden muß, wegen ihrer Krümmungen annähernd das dreifache Areal von Frankreich zuschreiben. ›Die Karte der Bergketten und Vulkane von Central-Asien‹XXX, welche ich im Jahr 1839 entworfen habe, die aber erst 1843 erschienen ist, zeigt die hypsometrischen Verhältnisse zwischen den Bergketten und dem Gobi-Plateau am deutlichsten. Sie gründet sich auf die kritische Benutzung aller mir zugänglichen astronomischen Beobachtungen und der unermeßlich reichen orographischen Beschreibung, welche die chinesische Literatur darbietet, und welche Klaproth und Stanislas Julien auf meine Anregung untersucht haben. Meine Karte stellt in großen Zügen die mittlere Richtung und die Höhe der Bergketten bezeichnend, das Innere des asiatischen Kontinents dar von 30° bis 60° Breite zwischen den Meridianen von Peking nach Cherson. Sie weicht von allen bisher erschienenen wesentlich ab.
Die Chinesen haben einen dreifachen Vorteil gehabt, um in ihrer frühesten Literatur eine so beträchtliche Menge von orographischen Angaben über Hoch-Asien, besonders über die bisher dem Abendland so unbekannten Regionen zwischen dem Inschan, dem Alpensee Kuku-nor, und den Ufern des Ili und Tarim nördlich und südlich vom Himmelsgebirge zu sammeln. Diese drei Vorzüge sind: die Kriegsexpeditionen gegen Westen (schon unter den Dynastien der Han und der Tang, 122 Jahre vor unserer Zeitrechnung und im 9. Jahrhundert, gelangten Eroberer bis Ferghana und bis zu den Ufern des Kaspischen Meeres) samt den friedlichen Eroberungen der Buddha-Pilger, das religiöse Interesse, welches sich wegen der vorgeschriebenen, perodisch wiederkehrenden Opfer an gewisse hohe Berggipfel knüpfte, der frühzeitige und allgemein bekannte Gebrauch des Kompasses zur Orientierung der Berg- und Flußrichtungen. Dieser Gebrauch und die Kenntnis der Südweisung der Magnetnadel zwölf Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung hat den orographischen und hydrographischen Länderbeschreibungen der Chinesen ein großes Übergewicht über die ohnehin so seltenen der griechischen und römischen Schriftsteller gegeben. Strabo, der scharfsinnige Strabo, hat ebensowenig die Richtung der Pyrenäen wie die der Alpen und Apenninen gekannt. (Vgl. Strabo, lib. II, p. 71 und 128, lib. III, p. 137, lib. IV, p. 199 und 202, lib. V, p. 211 Casaub.)
Zum Tiefland gehören: Fast ganz Nord-Asien, im Nordwesten des vulkanischen Himmelsgebirges (Tian-shan), die Steppen im Norden des Altai und der Sayanischen [Sajan] Kette, die Länder, welche von dem Meridian-Gebirge BolorXXXI oder Bulyt-Dag (Wolken-Gebirge im uigurischen Dialekt und vom oberen Oxus [Amu-darja], dessen Quellen die buddhistischen Pilger Hiuen-thsang und Song-yun (518 und 629), Marco Polo (1277) und Lieutenant Wood (1838) im Pamerschen See Siri-kol (Lake Victoria) gefunden, sich gegen das Kaspische Meer, und vom Tenghiz- oder Balkasch-See durch die Kirgisen-Steppe gegen den Aral und das südliche Ende des Ural ausdehnen. Neben Gebirgsebenen von 6000 bis 10.000 Fuß Höhe wird es wohl erlaubt sein, den Ausdruck Tiefland für Bodenflächen zu gebrauchen, welche sich nur 200 bis 1200 Fuß über dem Meeresspiegel erheben. Die erste dieser Zahlen bezeichnet die Höhe der Stadt Mannheim, die zweite die von Genf und Tübingen. Will man das Wort Plateau, mit welchem in den neueren Geographien so viel Mißbrauch getrieben wird, auf Anschwellungen des Bodens ausdehnen, die einen kaum bemerkbaren Unterschied des Klimas und des Vegetationscharakters darbieten, so verzichtet die Physikalische Geographie, bei der Unbestimmtheit der nur relativ bedeutsamen Benennungen von Hoch- und Tiefland auf die Idee von dem Zusammenhange zwischen Höhen und Klima, zwischen dem Bodenrelief und der Temperaturabnahme. Als ich mich in der chinesischen Dsungarei zwischen der sibirischen Grenze und dem Saisan-(Dsaisang-)See befand, in gleicher Entfernung vom Eismeer und von der Ganges-Mündung, durfte ich wohl glauben, in Zentral-Asien zu sein. Das Barometer lehrte mich aber bald, daß die Ebenen, welche der obere Irtysch durchfließt, zwischen Ustkamenogorsk und dem chinesischen dsungarischen Posten Chonimailachu (das Schaf-Blöken) kaum 800 bis 1100 Fuß über dem Meeresspiegel erhoben liegen. Pansners ältere, aber erst nach meiner Expedition bekannt gemachte barometrische Höhenmessungen sind durch die meinigen bekräftigt. Beide widerlegen Chappes auf sogenannte Schätzungen von Flußgefällen gegründeten Hypothesen über die hohe Lage der Irtysch-Ufer im südlichen Sibirien. Selbst weiter hin in Osten liegt der Baikal-See ja erst 222 Toisen (1332 Fuß) hoch über dem Meere.
Um den Begriff der Relativität zwischen Tiefe und Hochland, die Stufenfolge der Bodenanschwellungen an wirkliche, durch genaue Messungen gesicherte Beispiele zu knüpfen, lasse ich hier in aufsteigender Reihung eine Tafel europäischer, afrikanischer und amerikanischer Hochebenen folgen. Mit diesen Zahlen ist dann zu vergleichen, was jetzt über die mittlere Höhe der asiatischen Ebenen (des eigentlichen Tieflandes) bekannt geworden ist:
| Plateau der Auvergne | 170 Toisen |
| Plateau von Baiern | 260 Toisen |
| Plateau von Castilien | 350 Toisen |
| Plateau von Mysore | 460 Toisen |
| Plateau von Caracas | 480 Toisen |
| Plateau von Popayan | 900 Toisen |
| Plateau um den See Tana (Abessinien) | 950 Toisen |
| Plateau vom Oranje-Fluß (Süd-Afrika) | 1000 Toisen |
| Plateau vom Axum (Abessinien) | 1100 Toisen |
| Plateau von Mexiko | 1170 Toisen |
| Plateau von Quito | 1490 Toisen |
| Plateau der Provinz de los Pastos | 1600 Toisen |
| Plateau der Umgegend des Titicaca-Sees | 2010 Toisen |
Kein Teil der sogenannten Wüste Gobi (sie enthält ja teilweise schöne Weideplätze) ist in seinen Höhenunterschieden so gründlich erforscht wie die fast 150 geographische Meilen breite Zone zwischen den Quellen der Selenga und der chinesischen Mauer. Ein sehr genaues barometrisches Nivellement wurde unter den Auspizien der Petersburger Akademie von zwei ausgezeichneten Gelehrten, dem Astronomen Georg Fuß und dem Botaniker Bunge, ausgeführt. Sie begleiteten im Jahr 1832 die Mission griechischer Mönche nach Peking, um dort eine der vielen von mir empfohlenen magnetischen Stationen einzurichtenXXXII. Die mittlere Höhe dieses Teils der Gobi beträgt nicht, wie man bisher aus den Messungen naher Berggipfel durch die Jesuiten Gerbillon und Verbiest übereilt geschlossen hatte, 7500 bis 8000 Fuß, sondern kaum 4000 Fuß (667Toisen). Der Boden der Gobi hat zwischen Erghi, Durma und Scharaburguna nicht mehr als 2400 Fuß (400 Toisen) Höhe über dem Meere. Er ist kaum 300 Fuß höher als das Plateau von Madrid. Erghi liegt, an der Mitte des Weges, in 45° 31′ Breite und 109° 4′ östlicher Länge. Dort ist eine Einsenkung von mehr als 60 Meilen Breite, eine von SW nach NO gerichtete Niederung. Eine alte mongolische Sage bezeichnet dieselbe als den Boden eines ehemaligen großen Binnenmeeres. Man findet dort Rohrarten und Salzpflanzen, meist dieselben Arten wie an den niedrigen Küsten des Kaspischen Meeres. In diesem Zentrum der Wüste liegen kleine Salzseen, deren Salz nach China ausgeführt wird. Nach einer sonderbaren, unter den Mongolen sehr verbreiteten Meinung wird der Ozean einst wiederkehren und sein Reich von neuem in der Gobi aufschlagen. Solche geologischen Träume erinnern an die chinesischen Traditionen vom Bitteren See im Inneren von Sibirien, deren ich an einem anderen Orte erwähnt habe (Humboldt, Asie centrale, T. II, p. 141; Klaproth, Asia polyglotta, p. 232).
Das von Bernier so enthusiastisch gepriesene und von Victor Jacquemont wohl allzu mäßig belobte Becken von Kaschmir hat ebenfalls zu großen hypsometrischen Übertreibungen Anlaß gegeben. Jacquemont fand durch eine genaue Barometer-Messung die Höhe des Wulur-Sees im Tal von Kaschmir unfern der Hauptstadt Srinagar 836 Toisen (5016 Fuß). Unsichere Bestimmungen durch den Siedepunkt des Wassers gaben dem Baron Carl von Hügel 910 T., dem Lieutenant Cunningham gar nur 790T. (Vgl. meine Asie centrale, T. III, p. 310, mit Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, Vol. X, 1841, p. 114.) Das Bergland Kaschmir, für das sich besonders in Deutschland ein so großes Interesse erhalten hat und dessen klimatische Annehmlichkeit durch viermonatigen Winterschnee in den Straßen von Srinagar (Carl von Hügel, Kaschmir, Bd. II, S. 196) etwas gemindert wird, liegt nicht, wie man gewöhnlich angibt, auf dem Hochrücken des Himalaja, sondern als ein wahres Kesseltal am südlichen Abhange desselben. Wo es mauerartig in Südwest durch den Pir Panjal von dem indischen Pandschab getrennt wird, krönen nach Vigne Basalt und Mandelstein-Bildungen die schneebedeckten Gipfel. Die letzte Bildung nennen die Eingeborenen sehr charakteristisch schischak deyu, d.i. des Teufels Pocken (Vigne, Travels in Kashmir, 1842, Vol. I, p. 237–293). Die Anmut seiner Vegetation wurde von jeher sehr ungleich geschildert, je nachdem die Reisenden von Süden, aus der üppigen, formenreichen Pflanzenwelt von Indien, oder von Norden, von Turkestan, Samarkand und Ferghana, kamen.
Auch über die Höhe von Tibet ist man erst in der neuesten Zeit zu einer klareren Einsicht gelangt, nachdem man lange so unkritisch das Niveau der Hochebene mit den Berggipfeln verwechselt hat, welche aus derselben aufsteigen. Tibet füllt den Raum zwischen den beiden mächtigen Gebirgsketten Himalaja und Kuen-lun aus; es bildet die Bodenanschwellung des Tals zwischen beiden Ketten. Das Land wird von den Eingeborenen und von den chinesischen Geographen von Osten gegen Westen in drei Teile geteilt. Man unterscheidet das Obere Tibet, mit der Hauptstadt Lhasa (wahrscheinlich in 1500 T. Höhe), das mittlere Tibet mit der Stadt Leh oder Ladak (1563 T.) und Klein-Tibet oder Baltist an, das Tibet der Aprikosen (Sari-Butan) genannt, wo Iskardo (985 T.), Gilgit, und südlich von Iskardo, aber auf dem linken Ufer des Indus, das von Vigne gemessene Plateau Deotsuh (1873 T.) liegen. Wenn man sämtliche Berichte, die wir bisher über die drei Tibet besitzen und welche in diesem Jahre durch die glänzende vom General-Gouverneur Lord Dalhousie begünstigte Grenzbestimmungs-Expedition reichlich werden vermehrt werden, ernst untersuchtXXXIII, so überzeugt man sich bald, daß die Region zwischen dem Himalaja und Kuen-lun gar keine ununterbrochene Hochebene ist, sondern von Gebirgsgruppen durchschnitten wird, die gewiß ganz verschiedenen Erhebungs-Systemen angehören. Eigentliche Ebenen finden sich sehr wenige. Die beträchtlichsten sind die zwischen Gertop, Daba, Schang-thung (Schäfer-Ebene), dem Vaterlande der Schal-Ziegen, und Schipke (1634 Τ.); die um Ladak, welche 2100 Toisen erreichen und nicht mit der Einsenkung, in der die Stadt liegt, verwechselt werden müssen; endlich das Plateau der heiligen Seen, Manasarovar und Rakasdal (wahrscheinlich 2345 Τ.), welches schon der Pater Antonio de Andrade 1625 besucht hatXXXIV. Andere Teile sind ganz mit zusammengedrängten Gebirgsmassen erfüllt: “rising“, wie ein neuer Reisender sagt, “like the waves of a vast Ocean“. Längs den Flüssen, dem Indus, dem Sutledj und dem Yaru-dzangbo-tschu, welchen man ehemals für identisch mit dem Buramputer (eigentlich Brahma-putra) hielt, hat man Punkte gemessen, welche nur zwischen 1050 und 1400 Toisen über dem Meere erhaben sind; so die tibetanischen Dörfer Pangi, Kunawur, Kelu und Murung. (Humboldt, Asie centrale, T.III, p. 281–325.) Aus vielen sorgfältig gesammelten Höhenbestimmungen glaube ich schließen zu dürfen, daß das Plateau von Tibet zwischen 71° und 83° östlicher Länge noch nicht 1800 Toisen (10.800 Fuß) mittlerer Höhe erreicht; dies ist kaum die Höhe der fruchtbaren Ebene von Cajamarca in Peru, aber 211 und 337 Toisen weniger als die Höhe des Plateaus von Titicaca und des Straßenpflasters der oberen Stadt Potosi (2137 T.).
Daß außerhalb des tibetanischen Hochlandes und der vorher in ihrer Begrenzung geschilderten Gobi Asien zwischen den Parallelen von 37° und 48°, da, wo man einst von einem unermeßlichen zusammenhängenden Plateau fabelte, beträchtliche Niederungen, ja eigentliche Tiefländer darbietet, lehrt die Kultur von Pflanzen, die zu ihrem Gedeihen bestimmte Wärmegrade erfordern. Ein aufmerksames Studium des Reisewerkes von Marco Polo, in dem des Weinbaues und der Produktion von Baumwolle in nördlichen Breitengraden erwähnt wird, hatte längst die Aufmerksamkeit des scharfsinnigen Klaproth auf diesen Gegenstand geheftet. In einem chinesischen Werke, das den Titel führt: Nachrichten über die neuerdings unterworfenen Barbaren‹ (Sin-kiang-wai-tan-kilio), hießt es: Das Land Aksu, etwas südlich von dem Himmelsgebirge, nahe bei den Flüssen, welche den großen Tarim-gol bilden, erzeugt „Weintrauben, Granaten und andere zahllose Früchte von ausgezeichneter Güte, auch Baumwolle (Gossypium religiosum), welche wie gelbe Wolken die Felder bedeckt. Im Sommer ist die Hitze ausnehmend groß, und im Winter gibt es hier wie in Turfan weder strenge Kälte noch starken Schneefall“. Die Umgegend von Khotan, Kaschgar und Jarkand entrichtet noch jetzt wie zu Marco Polos Zeit (il Milione di Marco Polo, pubbl. dal Conte Baldelli, T. I, p. 32 und 87) den Tribut in selbsterzeugter Baumwolle. In der Oase von Hami (Khamil), über 50 geographische Meilen östlich von Aksu, gedeihen ebenfalls Orangenbäume, Granaten und köstliche Weintrauben.
Die hier bezeichneten Kultur-Verhältnisse lassen auf eine geringe Bodenhöhe in ausgedehnten Gebieten schließen. Bei einer so großen Entfernung von den Küsten, bei dieser so östlichen, die Winterkälte vermehrenden Lage könnte ein Plateau, welches die Höhe von Madrid oder München erreichte, wohl sehr heiße Sommer, aber schwerlich unter 43° und 44° Breite überaus milde, fast schneelose Winter haben. Ich sah, wie am Kaspischen Meere, 78 Fuß unter dem Niveau des Schwarzen Meeres (zu Astrachan, Br. 46° 21′), eine große Sommerhitze die Kultur des Weinstocks begünstigt; aber die Winterkälte steigt dort auf −20° bis −25 ° cent. Auch wird die Weinrebe seit November zu großer Tiefe in die Erde versenkt. Man begreift, daß Kulturpflanzen, welche gleichsam nur im Sommer leben, wie der Wein, die Baumwollstaude, der Reis und die Melone, zwischen 40° und 44° Breite auf Hochebenen von einer Erhebung von mehr denn 500Toisen noch mit Erfolg gebaut und durch die Wirkung der strahlenden Wärme begünstigt werden können; aber wie würden die Granatbäume Aksus, die Orangen von Hami, welche schon der P. Grosier als eine ausgezeichnete Frucht anrühmt, während eines langen und strengen Winters (notwendiger Folge großer Bodenanschwellung) ausdauern können? (Asie centrale, T. II, p. 48–52 und 429.) Carl Zimmermann (in der gelehrten Analyse seiner Karte von Inner-Asien, 1841, S. 99) hat es überaus wahrscheinlich gemacht, daß das Tarim-Gesenke, d. i. die Wüste zwischen den Bergketten Tian-shan und Kuenlun, wo der Steppenfluß Tarim sich in den ehemals als Alpensee geschilderten See Lop-nor ergoß, kaum 1200 Fuß über dem Meeresspiegel erhoben ist, also nur die doppelte Höhe von Prag erreicht. Sir Alexander Burnes gibt die von Buchara auch nur zu 186 Toisen (1116 Fuß) an. Es ist sehnlichst zu wünschen, daß alle Zweifel über die Plateau-Höhe Mittel-Asiens südlich von 45° Breite endlich durch direkte Barometer-Messungen oder, was freilich mehr Vorsicht erheischt, als man gewöhnlich dabei anwendet, durch Bestimmung des Siedepunktes beseitigt werden mögen. Alle Berechnungen über den Unterschied zwischen der ewigen Schneegrenze und dem Maximum der Höhe der Weinkultur unter verschiedenen Klimaten beruhen auf zu komplizierten und zu ungewissen Elementen.
Um hier in gedrängter Kürze zu berichtigen, was in der letzten Ausgabe dieses Werkes über die großen Bergsysteme gesagt worden ist, welche Inner-Asien durchschneiden, füge ich folgende allgemeine Übersicht hinzu. Wir beginnen mit den vier Parallelketten, die ziemlich regelmäßig von Osten nach Westen gerichtet und einzeln, doch selten, gitterartig miteinander verbunden sind. Die Abweichungen der Richtung deuten wie in dem westlichen europäischen Alpengebirge auf Verschiedenheit der Erhebungs-Epochen hin. Nach den vier Parallelketten (dem Altai, Tian-shan, Kuen-lun und Himalaja) nennen wir als Meridianketten: den Ural, den Bolor, den Khingan, und die chinesischen Ketten, welche bei der großen Krümmung des tibetanischen und assam-birmanischen Dzangbo-tschu [Irawadi] von Norden nach Süden streichen. Der Ural trennt Nieder-Europa von Nieder-Asien. Letzteres ist bei Herodot (ed. Schweighäuser, T. V, p. 204), ja schon bei Pherecydes von Syros, ein skythisches (sibirisches) Europa, das alle Länder im Norden vom Kaspischen Meer und des nach Westen fließenden Jaxartes [Syr-darja] in sich begreift und demnach als eine Fortsetzung von unserem Europa, „in der Länge sich über Asien hinziehend“, betrachtet werden kann.
1. Das große Gebirgssystem des Altai (der Goldberg schon bei Menander von Byzanz, Geschichtsschreiber des 7. Jahrhunderts; Altai-alin mongolisch, Kin-schan chinesisch) erstreckt sich zwischen 50° und 52,5° nördlicher Breite und bildet die südliche Grenze der großen sibirischen Niederung, von den reichen Silbergruben des SchlangenbergesXXXV und dem Zusammenfluß der Uba und des Irtysch an bis zum Meridian des Baikal-Sees. Die Abteilungen und Namen Großer und Kleiner Altai, aus einer dunklen Stelle des Abulghasi entnommen, sind ganz zu vermeiden (Asie centrale, T. I, p. 247). Das Gebirgssystem des Altai begreift in sich: a) den eigentlichen oder Kolywanschen Altai, der ganz dem russischen Zepter unterworfen ist, westlich von den kreuzenden Meridian-Spalten des Telezkischen Sees; in der vor-historischen Zeit wahrscheinlich das Ostufer des großen Meeresarmes, durch welchen in der Richtung der noch vorhandenen Seegruppen Aksakal-Barbi und Sary-Kupa (Asie centrale, T. II, p. 138) das aralo-kaspische Becken mit dem Eismeer zusammenhing; b) östlich von den Telezkischen Meridianketten die Sayanische [Sajan], Tangnu- und Ulangom- oder Malakha-Ketten: alle ziemlich parallel von Westen nach Osten streichend. Der Tangnu, welcher sich in das Becken der Selenga verliert, hat seit sehr alter Zeit die Völkerscheide zwischen dem türkischen Stamm im Süden und den Kirgisen (Hakas identisch mit Σάϰαι) im Norden gebildet (Jacob Grimm, Gesch. der deutschen Sprache, 1848, T. I, S. 227). Er ist der Ursitz der Samojeden oder Soyoten, welche bis zum Eismeer wanderten und welche man lange Zeit in Europa als ein ausschließlich polares Küstenvolk betrachtete. Die höchsten Schneegipfel des Kolywanschen Altai sind die Bielucha- und Katunia-Säulen. Letztere erreichen indes nur 1720 Toisen, die Höhe des Ätna [3322m]. Das Daurische Hochland [Daurengebirge], zu dem der Bergknoten Kemtei gehört und an dessen östlichem Rande der Jablonoi Chrebet [Jablonowyjgebirge] hinstreicht, scheidet die Baikal- und Amur-Gesenke.
2. Das Gebirgssystem des Tian-shan, die Kette des Himmelsgebirges, der Tengri-tagh der Türken (Tukiu) und der ihnen stammverwandten Hiongnu, übertrifft in seiner Ausdehnung von Westen nach Osten achtmal die Länge der Pyrenäen. Jenseits, d. i. westlich von seiner Durchkreuzung mit der Meridiankette des Bolor und Kosyurt, führt der Tianshan die Namen Asferah und Aktagh, ist metallreich und von offenen Spalten durchschnitten, welche heiße, bei Nacht leuchtende, zur Salmiak-Gewinnung benutzte Dämpfe ausstoßen (Asie centrale, T. II, p. 18–20). Östlich von der durchsetzenden Bolor- und Kosyurt-Kette folgen im Tian-shan der Kaschgar-Paß (Kaschgar-dawan); der Gletscher-Paß Djeparle, welcher nach Kutsche und Aksu in das Tarim-Becken führt; der Vulkan Pe-shan, welcher Feuer speit und Lavaströme wenigstens bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung ergossen; die große schneebedeckte Massenerhebung Bogdo-Oola; die Solfatare von Urumtchi, welche Schwefel und Salmiak (nao-scha) liefert, in einer steinkohlenreichen Gegend; der Vulkan von Turfan (Vulkan von Hotscheu oder Bischbalik), fast in der Mitte zwischen den Meridianen von Turfan (Kune-Turpan) und Pidjan, noch gegenwärtig entzündet. Die vulkanischen Ausbrüche des Tian-shan reichen nach chinesischen Geschichtsschreibern bis in das Jahr 89 n. Chr. hinauf, als die Hiongnu von den Quellen des Irtysch bis Kutsche und Kharaschar von den Chinesen verfolgt wurden (Klaproth, Tableaux hist. de l’Asie, p. 108). Der chinesische Heerführer Teu-hian überstieg den Tian-shan und sah „die Feuerberge, deren Steinmassen schmelzen und viele Li weit fließen".
Die große Entfernung der Vulkane Inner-Asiens von den Meeresküsten ist ein merkwürdiges und isoliertes Phänomen. Abel Rémusat hat in einem Briefe an Cordier (Annales des Mines, T. V, 1820, p. 137) zuerst die Aufmerksamkeit der Geologen auf diese Entfernung geleitet. Sie ist z.B. für den Vulkan Pe-shan gegen Norden bis zum Eismeer am Ausfluß des Ob 382, gegen Süden bis zur Mündung des Indus und Ganges 378 geographische Meilen. So zentral sind jene Feuerausbrüche im asiatischen Kontinent. Gegen Westen ist der Pe-shan vom Kaspischen Meer im Golf von Karabugas 340, vom östlichen Ufer des Aral-Sees 255 Meilen. Die tätigen Vulkane der Neuen Welt boten bisher die auffallendsten Beispiele von großer Entfernung von den Meeresküsten dar. Bei dem mexikanischen Popocatepetl beträgt indes dieser Abstand nur 33, bei den südamerikanischen Vulkanen Sangai, Tolima und de la Fragua 23, 26 und 39 geographische Meilen. Es sind in dieser Angabe alle ausgebrannten Vulkane, alle Trachytberge ausgeschlossen, welche in keiner permanenten Verbindung mit dem Inneren der Erde stehen (Asie centrale, T. II, p. 16–55, 69–77 und 341–356). Östlich von dem Vulkan von Turfan und der fruchtbaren, obstreichen Oase von Hami verschwindet die Kette des Tian-shan in der großen von SW nach NO gerichteten Anschwellung der Gobi. Die Unterbrechung dauert über 9½ Längengrade; aber jenseits der quer durchsetzenden Gobi bildet die etwas südlicher liegende Kette des In-shan (Silber-Gebirges), von Westen nach Osten fast bis zu den Küsten des Stillen Ozeans bei Peking, nördlich vom Pe-tscheli, hinstreichend, eine Fortsetzung des Tian-shan. Wie der In-shan als eine östliche Fortsetzung der Spalte zu betrachten ist, auf der der Tian-shan emporgestiegen, so kann man geneigt sein in dem Kaukasus eine westliche Verlängerung jenseits der großen aralokaspischen Niederung oder des Gesenkes von Turan zu erkennen. Der mittlere Parallel oder die Erhebungs-Achse des Thian-shan oszilliert zwischen 40°⅔ und 43° Breite; der des Kaukasus nach der Karte des russischen Generalstabes (OSO – WNW streichend) zwischen 41° und 44° (Baron von Meyerdorff im Bulletin de la Société géologique de France, T. IX, 1837–1838, p. 230). Unter den vier Parallelketten, welche ganz Asien durchziehen, ist der Tian-shan die einzige, in der bisher kein Gipfel gemessen ist.
3. Das Gebirgssystem des Kuen-lun (Kurkun oder Kulkun) bildet, wenn man den Hindukusch und seine westliche Verlängerung im persischen Elbrus und Demawend hinzurechnet, mit der amerikanischen Kordillere der Anden die längste Erhebungslinie auf unserem Planeten. Wo die Meridiankette des Bolor die Kette des Kuen-lun rechtwinklig durchsetzt, nimmt letzterer den Namen des Zwiebel-Gebirges (Tsungling) an; ja ein Teil des Bolor selbst am inneren östlichen Kreuzungswinkel wird so genannt. Tibet im Norden begrenzend, streicht der Kuen-lun sehr regelmäßig west-östlich in 36° Breite fort; im Meridian von Lhasa findet eine Unterbrechung statt, durch den mächtigen Gebirgsknoten veranlaßt, welcher das in der mythischen Geographie der Chinesen so berühmte Sternenmeer (Sing-so-hai) und den Alpensee Kuku-nor umgibt. Die etwas nördlicher auftretenden Ketten des Nan-shan und Kilianshan sind fast als östliche Verlängerung des Kuen-lun zu betrachten. Sie reichen bis an die chinesische Mauer bei Liang-tscheu. Westlich von der Durchkreuzung des Bolor und Kuen-lun (Tsung-ling) beweist, wie ich zuerst glaube erwiesen zu haben (Asie centrale, T. I, p. XXII und 118–159, T. II, p. 431–434 und 465), die gleichmäßige Richtung der Erhebungs-Achsen (Ost-West im Kuen-lun und Hidukusch, dagegen Südost-Nordwest im Himalaja), daß der Hindukusch eine Fortsetzung des Kuen-lun und nicht des Himalaja ist. Vom Taurus in Lykien bis Kafiristan, in einer Erstreckung von 45 Längengraden, folgt die Kette dem Parallel von Rhodos, dem Diaphragma des Dicäarch. Die großartige geologische Ansicht des Eratosthenes (Strabo, lib. II, p. 68, lib. XI, p. 490 und 511, lib. XV, p. 689), welche von Marinus aus Tyrus und Ptolemäus weiter ausgeführt ward und nach welcher „die Fortsetzung des Taurus in Lykien sich durch ganz Asien bis nach Indien in einer und derselben Richtung erstreckt“, scheint zum Teil auf Vorstellungen gegründet, die vom Pandschab zu den Persern und Indern gelangt sind. „Die Brahmanen behaupten“, sagt Cosmas Indicopleustes in seiner christlichen Topographie (Montfaucon, Collectio nova Patrum, T. II, p. 137), „daß eine Schnur, von Tzinitza (Thinä) quer durch Persien und Romanien gelegt, genau die Mitte der bewohnten Erde abteile“. Es ist merkwürdig, wie schon Eratosthenes angibt, daß diese größte Erhebungs-Achse der Alten Welt in den Parallelen von 35 ½° und 36° quer durch das Becken (die Senkung) des Mittelländischen Meeres nach den Säulen des Herkules hinweist (vgl. Asie centrale, T. I, p. XXIII und 122–138, T. II, p. 430–434, mit Kosmos, Bd. II, S. 222 und 438). Der östlichste Teil des Hindukusch ist der Paropanisus der Alten, der indische Kaukasus der Begleiter des großen Makedoniers. Der jetzt von den Geographen so oft gebrauchte Name Hindukusch kommt, wie man schon aus des Arabers Ibn Batuta Reisen (Travels, p. 97) ersieht, nur einem einzigen Bergpaß zu, auf dem die Kälte oft viele indische Sklaven tötete. Auch der Kuen-lun bietet in großer Entfernung, mehrere hundert Meilen von der Meeresküste, Feuerausbrüche dar. Aus der Höhle des Berges Schin-khieu brechen Flammen aus, die weit umher gesehen werden (Asie centrale, Τ. II, p. 427 und 483, nach einem von meinem Freunde Stanislas Julien übersetzten Texte des Yuenthong-ki). Der höchste im Hindukusch gemessene Gipfel nordwestlich von Dschellalabad hat 3164 Toisen Höhe über dem Meere; westlich gegen Herat erniedrigt sich die Kette bis 400 T., bis sie nördlich von Teheran im Vulkan von Demawend wieder bis 2295 T. ansteigt.
4. Das Gebirgssystem des Himalaja. Seine Normal-Richtung ist ostwestlich, wie man sie von 79° bis 95° gegen Osten, von dem Bergkoloß Dhaulagiri (4390 Toisen) [8172m] an, auf 15 Längengrade, bis zum Durchbruch des lange problematischen Dzangbo-tschu (Irawadi nach Dalrymple und Klaproth) und bis zu den Meridianketten verfolgt, welche das ganze westliche China bedecken und besonders in den Provinzen Sse-tschuan [Si-chuan], Hu-kuang und Kuang-si den großen Gebirgsstock der Quellen des Kiang bilden. Nächst dem Dhaulagiri ist nicht, wie man bisher geglaubt, der östlichere Pik Schamalari, sondern der Kanchenjunga der Kulminationspunkt dieses ost-westlich streichenden Teils des Himalaja. Der Kanchenjunga, im Meridian von Sikkim zwischen Butan und Nepal, zwischen dem Schamalari (3750 T.?) und dem Dhaulagiri, hat 4406 Toisen oder 26.438 Pariser Fuß. Er ist erst in diesem Jahre genau trigonometrisch gemessen worden; und da dieselbe, mir aus Ostindien zugekommene Notiz bestimmt angibt, „eine ebenfalls neue Messung des Dhaulagiri lasse diesem den ersten Rang unter allen Schneebergen des Himalaja“, so muß der Dhawalagiri notwendig eine größere Höhe haben als die von 4390 T. oder 26.340 Pariser Fuß, welche man ihm bisher zugeschrieben. (Brief des kenntnisvollen Botanikers der letzten Expedition nach dem Südpol, Dr. Jos. Hooker, aus Darjeeling, 25. Juli 1848.)XXXVI Der Wendepunkt in der Richtung ist unfern des Dhawalagiri in 79° östlicher Länge von Paris. Von da gegen Westen streicht der Himalaja nicht mehr von Osten nach Westen, sondern von SO nach NW, als ein mächtiger anscharender Gang sich zwischen Mozufer-abad und Gilgit, im Süden von Kafiristan, mit einem Teil des Hindukusch verbindend. Eine solche Wendung und Veränderung in dem Streichen der Erhebungs-Achse des Himalaja (von O–W in SO bis NW) deutet gewiß wie in der westlichsten Region unseres europäischen Alpengebirges auf eine andere Alters-Epoche der Erhebung. Der Lauf des oberen Indus von den heiligen Seen Manasarovar und Rahasdal (2345 T.), in deren Nähe der große Fluß entspringt, bis Iskardo und zu dem von Vigne gemessenen Plateau von Deotsuh (2032 T.) befolgt im tibetanischen Hochlande dieselbe nordwestliche Richtung des Himalaja. In diesem erheben sich der längst schon wohlgemessene Djawahir 4027 Toisen, und das ganz windlose Gebirgstal von Kaschmir, am Wulur-See [bei Srinagar], der alle Winter gefriert und in dem nie sich eine Welle kräuselt, nur 836 T. hoch.
Nach den vier großen Gebirgssystemen Asiens, welche in ihrem geognostischen Normal-Charakter Parallelketten bilden, ist noch die lange Reihe alternierender Meridian-Erhebungen zu nennen, die vom Kap Comorin, der Insel Ceylon gegenüber, bis zum Eismeer in ihrer Stellung alternierend zwischen 64° und 75° Länge von SSO nach NNW streichen. Zu diesem System der Meridianketten, deren Alternierung an verschobene Gangmassen erinnert, gehören die Ghats, die Soliman-Kette, der Paralasa, der Bolor und der Ural. Die Unterbrechung des Reliefs (der Meridian-Erhebungen) ist so gestaltet, daß jede neue Kette erst in einem Breitengrad anhebt, welchen die vorhergehende noch nicht erreicht hat, und daß alle abwechselnd entgegengesetzt alternieren. Die Wichtigkeit, welche die Griechen wahrscheinlich nicht vor dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf diese Meridianketten gelegt, hatten Agathodämon und Ptolemäus (tab. VII und VIII) veranlaßt, sich den Bolor unter dem Namen Imaus als eine Erhebungs-Achse zu denken, die bis 62° Breite, bis in die Niederung des unteren Irtysch und Ob, reichte (Asic centrale, T. I, p. 138, 154 und 198, T. II, p. 367.)
Da die senkrechte Höhe der Berggipfel über dem Meere, so unwichtig auch in dem Auge des Geognosten das Phänomen der stärkeren oder schwächeren Faltung der Rinde einer Planetenkugel ist, noch immer, wie alles schwer Erreichbare, ein Gegenstand volkstümlicher Neugier ist, so wird folgende historische Notiz über die allmählichen Fortschritte der hypsometrischen Kenntnisse hier einen schicklichen Platz finden. Als ich 1804 nach einer Abwesenheit von vier Jahren nach Europa zurückkehrte, war noch kein hoher Schneegipfel von Asien (im Himalaja, im Hindukusch oder in dem Kaukasus) mit einiger Genauigkeit gemessen. Ich konnte meine Bestimmungen der Höhen des ewigen Schnees in den Kordilleren von Quito und den Gebirgen von Mexiko mit keiner ostindischen vergleichen. Die wichtige Reise von Turner, Davis und Saunders nach dem Hochlande von Tibet fällt freilich in das Jahr 1783; aber der gründlich unterrichtete Colebrooke bemerkte mit Recht, daß die von Turner angegebene Höhe des Schamalari (Br. 28° 5′, Länge 87° 8′, etwas nördlich von Tassisudon) auf ebenso schwachen Fundamenten beruhe wie die sogenannten Messungen der von Patna und Kafiristan gesehenen Höhen durch den Oberst Crawford und den Lieutenant Macartney. (Vgl. Turner in den Asiat. Researches, Vol. XII, p. 234, mit Elphinstone, Account of the Kingdom of Caubul, 1815, p. 95, und Francis Hamilton, Account of Nepal, 1819, p. 92.) Erst die vortrefflichen Arbeiten von Webb, Hodgson, Herbert und der Brüder Gerard haben ein großes und sicheres Licht über die Höhe der kolossalen Gipfel des Himalaja verbreitet; doch war 1808 die hypsometrische Kenntnis der ostindischen Gebirgskette noch so ungewiß, daß Webb an Colebrooke schreiben konnte: „Die Höhe des Himalaja bleibt immer noch problematisch. Allerdings finde ich die Gipfel, die man von der Hochebene von Rohilkand sieht, 21.000 engl. Fuß (3284 T.) höher als diese Ebene; aber wir kennen nicht die absolute Höhe über der Meeresfläche.“
Erst in dem Anfang des Jahres 1820 verbreitete sich in Europa die Nachricht, daß der Himalaja nicht nur weit höhere Gipfel als die Kordilleren habe, sondern daß auch Webb im Paß von Niti und Moorcroft in dem tibetanischen Plateau von Daba und der heiligen Seen in Höhen, welche die des Montblanc weit übertreffen, schöne Kornfelder und fruchtbare Weiden gefunden hätten. Diese Nachricht wurde in England mit großem Unglauben aufgenommen und durch Zweifel über den Einfluß der Strahlenbrechung widerlegt. Ich habe den Ungrund dieser Zweifel in zwei in den ›Annales de Chimie et de Physique‹ abgedruckten Abhandlungen ›Sur les montagnes de l’Inde‹ dargetan. Der Tiroler Jesuit P. Tiefenthaler, der 1766 bis in die Provinzen Kemaun und Nepal vordrang, hatte schon die Wichtigkeit des Dhaulagiri erraten. Man liest auf seiner Karte: „Montes Albi, qui Indis Dolaghir, nive obsiti.“ Desselben Namens bedient sich auch immer Kapitän Webb. Bis die Messungen des Djawahir (Br. 30° 22′ L. 77° 36′, Höhe 4027 Toisen) und des Dhaulagiri (Br. 28° 40′, L. 80° 59′, Höhe 4390Toisen?) [8172m] in Europa bekannt wurden, ward noch überall der Chimborazo (3350 Toisen nach meiner trigonometrischen Messung; Recueil d’Observations astronomiques, T. I, p. LXXIII) [6310m] für den höchsten Gipfel der Erde gehalten. Der Himalaja schien also damals, je nachdem man die Vergleichung mit dem Djawahir oder mit dem Dhaulagiri anstellte, 676 Toisen (4056 Pariser Fuß) oder 1040 Toisen (6240 Pariser Fuß) höher als die Kordilleren. Durch Pentlands südamerikanische Reisen in den Jahren 1827 und 1838 wurde die Aufmerksamkeit (Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1830, p. 320 und 323) auf zwei Schneegipfel des oberen Peru östlich vom See von Titicaca geheftet, welche den Chimborazo um 598 und 403 Toisen (3588 und 2418 Par. Fuß) an Höhe übertreffen sollten. Es ist bereits oben (S. 38, Anm. 5) erinnert worden, daß die neuesten Berechnungen der Messungen des Sorata und Illimani das Irrige dieser hypsometrischen Behauptung erwiesen haben. Der Dhaulagiri, an dessen Abhang im Flußtal Ghandaki die im brahmanischen Kultus so berühmten Salagrana-Ammoniten (Symbole der Muschel-Inkarnation Wischnus) gesammelt werden, bezeugt also noch immer einen Höhenunterschied beider Kontinente von mehr als 6200 Par. Fuß.
Man hat die Frage aufgeworfen, ob hinter der südlichsten bisher mehr oder weniger vollkommen gemessenen Bergkette nicht noch größere Höhen liegen. Der Oberst Georg Lloyd, welcher 1840 die wichtigen Beobachtungen des Kapitän Alexander Gerard und dessen Bruders herausgegeben hat, hegt die Meinung, daß in dem Teil des Himalaja, welchen er etwas unbestimmt “the Tartaric Chain“ nennt (also wohl im nördlichen Tibet gegen den Kuen-lun hin, vielleicht im Kailas [6714m] der heiligen Seen oder jenseits Leh), Gipfel zu 29.000 bis 30.000 englischen Fußen (4534 bis 4690 Toisen), also noch ein- oder zweitausend englische Fuß höher als der Daulagiri, ansteigen (Lloyd und Gerard, Tour in the Himalaya, 1840, Vol. I, p. 143 und 312; Asie centrale, Τ. III, p. 324). So lange wirkliche Messungen fehlen, läßt sich nicht über solche Möglichkeiten entscheiden, da das Kennzeichen, nach welchem die Eingeborenen von Quito lange vor der Ankunft von Bouguer und La Condamine den Gipfel des Chimborazo für den Kulminationspunkt erkannten, d.i. das höhere Hineinreichen in die Schneeregion, in der gemäßigten Zone von Tibet, wo die Wärmestrahlung der Hochebene so wirksam ist und wo die untere Grenze des ewigen Schnees nicht wie unter den Tropen regelmäßig eine Linie gleichen Niveaus darbietet, sehr trügerisch wird. Die größte Höhe, zu der Menschen am Abhange des Himalaja über der Meeresfläche gelangt sind, ist 3035Toisen oder 18.210 Pariser Fuß. Diese Höhe erreichte der Kapitän Gerard mit 7 Barometern, wie wir schon oben bemerkt, am Berge Tarhigang, etwas nordwestlich von Schipke (Colebrooke in den Transactions of the Geological Society, Vol. VI, p. 411). Es ist zufällig fast dieselbe Höhe, auf die ich selbst (23. Juni 1802) und dreißig Jahre später (16. Dez. 1831) mein Freund Boussingault am Abhange des Chimborazo gelangt waren. Der unerreichte Gipfel des Tarhigang ist übrigens 197 Toisen höher als der Chimborazo.
Die Pässe, welche über den Himalaja von Hindostan in die chinesische Tartarei oder vielmehr in das westliche Tibet führen, besonders zwischen den Flüssen Buspa und Schipke oder Langzing Khampa, haben 2400 bis 2900Toisen Höhe. In der Andenkette habe ich den Paß von Assuai zwischen Quito und Cuenca, an der Ladera de Cadlud, auch 2428 Toisen hoch gefunden. Ein großer Teil der Bergebenen von Inner-Asien würde das ganze Jahr hindurch in ewigem Schnee und Eis vergraben liegen, wenn nicht durch die Kraft der strahlenden Wärme, welche die tibetanische Hochebene darbietet, durch die ewige Heiterkeit des Himmels, die Seltenheit der Schneebildung in der trockenen Luft und die dem östlichen Kontinental-Klima eigene starke Sonnenhitze am nördlichen Abhange des Himalaja die Grenze des ewigen Schnees wundersam gehoben wäre: vielleicht bis zu 2600 Toisen Höhe über der Meeresfläche. Gerstenäcker (von Hordeum hexastichon) sind in Kunawur bis 2300 T., eine andere Varietät der Gerste, Ooa genannt und dem Hordeum coeleste verwandt, noch viel höher gesehen worden. Weizen gedeiht im tibetanischen Hochlande vortrefflich bis 1880Toisen. Am nördlichen Abhänge des Himalaja fand Kapitän Gerard die obere Grenze hoher Birken-Waldung erst in 2200 Toisen; ja kleines Gesträuch, das den Einwohnern zum Heizen in den Hütten dient, geht unter 30¾ und 31° nördlicher Breite bis 2650 Toisen, also fast 200 Toisen höher als die untere Schneegrenze unter dem Äquator. Es folgt aus den bisher gesammelten Erfahrungen, daß am nördlichen Abhange in Mittelzahlen die untere Schneegrenze wenigstens auf 2600 T. Höhe anzunehmen ist, während am südlichen Abhange des Himalaja die Schneegrenze bis 2030 Toisen herabsinkt. Ohne diese merkwürdige Verteilung der Wärme in den oberen Luftschichten würde die Bergebene des westlichen Tibets Millionen von Menschen unbewohnbar sein. (Vgl. meine Untersuchung der Schneegrenze an beiden Abhängen des Himalaja in der Asie centrale, T.II, p. 435–437, T.III, p. 281–326, und im Kosmos, Bd. I, S. 483.)
Ein Brief, den ich soeben von Herrn Joseph Hooker, der mit Pflanzen-Geographie, meteorologischen und geognostischen Untersuchungen zugleich beschäftigt ist, aus Indien erhalte, meldet folgendes: „Herr Hodgson, den wir hier für den Geographen halten, welcher am gründlichsten mit den hypsometrischen Verhältnissen der Schneeketten vertraut ist, erkennt die Richtigkeit Ihrer in dem 3. Teil der ›Asie centrale‹ aufgestellten Behauptung über die Ursache der ungleichen Höhe des ewigen Schnees an dem nördlichen und südlichen Abhang der Himalaja-Kette vollkommen an. Wir sahen die Schneegrenze jenseits des Sutledj (in the transsutledge region) in 36° Breite oft erst in der Höhe von 20.000 engl. Fuß (18.764 Par. Fuß), wenn in den Pässen südlich vom Brahmaputra zwischen Assam und Burma in 27° Breite, wo die südlichsten Schneeberge Asiens liegen, die ewige Schneegrenze bis 15.000 engl. Fuß (14.073 Par. Fuß) herabsinkt.“ Man muß, glaube ich, zwischen den Extremen und den mittleren Höhen unterscheiden; aber in beiden offenbart sich deutlichst der einst bestrittene Unterschied zwischen dem tibetanischen und indischen Abfall.