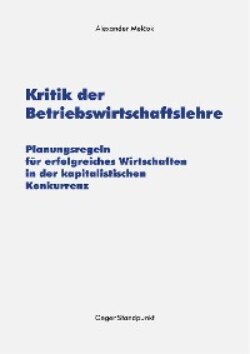Читать книгу Kritik der Betriebswirtschaftslehre - Alexander Melčok - Страница 5
I. Die Herleitung der betrieblichen Gewinnmaximierung aus einem Naturgesetz des Produzierens und einer menschennatürlichen Motivation 1. Der Kampf gegen die ewige Knappheit
ОглавлениеDie BWL führt ihren Gegenstand folgendermaßen ein:
„Ein Betrieb ist eine Wirtschaftseinheit, die in den Beschaffungs-, den Absatz- und den Kapitalmarkt eingebettet ist: Am Beschaffungsmarkt werden Produktionsfaktoren eingekauft, die zu Gütern oder Dienstleistungen verarbeitet und danach am Absatzmarkt abgesetzt werden. Der betriebliche Prozess der Leistungserstellung und -verwertung bedarf sorgfältiger Planung. Das hat folgenden Grund: Die menschlichen Bedürfnisse sind praktisch unbegrenzt. Die zur Bedürfnisbefriedigung geeigneten Mittel, also die Güter und Dienstleistungen, stehen dagegen nicht in unbegrenztem Umfang zur Verfügung, sondern sind von Natur aus knapp. Diese naturgegebene Knappheit der Ressourcen, d.h. das Spannungsverhältnis zwischen Bedarf einerseits und Bedarfsdeckung andererseits, zwingt die Menschen zu wirtschaften.“ (I / S. 4)
Der Autor zitiert Gegebenheiten aus der Marktwirtschaft: Auf Beschaffungs- und Kapitalmärkten werden von Betrieben Produktionsfaktoren eingekauft, die damit erstellten Güter und Dienstleistungen werden auf Absatzmärkten verkauft. Klar ist soweit, dass er über Betriebe redet, wie man sie aus der Marktwirtschaft kennt. Über deren Geschäft erfährt der Student der BWL erst einmal, dass es mit Sorgfalt geführt sein will, weil es da um nicht weniger als die Lösung eines Grundproblems des menschlichen Daseins gehe. Was der Mann der Wissenschaft als Grund für die Notwendigkeit sorgfältiger Planung des betrieblichen Geschehens angibt, hat freilich ersichtlich nichts zu tun mit dem Treiben von Betrieben, die mit Einkaufs- und Verkaufspreisen rechnen, auf allen möglichen Märkten agieren und über den Einsatz von Produktionsfaktoren entscheiden. Es ist jenseits aller marktwirtschaftlichen Realitäten angesiedelt und eröffnet einen tiefen Einblick in die Ur- und Abgründe der Natur im Allgemeinen, der menschlichen im Besonderen: Von einer „naturgegebenen Knappheit der Ressourcen“ will der Lehrbuchverfasser wissen. Dieses Fundamentalprinzip bedarf für ihn keiner weiteren Erläuterung. Er setzt es als Dogma in die Welt wie die Kirche die Erbsünde und schenkt sich jede Mühe, bei dieser Knappheit, mit der die Betriebe sich so fundamentalistisch befassen müssen, überhaupt noch zwischen „Gütern und Dienstleistungen“, also den Produkten betrieblicher Tätigkeit – die, wie der Name schon sagt, produziert werden, also vermehrt werden können –, und solchen Ressourcen zu unterscheiden, bei denen allenfalls vorstellbar ist, dass sie naturgegebenerweise nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehen und irgendwann irgendwo ausgehen könnten. Dieser Naturkonstante ‚Knappheit‘ setzt er ein zweites, wunderbar gegensinniges Prinzip gegenüber, dem zufolge die „menschlichen Bedürfnisse praktisch unbegrenzt“ sein sollen. Auch den Nachvollzug dieser verwegenen Anthropologie mutet er seinen Lesern ohne weiteres Argument zu, obwohl sie sich alles andere als von selbst versteht: Wird der Mann niemals satt? Hat er nie von einem Vergnügen genug? Oder, wenn keine quantitative, sondern eine qualitative Unendlichkeit gemeint sein sollte: Vermag er die Vielfalt seiner Bedürfnisse nicht mehr zu überblicken? Im Ernst: Weder zeichnen sich menschliche Bedürfnisse im Normalfall durch Grenzenlosigkeit aus – schon gleich nicht in praktischer Hinsicht und definitiv nicht diejenigen, deren Befriedigung immer nur kurze Zeit anhält: Niemand frisst unbegrenzt! –, noch bedeutet die begrenzte Menge eines Gebrauchsartikels automatisch, dass er für das entsprechende Bedürfnis nicht reicht. Das ganze prinzipielle „Spannungsverhältnis“ zwischen Bedarf und Bedarfsdeckung, das die BWL postuliert, ist nichts als eine nach beiden Seiten absichtsvoll hinkonstruierte Fiktion, die den praktischen Grund allen Wirtschaftens in eine metaphysische Dichotomie zwischen der Endlichkeit alles Irdischen und der Unendlichkeit menschlicher Bedürfnisse versenkt, um daraus dann folgenden Schluss zu ziehen:
„Unter Wirtschaften versteht man den sorgsamen Umgang mit knappen Ressourcen.“ (Ebd.)
Was klingt wie eine Sentenz aus dem Brevier der schwäbischen Hausfrau, ist für diese Wissenschaft die Quintessenz ihrer Erkenntnisse. „Sorgsamer Umgang“ mit Ressourcen, „sorgfältige Planung“ wegen deren Knappheit: Das erklärt der Autor des Lehrbuchs zum Inbegriff allen Wirtschaftens. Wie auch immer die ökonomischen Verhältnisse beschaffen sein mögen, in die es die Menschen verschlagen hat;1) gleichgültig auch dagegen, ob von einem privaten Haushalt die Rede ist, der aufgrund seiner beschränkten Zahlungsfähigkeit ‚mit knappen Mitteln wirtschaften‘ muss, oder von Unternehmen, die mit modernster Technik ‚Güter produzieren‘ und mit ihnen den Weltmarkt überschwemmen – für den Mann der Wissenschaft steht eines jedenfalls fest: Es geht um die Bewirtschaftung eines Mangels, um ein Haushalten mit knappen Mitteln. Darauf besteht er insbesondere auch dort, wo er vom Produzieren redet, also von der Herstellung eines Zuwachses an stofflichem Reichtum. Ausgerechnet dort, wo es darum geht, mit dem zweckmäßigen Gebrauch von ‚Ressourcen‘ die Gegenstände des Bedarfs zu mehren, regiert seiner Lehre zufolge aufgrund einer prinzipiell unaufhebbaren Beschränkung der Mittel ein abstraktes Gebot zur Sparsamkeit, nämlich
„das ökonomische Prinzip, wonach die Schaffung [!] einer bestimmten Menge von Gütern oder Dienstleistungen immer mit dem geringstmöglichen Einsatz an Produktionsfaktoren zu bewerkstelligen ist“ (I / S. 8).
Diese Wissenschaft erhebt die Tugend kluger Selbstbeschränkung, auf deren Praxis sich die Aktivisten der Marktwirtschaft in ihrer Eigenschaft als ‚Verbraucher‘ aus ganz bestimmt nicht metaphysischen oder natürlichen Gründen, sondern wegen ihrer marktwirtschaftlich bedingten Haushaltslage verstehen, zum Naturgesetz allen Produzierens. Dabei sieht sie von allem ab, worum es beim Produzieren geht: Zuallererst, wie gesagt, davon, dass hierbei von Reichtumsvermehrung die Rede ist; des Weiteren abstrahiert sie vom Inhalt der Bedürfnisse, für deren Befriedigung die Mittel geschaffen werden sollen; von den sachlichen Eigenschaften, die diese Mittel zweckmäßigerweise aufweisen müssen; von der Arbeit, den Arbeitsmitteln und den Produktionstechniken, die in der Produktion zur Anwendung gelangen – kurz und gut: Sie abstrahiert vom Produzieren selbst, um den Sinn dieser Veranstaltung in einen bestimmten Umgang mit den Mitteln der Produktion zu legen, nämlich in den Imperativ, sie so durchzuführen, dass der Aufwand „geringstmöglich“ ausfällt! Mit dieser leeren Idee von Wirtschaftlichkeit soll nicht nur feststehen, worum es im Grundsatz immer und überall geht und zu gehen hat, wo gewirtschaftet wird. Mit ihr will die BWL, wie dem ersten Zitat zu entnehmen ist, erklärtermaßen den „Grund“ angegeben haben, von dem her das Wirken jener Betriebe zu verstehen ist, die in der Welt des privaten Eigentums das Wirtschaften übernommen haben: Deren Geschäft attestiert sie den tieferen Sinn und unendlich guten Zweck, unter der Voraussetzung knapper Mittel der Menschheit ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen, indem sie der zum ökonomischen Prinzip erhobenen Handlungsmaxime folgen, aus wenig möglichst viel zu machen oder viel aus möglichst wenig oder beides zusammen, also möglichst viel aus möglichst wenig.
Wir erlauben uns ein kleines Zwischenfazit: Die BWL liefert hier ein Lehrstück weltanschaulichen Argumentierens ab. Ihre Erkenntnis über die ‚Wirtschaftseinheit‘ namens Betrieb, die in diverse „Beschaffungs-, Absatz- und Kapitalmärkte“ „eingebettet“ ist, hat sie ja nicht aus der Befassung mit dem, was so ein Betrieb treibt. Natürlich ist ihr vertraut, dass der mit Kaufen, Verkaufen und Fragen der Finanzierung befasst ist. Sie weiß auch, dass im Zentrum des Geschäfts so einer ‚Wirtschaftseinheit‘ die Erwirtschaftung eines Gewinns steht, der den Betriebseigner und nicht etwa die Menschheit bereichert. Man sagt ihr sicher auch nichts Neues, wenn man sie darauf hinweist, dass die nützlichen Güter, die so ein Betrieb produziert, mit einem Preis auf die Welt kommen, der den Zugang zu ihnen beschränkt. Würde die BWL daraus – d.h. aus den auch ihr bekannten Erscheinungsweisen ihres Gegenstandes – ihre Schlüsse ziehen, käme sie nicht so schnell auf den Menschen als Nutznießer der Produktion in der Marktwirtschaft und auf ein „Maximum an Bedürfnisbefriedigung“ als Zweck der Veranstaltung. Aber so bezieht sich die BWL eben gar nicht auf ihren Gegenstand. Sie tritt aus der marktwirtschaftlichen Realität heraus und ein in eine Metaphysik der Natur menschlicher Bedürfnisse, in der die von der „neoklassischen Volkswirtschaftslehre“ geschaffene „Kunstfigur“ des „homo oeconomicus“ (I / S. 3) daheim ist, um sich zunächst getrennt von allem, was an Marktwirtschaft erinnert, im abstrakten Gebot zur Sparsamkeit und zur Effizienz des letzten Sinns jeglichen Wirtschaftens zu versichern. Und von dieser der Wirklichkeit enthobenen Sinnkonstruktion aus, die letztlich alle historischen Produktionsweisen von der Subsistenzwirtschaft über die Sklaverei bis zum Kapitalismus begreiflich machen soll, kommt die BWL anschließend in einem zweiten Schritt auf den realen Gegenstand zurück: Sie wendet ihre Abstraktion auf ihn an, subsumiert das marktwirtschaftliche Geschehen unter ihre Sinnkonstruktion und stiftet auf diesem Wege Klarheit in der Frage, worum es (auch) in der Marktwirtschaft letztlich und im Grunde geht!
„Optimale Bedürfnisbefriedigung“: Das ist das „Ziel“, das die BWL mit ihren einleitenden Grundsatzüberlegungen über die Wirtschaftseinheit ‚Betrieb‘ den real existierenden Betrieben als ihr eigentliches ‚Weiß-Warum‘ zuschreibt. Und als die Abteilung der Wirtschaftswissenschaften, die sich in besonderer Weise für die Heranbildung des Nachwuchses für die Führungsetagen solcher Betriebe zuständig weiß, lässt sie es sich nicht nehmen, aus diesem Ziel, d.h. letztlich aus dem Knappheitsdogma, das sie aus der Volkswirtschaftslehre übernommen hat, auch noch den Auftrag derjenigen herzuleiten, die in den Unternehmen das Sagen haben:
„Zur Realisierung des Ziels optimaler Bedürfnisbefriedigung müssen komplexe betriebliche Entscheidungsprozesse optimiert werden.“ (I / S. 4)
Derart nichtssagend verfremdend und zugleich in ganz bestimmter Weise zielgerichtet verfälschend fällt das Urteil der BWL über die Aufgaben des Führungspersonals aus. Statt mitzuteilen, was und worüber da zu entscheiden ist, erklärt sie die „betrieblichen Entscheidungsprozesse“ für „komplex“, also für nicht so ohne Weiteres bestimmbar, und erhebt das Verfügen über die Elemente der Produktion und das Optimieren von Entscheidungen zur Hauptsache, um die es so einem Betrieb zu gehen habe. Ohne sich darum zu kümmern, woher sie kommt und worauf sie beruht, redet die BWL so über eine Verfügungsmacht über die sachlichen wie lebendigen Produktionsfaktoren, die im Betrieb – von welcher Führung auch immer – ausgeübt wird; und die schließt für sie selbstverständlich, und ohne dass sie dies in irgendeiner Weise für erklärenswert befinden würde, das Kommando über die Arbeit ein, die in so einem Betrieb geleistet wird. Sie hält von dem innerbetrieblichen Herrschaftsverhältnis, das da unterstellterweise mitgedacht ist, nur den Formalismus des Entscheidens fest und präsentiert diesen als den für den Erfolg des Betriebs alles entscheidenden Faktor.
Damit sind nicht nur die kapitalistischen Unternehmen mit einem unwidersprechlich guten Daseinsgrund versehen – Bedürfnisbefriedigung. Ins Recht gesetzt ist damit insbesondere auch das Führungspersonal, das die solch menschheitsbeglückender Zielsetzung gewidmeten Unternehmungen zum Erfolg führen soll. Und mit beidem zusammen steht zugleich die Selbstrechtfertigung der BWL als angewandte Wissenschaft, die „den betrieblichen Entscheidungsträgern“ mit „Handlungsempfehlungen zur Optimierung betrieblicher Prozesse“ (I / S. 5) assistieren will, damit die ihrer Aufgabe gewachsen sind.