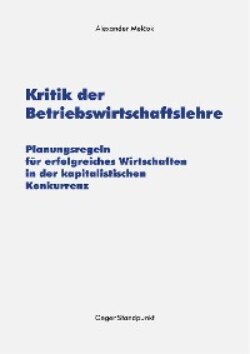Читать книгу Kritik der Betriebswirtschaftslehre - Alexander Melčok - Страница 8
II. Die BWL scheitert an der Erklärung des Gewinns, um dessen Maximierung sich ihre sämtlichen Erkenntnisse drehen
ОглавлениеDer Einstieg in die Betriebswirtschaftslehre und die scheinhafte Begründung der Nützlichkeit des ‚Gewinnprinzips‘ gehen auch auf kurzem Wege. Dabei kommt zugleich der harte Kern der betriebswirtschaftlichen Produktionstheorie auf die Welt. Ein Merksatz definiert, was der Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit“ beim Wirtschaften bedeutet:
„Das ökonomische Prinzip verlangt, das Verhältnis aus Produktionsergebnis (Output, Ertrag) und Produktionseinsatz (Input, Aufwand) zu optimieren.“ (I / S. 34)
Wie die zwei Klammern signalisieren, weiß der Betriebswirt um die Doppelnatur des Produktionsergebnisses bzw. -einsatzes in der Marktwirtschaft; er unterscheidet die stofflich-materielle von der wertbestimmten Qualität der Produktionsmittel und -resultate. Und er weiß, dass der „Erfolg“ sich hierzulande an den preisbestimmten Größen bemisst, die er deshalb eigens fett in seinen Kasten druckt:
(Ebd., Abb. 7)
Interessant ist jedoch das Beispiel, an dem der Gelehrte sein „ökonomisches Prinzip“ kindgemäß erläutert. Er kennt – oder genauer: es „begegnet uns das ökonomische Prinzip ... in drei Erscheinungsformen“ (ebd.). Die beiden ersten gehen so:
„Nach dem ökonomischen Prinzip geht es z.B. darum, die Heiztechnik so zu gestalten, dass (bei vorgegebener Raumtemperatur) mit einem gegebenen Heizöleinsatz ein möglichst großer Raum beheizt werden kann (Maximumsprinzip). Stattdessen kann es auch darum gehen, einen vorgegebenen Raum mit dem geringstmöglichen Heizöleinsatz (auf eine bestimmte Temperatur) zu erwärmen (Minimumsprinzip).“ (Ebd.)
Hier ist man in der Welt der Heizungstechnik, für die der Unterschied zwischen Maximum und Minimum insofern ziemlich gleichgültig ist, als es so oder so um den Wirkungsgrad des Heizöleinsatzes geht. Zwischen ‚Input‘ und ‚Output‘ finden ein Verbrennungsprozess und eine Wärmeleitung ins zu beheizende Zimmer statt. Deren Effizienz lässt sich berechnen, nämlich als Umsetzung des Energiepotentials einer Heizölmenge in einen Temperaturanstieg im beheizten Raum; auch lässt sich dafür sorgen, dass möglichst wenig von der verbrauchten Energie verlorengeht; und über die Vermeidung von Verlusten freuen sich Techniker und Raumbenutzer – ein schöner Erfolg. Das ist aber nicht der, um den es dem Betriebswirt geht. Der kennt eine dritte „Erscheinungsform“ effizienten Heizens:
„Nach dem Optimumsprinzip geht es darum, die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand zu maximieren. Damit ist man beim Gewinnmaximierungsprinzip angelangt. Für die traditionelle BWL ist das Prinzip langfristiger Gewinnmaximierung das oberste Formalziel, an dem betriebliche Entscheidungen ausgerichtet werden.“ (Ebd.)
Jetzt kommt also die Multiplikation mit dem Preis als entscheidende Größe hereingeschneit. Und die stellt jeden, der das Beispiel des Lehrbuchs ernst nimmt, vor ein ernstes Problem. Dass Heizöl – und ein Heizkessel und der Hausmeister usw. – etwas kostet, ist bekannt; zwar nicht aus der abstrakt-prinzipiellen Ableitung aller Wirtschaftstätigkeit aus dem ‚ökonomischen Prinzip‘, die der Wissenschaftler präsentiert hat; der vermeidet da ja sorgfältig jede Erwähnung des Geldes bei der Konstruktion eines nie zu bewältigenden, aber immerzu zu bewirtschaftenden Gegensatzes zwischen endlicher Natur und unendlich bedürftiger Menschennatur; aber wer für Heizöl zahlen muss, wird sich nicht weiter wundern. Nur: welchen vom „Faktorpreis“ unterschiedenen „Güterpreis“ hätte die erzeugte Wärme? Woher bekommt die überhaupt einen Preis – außer dem, den der Verbraucher für den „Input“ in seinen Ofen zahlen muss? Und dann gleich noch einen, der, mit der zustande gebrachten Wärmemenge nach welchen Wärmeeinheiten auch immer multipliziert, einen Ertrag stiftet, der über den für den ‚Input‘ anfallenden Kosten liegt? Dass sich mit verbesserter Heiztechnik Öl und – in der realen Welt der Marktwirtschaft – folglich auch Geld für Öl sparen lässt, versteht sich. Aber das dümmste Milchmädchen würde diese Kostenersparnis nicht als Gewinn verbuchen: als Geldbetrag, um den es reicher geworden wäre.
Die ganze Rechnung mit einem solchen Geldbetrag, der sich als Überschuss des Produkts aus Outputmenge und Güterpreis über das Produkt aus Inputmenge und Faktorpreis darstellt, unterstellt im Gegensatz zur heiztechnischen Idylle des Beispiels jemanden – einen marktwirtschaftlich kalkulierenden Betrieb –, der nicht bloß Öl kauft, um es warm zu haben, sondern der die damit erzeugte Wärme ihrerseits mit einem Preis versieht, um sie zu verkaufen. Wo immer die BWL mit solchen ‚Beispielen‘ aus der Welt der Güterproduktion argumentiert, begeht sie den Schwindel, mit derartigen Unterstellungen zu operieren: Sie erzählt Geschichten über die produktive Verwandlung von Naturstoffen in brauchbare Güter. Sie redet darüber jedoch so, als ob es dabei immer schon um ein quantitatives Verhältnis von Aufwand und Ertrag sowie um die Vergrößerung der Differenz zwischen beiden ginge. Sie lädt dazu ein, eine Erhöhung des Wirkungsgrads beim Einsatz von Brennstoff mit einer Kostensenkung zwecks Gewinnsteigerung zu verwechseln, indem sie so tut, als wären das „Erscheinungsformen“ desselben Prinzips. Auf diese Weise projiziert sie die Rechnungsweise kapitalistischer Betriebe, denen es darum geht, die Preisdifferenz zwischen dem Kostenaufwand, den sie für die Produktion treiben müssen, und dem Preis, den sie für die produzierte Ware bekommen, auszunutzen und zu ihren Gunsten zu optimieren, in die Natur der Gebrauchswertproduktion hinein. In der Produktion von Wärme und anderen nützlichen Dingen ein quantitatives Verhältnis von der Art ausmachen zu wollen, dass der Output – also die produzierten Güter – abzüglich des Inputs – d.h. der eingesetzten Rohstoffe, Arbeit und Arbeitsmittel – den Erfolg der Veranstaltung ergibt, den es herbeizuführen gilt, ist jedoch schon deswegen ein Unding, weil auf beiden Seiten Gebrauchswerte unterschiedlicher Qualität stehen, denen jedes gemeinsame Maß fehlt. Soweit es um die Produktion nützlicher Dinge geht, macht es überhaupt keinen Sinn, eine wie auch immer zu ermittelnde quantitative Differenz von Aufwand und Ertrag als das eigentliche, nämlich ökonomisch einzig relevante Produktionsergebnis festhalten zu wollen. Der abstrakte Imperativ der Input-Output-Optimierung, die das Wesen aller betrieblichen Rationalität ausmachen soll, ist nichts als die verfremdete Form, das in ein Sachgesetz der Wirtschaftlichkeit überhöhte Abziehbild der kapitalistischen Ertrags-Rechnung.
Doch selbst unter der Voraussetzung, von der die BWL in ihrem Beispiel ausgeht, die sie theoretisch jedoch für absolut unbeachtlich befindet – das ökonomische Subjekt der Wärmeerzeugung ist ein profitorientierter Betrieb, der für den Verkauf produziert –, versteht es sich nicht von selbst, dass der Verkaufspreis des Gutes ‚Wärme‘ per se höher liegt als der Einkaufspreis für den Input, so dass sich zwischen beiden Größen eine Differenz als fett gedruckter ‚Erfolg‘ einstellt. Gewiss, wenn sich Wärme teurer verkaufen lässt, als ihre Erzeugung kostet, dann wächst der Gewinn, der hier unter dem Titel ‚Erfolg‘ firmiert, mit jeder Einsparung von ‚Inputmenge‘. Aber wo kommt der Gewinn selber her, d.h. der Wertzuwachs, den das Betriebsvermögen nach erfolgreichem Verkauf der erstellten Leistung erfahren hat? Denn davon geht ja auch der Betriebswirt aus, dass der Erfolg der betrieblichen Anstrengungen in dem zusätzlichen geldwerten Eigentum besteht, das auf der Seite des Betriebs entstanden ist.
Das Interessante an dieser ‚Lehre‘ ist: Mit ihrer schlichten Formel ‚Ertrag – Aufwand = Erfolg‘ (= Gewinn) will sie diese Frage beantwortet haben und lässt sie zugleich völlig unbeantwortet. In der ersten Geldsumme namens Ertrag ist der Gewinn ja schon enthalten, seine Erwirtschaftung also vorausgesetzt. Das ist die Prämisse einer puren Rechenoperation, mittels derer per Subtraktion der Aufwandssumme nur mehr sein Umfang ermittelt wird. Vom Gewinn bleibt nur die tautologische Auskunft, dass er in der Geldsumme besteht, um die der Verkaufserlös die Kosten für den ‚Input‘ übersteigt. Die BWL suggeriert, den Gewinn mit der Kostenersparnis durch Einsparung von Inputmenge erklärt zu haben. Tatsächlich erklärt die Senkung der Produktionskosten durch Anwendung effektiverer Technik jedoch allenfalls eine Steigerung des Gewinns, eine Vergrößerung des Unterschieds zwischen den Produktionskosten und dem Preis des Produkts, nicht aber diesen Unterschied als solchen. Das Lehrbuch selbst unterstellt, dass die Berechnung des Wärmepreises nicht damit zusammenfällt, dass die Faktorkosten in Rechnung gestellt werden – in dem Fall würde mit der Senkung des ‚Aufwands‘ der ‚Ertrag‘ sinken, und von der Maximierung einer Differenz zwischen beiden Größen könnte keine Rede sein; den Gewinn kann eine Verringerung des Kostenaufwands nur dann steigern, wenn und soweit der Güterpreis anders als durch den Geldaufwand für den Input bestimmt ist. Es bleibt also die Frage offen, worin diese Differenz begründet ist.
Unter der Überschrift „kostenorientierte Preisfindung“ (II / S. 433) findet sich dazu tatsächlich – oder soll man besser gleich sagen: scheinbar? – eine Auskunft. In Anlehnung an die unternehmerische Praxis der Preiskalkulation bespricht die BWL dort den Gewinn als Aufschlag auf die Kosten. Der Preis, zu dem der Betrieb seine Güter absetzt, wäre danach als „Summe aus Selbstkosten zuzüglich eines angemessenen Gewinnzuschlags“ (II / S. 434) zu begreifen, den die BWL auf ihrer Suche nach Richtlinien zur Ermittlung des ‚richtigen‘, d.h. „gewinnmaximalen Angebotspreises“ (II / S. 433) freilich sogleich und ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Höhe diskutiert. So fällt ihr noch nicht einmal auf, dass sie hier eine zweite Erklärung des Gewinns anbietet, die mit ihrer ersten überhaupt nicht vereinbar ist: Der Gewinn wäre dann ja ein von den Kosten unabhängiger Zusatz – also nicht, wie vorher behauptet, das Resultat von Kostensenkung. Die Wissenschaft entdeckt hier ganz offensichtlich kein Problem. Rein rechnerisch, d.h. begriffslos betrachtet, gibt es eben zwei Möglichkeiten, die Differenz zwischen Kosten und Erlös zu maximieren: entweder durch Senkung der Kosten – durch „verringerte Faktoreinsatzmenge“ (II / S. 39) oder „Senkung der Faktorpreise“ (ebd.) – oder durch „Erhöhung der Absatzpreise“ (ebd.). Es hilft aber nichts: Das Ausgangsproblem ist mit dieser neuen Bestimmung des Gewinns nur verschoben. Es stellt sich nun nämlich die Frage, was einen solchen Preisaufschlag rechtfertigt bzw. begründet. Auch dazu finden sich Auskünfte in unserem Lehrbuch. Ihnen zufolge ist der Gewinn als „das Entgelt“ zu betrachten, „welches der Unternehmer für die Bereitstellung von Eigenkapital und für die Übernahme des Unternehmerrisikos erhält“ (II / S. 485). So gesehen wäre der Gewinn bzw. die Differenz zwischen den Faktorkosten und dem Erlös aus dem Verkauf der produzierten Güter in Leistungen begründet, die der Unternehmer erbringt. Nämlich zum einen: Er schießt das Geld vor, das zur Bezahlung der Produktionsfaktoren nötig ist. Folgt man der Logik, nach der hier gedacht wird, handelt es sich hierbei um eine Leistung, mit der der Unternehmer seinen Teil zum Zustandekommen des Betriebsergebnisses beiträgt und die ihm seinem Beitrag zu diesem Ergebnis entsprechend zu entgelten ist. Das für den Kauf von Produktionsfaktoren verausgabte Geld wäre danach – getrennt vom Einsatz dieser Produktionsfaktoren im Betrieb – als eigener Grund dafür zu betrachten, dass der Erlös aus dem Verkauf des Produkts die Produktionskosten übersteigt und das Vermögen des Betriebs wachsen lässt. Noch absurder erscheint diese Begründung, wenn man den zweiten Teil hinzunimmt, dem zufolge der Gewinn zugleich als Entgelt für die „Übernahme des Unternehmerrisikos“ anzusehen ist, also dafür, dass der Unternehmer womöglich keinen Gewinn macht, sondern mit seiner Gewinnrechnung scheitert. Höflich ausgedrückt: Weder die pure Bereitstellung von Kapital für betriebliche Produktion noch die Gefahr des Misslingens seiner Vermehrung können begründen, dass und auf welche Weise ein Gewinn – und damit die erfolgreiche Realisierung eines Preisaufschlags auf die Kosten – erwirtschaftet wird. Umso mehr wird ersichtlich, dass es sich bei diesen disparaten Bemühungen der BWL um die Erklärung des Gewinns gar nicht ernsthaft um die sachliche Beantwortung der Frage handelt, wie der Gewinn zustande kommt. Sie zielen auf die Rechtfertigung der Tatsache, dass die Überschüsse, um deren Erwirtschaftung sich das ganze marktwirtschaftliche Wirtschaftsleben dreht, in den Taschen der Betriebseigner landen, und die Suche nach guten Gründen dafür befasst sich gar nicht mit der Frage, wie diese Überschüsse zustande kommen, sondern unterstellt ihr Vorhandensein. Die ‚Analysen‘ und ‚Strategien‘ der BWL zum Verhältnis von Aufwand und Ertrag leben von der notorischen Unterstellung, dass im „Prozess der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung“ (I / S. 47) nicht nur nützliche Dinge aus Ressourcen herausgewirtschaftet werden, sondern dass dabei allemal ein Gewinn ‚entsteht‘. Die BWL verweigert sich systematisch der Frage, was zwischen Input und Output, zwischen der Bezahlung der Elemente der Produktion und dem Verkauf der damit erzeugten Güter passieren muss und offenbar regelmäßig passiert, so dass ein derartiger Überschuss an geldwertem Eigentum zustande kommt. Sie leistet sich die Unverfrorenheit, diese seltsame Leistung des marktwirtschaftlichen Produzierens als dessen Lebensgesetz auszugeben – Gewinn einbringender Output ist ihr zufolge ja erklärtermaßen Grund und Ziel allen betrieblichen Wirkens! – und sie gleichzeitig zu ignorieren, d.h. das Produktionsverhältnis, in dem sich der Reichtum im Geld und der Erfolg an dessen Vermehrung bemisst, keiner Erklärung für wert zu befinden. Es ist, als wollten diese ‚praktisch-normativen‘ Ökonomen darauf bestehen, dass man nicht wissen muss, was der Profit ist, wenn es darum geht, ihn zu maximieren – und so ist es ja auch.