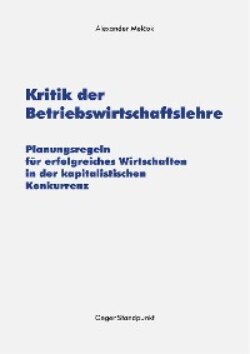Читать книгу Kritik der Betriebswirtschaftslehre - Alexander Melčok - Страница 9
Programmatischer Wille zum Dienst am Profit
und Rechtfertigungslehre in einem
ОглавлениеWas die BWL am Gewinn interessiert, ist allein seine Größe. Die Differenz zwischen Ertrag und Kosten möglichst groß zu gestalten, das ist für sie die entscheidende ‚Frage‘ betrieblichen Wirtschaftens. Und die deckt sich mit der Frage, die den entscheidungsbefugten Betriebsherren bewegt. Dessen praktisches Interesse an der Erwirtschaftung maximalen Gewinns macht die BWL zum Standpunkt, von dem aus sie sich theoretisch mit den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten befasst. In ihren Erklärungen setzt sie den Gewinn daher gleich mit den Methoden, die seine Maximierung ermöglichen, unter konsequentem theoretischem Desinteresse an der Quelle, die ihn hervorbringt. Ihr borniert instrumentelles Denken betrachtet alles, was eine Vergrößerung des Profits bewirkt – die erfolgreiche Senkung der Faktorkosten, das ‚richtige‘ Bemessen der Höhe des Gewinnaufschlags – als dessen (Entstehungs-)Grund.
Zugleich rechtfertigt die BWL die Parteilichkeit für den Unternehmensertrag, die ihr Denken bestimmt, indem sie die Verbesserung des Kosten-Gewinn-Verhältnisses, durch die der Unternehmer seinen Gewinn maximiert, als Effektivierung einer menschheitsdienlichen Güterproduktion präsentiert. Die beliebten Beispiele aus dem Alltagsleben – wie das von der effektiveren Erzeugung von Wärme – sollen die Gleichung zwischen der Jagd nach dem Profit und einer ressourcenschonenden Güterversorgung bezeugen, zeugen aber nur von der Verlogenheit dieser Gleichsetzung.
Mit dieser doppelten programmatischen Verschiebung – der Gleichsetzung des Gewinns mit den Methoden seiner Maximierung und der Gewinnmaximierung mit einer Erscheinungsform des allem Wirtschaften angeblich einbeschriebenen Prinzips des effizienten Einsatzes der Produktionsfaktoren – gelingt es der BWL, ein perfektes Quidproquo zwischen rechtfertigendem Denken und praktischer Handreichung für das Geschäft der Profiterwirtschaftung in Szene zu setzen. Was dem privaten Bereicherungsinteresse der Betriebsherren dient, befördert ihren Erkenntnissen zufolge das Allgemeinwohl, umgekehrt präsentiert sie das effiziente Wirtschaften im Sinne des von ihr ermittelten ‚ökonomischen Prinzips‘ als Schlüssel zum Erfolg des auf Gewinnerwirtschaftung abzielenden kapitalistischen Betriebs. Wo kapitalistisch gewirtschaftet wird, herrscht das ‚Optimumsprinzip‘, so dass sie sich besten Gewissens der Frage widmen kann, wie – mittels welcher Methoden – sich der Erfolg des unternehmerischen Interesses herbeiführen lässt. In ihrer Durchführung ist sie so sehr Methodenlehre des unternehmerischen Erfolgs, dass der Inhalt des Interesses, dem sie zum Erfolg verhelfen will, streckenweise ganz hinter dem ‚Wie‘ zurücktritt. Wie z.B. im folgenden Zitat:
„Die Unternehmensführung hat die Aufgabe, den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung so zu gestalten, dass das (die) Unternehmensziel(e) auf höchstmöglichem Niveau erreicht wird (werden).“ (I / S. 47)
Schon merkwürdig: Als Ziel firmiert hier das erfolgreiche Erreichen des Ziels! Das erfolgreiche Wie, der Modus des betrieblichen Verfügens über die Betriebsmittel, gerät der BWL da zum entscheidenden Was, zur Sache, um die es im Betrieb geht. Mit dieser im Wortsinn ver-rückten Kennzeichnung des Betriebszwecks verabschiedet sich die BWL bisweilen explizit vom ökonomischen Gehalt ihres wissenschaftlichen Objekts – und zwar sowohl in seiner idealistischen wie in seiner realistischen Fassung: von effizienter Güterversorgung oder von Gewinnmaximierung ist im folgenden Kapitel erst einmal gar nicht mehr die Rede –, um sich voll und ganz der abstrakten Frage zu widmen: ‚Wie entscheiden, um Erfolg zu haben?‘ Sie macht ernst mit dem Standpunkt, dass betriebliches Wirtschaften Optimieren ist und entwickelt sich zu einem puren Modell der Kunst, den höchstmöglichen Erfolg zu planen. Das Disponieren über die betrieblichen Mittel wird zur reinen Verfahrenstechnik verselbständigt und diese zum entscheidenden Inhalt des Wirtschaftens – und damit auch der betriebswissenschaftlichen Unternehmensberatung – erhoben.
© 2018 GegenStandpunkt Verlag