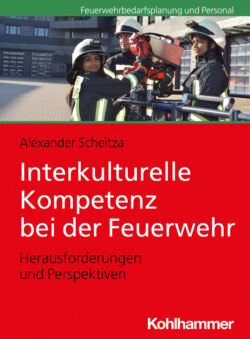Читать книгу Interkulturelle Kompetenz bei der Feuerwehr - Alexander Scheitza - Страница 12
[25]1.7 Neuanfang nach dem 2. Weltkrieg: Zwischen Kontinuität und Verdrängung
ОглавлениеDer Neuanfang der deutschen Feuerwehren erfolgt in vier verschiedenen, vom Alliierten Kontrollrat der Siegermächte verwalteten, Besatzungszonen. Österreich wird wieder in seine staatliche Eigenständigkeit entlassen und die nach der Konferenz von Jalta abzutretenden deutschen Ostgebiete sind nach dem Krieg anderen Staaten zugeschlagen worden. Deshalb kann auch der für 1937 in Danzig anberaumte 22. Deutsche Feuerwehrtag nach dem Krieg nicht an diesem Ort nachgeholt werden. Es soll noch bis 1953 dauern, bis sich die Feuerwehren der jungen Bundesrepublik wieder zu einem Deutschen Feuerwehrtag in Ulm treffen können.
Die Feuerwehren in der sowjetischen Besatzungszone, ab 1949 Staatsgebiet der DDR, übernehmen unter veränderten politischen Vorzeichen für ihre Feuerwehren weitgehend die zentralistischen Verwaltungsstrukturen, die unter dem NS-Regime geschaffen worden sind.
Auch in den westlichen drei Besatzungszonen etablieren sich die deutschen Feuerwehren vorerst nach den jeweiligen Vorgaben ihrer Besatzungsmächte. Besonders die Franzosen taten sich mit der Zulassung freiwilliger, selbstverwalteter Feuerwehren anfangs schwer, hatten sich doch in Frankreich während des 2. Weltkrieges Teile der französischen Resistance gar aus den Feuerwehren rekrutiert bzw. immer wieder Zuflucht bei den Feuerwehren gefunden. Nun hat man Angst, dass sich Teile der 1944 von der SS gebildeten NS-Untergrundorganisation »Werwolf« bei den deutschen Feuerwehren verstecken und von dort aus aktiv werden könnten (vgl. Schamberger, 2003).
Die pastellfarbige Verdrängungskultur des »motorisierten Biedermeier«, so die treffende Charakterisierung der bundesdeutschen Wirtschaftswunderjahre der Adenauer-Ära, wird nur allzu gerne auch von den Feuerwehren gepflegt (vgl. Homann, 1999). Man tut sich schwer, sich selbst den ganz persönlichen Anteil am Verlauf der Geschichte der NS-Zeit zu vergegenwärtigen und auch nach außen hin anzuerkennen. Tobias Engelsing, aktiver Feuerwehrkamerad und promovierter Historiker, skizziert wie bis in die 1990er Jahre hinein vor allem ältere Funktionäre an einer Aufarbeitung der Vergangenheit Anstoß nehmen und eine kritische Auseinandersetzung mit militärischen Traditionen verweigern (Engelsing, 1999).
1961 tritt Albert Bürger auf dem 23. Deutschen Feuerwehrtag in Bonn-Bad Godesberg erstmals – in Abstimmung mit dem Bundespräsidialamt – in der Uniform eines Zweisternegenerals der damals erst vier Jahre jungen Bundeswehr auf, nur aus preußisch-feuerwehrblauem Tuch geschneidert. »Hintergrund war das Bemühen, [26]die Stellung der deutschen Feuerwehren auf diplomatischen Empfängen und entsprechend internationalen Anlässen adäquat zu repräsentieren und ihren Vertretern einen ihrer politischen Gewichtung nach außen hin sichtbaren Ausdruck zu verleihen.« (vgl. Schamberger, 2003, S.154).
Wem drängt sich hier nicht ein historischer Vergleich zum organisatorischen Unterschied zwischen dem einst unter Napoleon militärisch organisierten Pariser Pompier-Corps und den frühen deutschen Feuerwehren in Baden und Württemberg auf? Dementsprechend irritiert – und auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund des sich im darauffolgenden Jahr in der sogenannten »Kuba-Krise« bedrohlich eskalierenden »Kalten Krieges« zwischen den Machtblöcken – haben auch viele Vertreter der föderalistisch organisierten bundesrepublikanischen Feuerwehren auf das neue »militärische Outfit« von Albert Bürger reagiert. Darüber hinaus sind sicherlich bei vielen Kameraden manch‘ dunkle Erinnerung an die paramilitärisch-einheitliche Uniformierung der deutschen Feuerwehren unter dem NS-Regime geweckt worden, das damals gerade einmal 16 Jahre zurücklag. Bild 3 zeigt ein typisches Foto einer Feuerwehr aus dieser Epoche.
Bild 3: Die Feuerwehr Lemgo 1970 (Quelle: Archiv Freiwillige Feuerwehr/Alte Hansestadt Lemgo) [zurück]