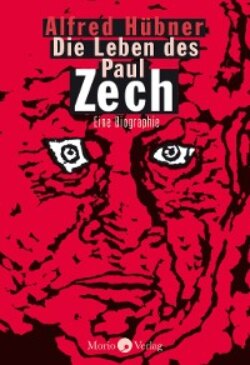Читать книгу Die Leben des Paul Zech - Alfred Hübner - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеFlucht aus dem Muckertal
Paul Zech zieht ohne Frau und Kinder in die deutsche Hauptstadt. Else Lasker-Schüler hat ihm eine Unterkunft bei einem ihrer Freunde besorgt, den sie so beschreibt: „Ganz, ganz ernst / ist der Bildhauer Georg Koch […] / Seine Geschöpfe […] springen unerwartet aus ihm, / Ihr Schöpfer ist der erste und einzige / Futuristische Bildhauer.“1 Der Künstler wohnt zusammen mit Mutter und Schwester in Berlin Mitte, Zimmerstraße 60. Vergeblich versucht die Dichterin, dem Neuankömmling Arbeit zu verschaffen. Der Ortswechsel setzt ihm heftig zu. Die Millionenstadt löst zwiespältige Gefühle in ihm aus. Einerseits ist er von ihr fasziniert, anderseits überfällt ihn ein Gefühl der Verlorenheit. Zeitweilig spielt er mit dem Gedanken, ins Wuppertal zurückzukehren. Die dortigen Freunde und Kollegen, soweit sie überhaupt von seinem Weggang wissen, hat er im Unklaren gelassen, ob er für immer in Berlin bleiben wird. Seine Flucht aus dem Bergischen Land erscheint ihm als Verrat: „Ich habe die Stadt an der Wupper um eine Linsensuppe verlassen.“2
Mehr als die Ehefrau vermisst Zech Emmy Schattke: „Ich habe Dich verraten um ein Amt / in hellen Straßen bei Palast und Hurenhaus.“3 Eine bestimmte Überlegung hindert ihn daran, der Hauptstadt sofort wieder den Rücken zu kehren: Zurück im Wuppertal wäre er gezwungen, sich zwischen Fahrenkrog und Kramer, zwischen Germanenkult und Christentum zu entscheiden. Dieses Votum zögert er hinaus. Absichtsvoll hat der Redakteur von „Mehr Licht!“ Zechs Gedicht „Wir müssten so wie Kinder sein!“ in der gleichen Ausgabe veröffentlicht, in der er selbst die „Germanisch-deutsche Religions-Gemeinschaft“ als „Wotansanbeter“ abkanzelt.4
Zufällig erscheint im „Niederrhein“ zeitgleich ein langer Beitrag über Fahrenkrog, den Zech vor vielen Monaten in Elberfeld verfasst hat und so nicht mehr zu Papier bringen würde. Das zeigt der Satz: „unter den künstlerischen Persönlichkeiten, die notgedrungen im Wuppertal, dieser mageren Kunstoase, ihre Zelte aufgeschlagen haben, nimmt der genannte Maler sicherlich den ersten Rang ein.“ Im Verlauf des Artikels wird der Künstler einmal als Repräsentant der Moderne und dann wieder als Bewahrer der Tradition bezeichnet: „Er ist ein künstlerischer Revolutionär durch und durch. […] Fahrenkrog ging aus von der religiösen Malerei. Religiös waren die Motive und die Behandlung des Stoffes. In gewissem Sinne also konservativ.“
Bei der Beurteilung von Kunst teilt Zech noch immer die reaktionären Ansichten seines Idols: „Was die Expressionisten und andere ‚Isten‘ in halszerbrecherischen Jongleurkunststückchen dem Publikum vorgaukeln, versteht Fahrenkrog ohne viel Geschrei maßvoll und dem Ganzen adäquat anzuwenden, ohne neutönerisch zu wirken.“ Indem er dessen Werke lobt, schmäht er das Schaffen zeitgenössischer Künstler: „Da sind nicht bloß farbige Flecken und Flächen, sondern organisches Leben, das heraustritt aus dem engen Rahmen und den Beschauer überwältigt.“ Der Beitrag endet mit dem Bekenntnis: „indem man sich von dem Genie begeistern lässt, gewinnt man den Menschen lieb, und wir alle sonnen uns an der Dreifaltigkeit, die von ihm ausstrahlt: Schönheit, Licht und Wahrheit.“5
Zech leistet Fahrenkrog auch weiterhin Gefolgschaft. Eine Woche nach seiner Ankunft in Berlin fährt er nach Thale und besucht dort die Uraufführung von „Baldur“ im Harzer Bergtheater. Die Veranstaltungsstätte gehört zu den ältesten Naturbühnen Deutschlands. Ihr Intendant, Ernst Wachler, obwohl jüdischer Abstammung ein heftiger Antisemit, hat sie gegründet, um über eine Kanzel zur Verbreitung seiner völkischen Weltanschauung zu verfügen. Die Inszenierung von Fahrenkrogs Stück an dieser „Weihestätte“ im Bodetal dient der Verkündigung neuheidnischvölkischer Lehre. Zech hat zwei Jahre lang an der Entstehung Anteil gehabt und glaubt, bei der Premiere nicht fehlen zu dürfen. Aus Thale schickt er seiner Frau eine Ansichtskarte mit fünf Zeilen: „L. [!] Helene, vom Hexentanzplatz, wo Fahrenkrogs Stück aufgeführt wurde, die herzlichsten Grüße. Warum schreibst Du nicht? Herzlich die Hand Paul“.6 Ein Grund für Helenes Schweigen liegt in ihrer Abneigung gegen den möglichen Umzug der Familie nach Berlin. Sie möchte mit den Kindern bei ihrer Mutter in Elberfeld bleiben.
Fahrenkrog ist sich über die Gründe für Zechs Aufenthalt in Berlin nicht im Klaren und setzt seinen Plan, das Mitglied fester in die Ortsgruppe der „Deutsch-religiösen Gemeinschaft“ von Elberfeld-Barmen einzubinden, zielstrebig in die Tat um. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung des Lobgesangs auf seine Person und sein Werk in der Zeitschrift „Der Niederrhein“ veröffentlicht er in Schwaners Blatt eine lobende Besprechung von „Schollenbruch“: „Zech gehört zu den größten Hoffnungen der deutschen Lyrik. […] Den Volkserziehern mag dieser, der einer der unseren ist, zum Teil aber noch unbekannt sein, und deshalb rate ich allen, diesen gottbegnadeten Sänger kennen zu lernen.“7
Zechs Schwiegermutter mit ihren Enkeln Rudi und Elisabeth
Auch Wilhelm Idel will mit einem Artikel in der „Wermelskirchener Zeitung“ dazu beitragen, „die weitesten Kreise auf den jungen Dichter aufmerksam zu machen, der gegenwärtig in Elberfeld als glücklicher Familienvater ganz der schriftstellerischen Arbeit lebt und der verbreitetsten Tageszeitung dort als Bücherreferent und literarischer Mitarbeiter verpflichtet ist.“8 Neben dem „Frühen Geläut“, den „Waldpastellen“ und „Schollenbruch“ geht er auch auf Zechs Beiträge im „Kondor“ ein und hebt das Neuartige der Wortschöpfungen hervor, die sie enthalten. Von den Zukunftsplänen des Verfassers weiß er nichts.
Die Tätigkeit beim „General-Anzeiger“ hat Zech und seiner Familie bisher ein gewisses Maß an Sicherheit verschafft. In Berlin muss er ganz von vorne beginnen und um die Veröffentlichung jedes einzelnen Artikels kämpfen. Anders als im Bergischen Land ist in der Hauptstadt der Wettbewerb unter den Autoren um die Abnahme ihrer Beiträge bei den Zeitungen und Illustrierten groß. Diese Erfahrung macht er, als nach der Harzreise sein Alltag in einer fremden Umgebung beginnt. Kollegen lernt er schnell kennen. Dafür sorgt Lasker-Schüler, die ihn zusammen mit seinem Quartiergeber, dem Bildhauer Georg Koch, in die angesagten Lokale der Hauptstadt beordert.9 Tagsüber bietet er sich in den Redaktionsstuben als Mitarbeiter an. Mit diesem Ziel sucht er auch Walden in der Redaktion des „Sturm“ auf. Der kann jedoch nicht mehr als bisher für ihn tun, was bedeutet, ab und zu eines seiner Gedichte zu drucken.10 Eine Festanstellung verbietet sich dem Herausgeber der Zeitschrift aus finanziellen Gründen, da er selbst ständig in Geldnot steckt.
Zech lebt jetzt ausschließlich von den spärlich eingehenden Honoraren, die er für Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften erhält. Von diesen Einkünften muss er seine Berliner Unterkunft und die Elberfelder Wohnung bezahlen und Helene Geld für den Lebensunterhalt der Familie schicken. Die doppelte Haushaltsführung bringt ihn in eine Notlage, welche er, wie jene seiner Kindheit und als Heranwachsender im Bergwerk, lebenslang nicht vergessen wird.
Zweig ahnt möglicherweise etwas von den Problemen seines Kollegen, weiß aber nichts von dessen Plänen, sich auf Dauer in Berlin niederzulassen. Per Postkarte gibt er ihm einen beruflichen Tipp: „Lieber Herr Zech, ich wollte Ihnen nur sagen, dass am Hamburger Schauspielhaus die Stelle des Dramaturgen frei ist: Bewerben Sie sich doch, falls Sie einen literarischen Posten suchen!“11 Der Empfänger greift die Anregung nicht auf, obwohl er sich fürs Theater interessiert. Ein Grund dafür sind seine Zweifel, ob er Elberfeld für immer den Rücken kehren oder dorthin zurückkehren soll.
Exil in Preußen
An der Seite von Lasker-Schüler lernt Zech die Literaten- und Künstlerszene Berlins kennen, deren Mitglieder sich im „Café des Westens“ oder im „Café Josty“ treffen. Vor kurzem hat die Dichterin ihm ein Exemplar ihres neuen Werkes „Die Nächte Tino von Bagdads“ geliehen. Nun will sie es zurückhaben. Als das nicht geschieht, fordert sie dringlicher: „Mein Buch – bitte.“ Außerdem hat sie eine wichtige Mitteilung für ihn: „Herr Schweynert weiß vielleicht was für Sie.“12 Zech kann das Buch derzeit nicht zurückgeben. Deshalb gibt er keine Antwort, rechnet allerdings nicht mit ihrer Beharrlichkeit. Sie schreibt ihm: „Also Fritz Schweynert geht von der ‚Zeit am Montag‘ ab, wahrscheinlich kommt er nicht mehr hin. Aber für Sie wäre vielleicht dort offen.“ Danach wiederholt die Freundin ihre Aufforderung: „Bringen oder senden Sie mir bald mein Buch – ich möchte anfangen manchmal zu illustrieren.“13
Nun muss Zech mit der Wahrheit herausrücken. In der Annahme, Lasker-Schüler einen Gefallen zu tun, hat er ihr Exemplar an den „Reclam Verlag“ geschickt. Als sie davon erfährt, vergisst sie das „Du“ der zweijährigen „Wupperfreundschaft“ und poltert los: „Geehrter Herr Zech. Wie können Sie ohne mein Wissen und Erlaubniß handeln. Ich hatte nicht die Absicht meine Nächte von Bagdad nach Reclam zu senden. Werde dort sofort zurückfordern. Bin außer mir zum Donnerwetter.“ Selbstbewusst fügt sie hinzu: „Ich brauche doch keine Reclame – mich kennt man. Zum Donner was haben Sie gemacht! Else L-Sch.“14 Vier Tage danach schreibt sie ihrem Verleger: „Die Sache mit Paul Zech hat sich aufgeklärt, ich hab ihm Unrecht getan.“15 Die Ursachen für diesen Sinneswandel sind nicht klar. Zech taucht drei Wochen ab, obwohl er von der Dichterin ein Telegramm erhält: „sofort telefonieren bitte prinz von theben“16.
Bei der Uraufführung von „Baldur“ hat Fahrenkrog Zech gebeten, für den „Volkserzieher“ einen Artikel über sein Stück und die Inszenierung zu schreiben. Dieser Auftrag ist Teil seiner Verabredung mit Schwaner, das wichtige Vereinsmitglied noch stärker in die „Deutsch-religiöse Gemeinde“ einzubinden. Den Beitrag hat der Vorsitzende zwar erhalten, doch aus dem Text geht wieder nicht hervor, ob sein Verfasser die religiösen Überzeugungen des Dramatikers teilt. Nur andeutungsweise erlaubt er sich, Vorbehalte gegen die Form des Werkes zu äußern: „Man muss staunen, wie gut diese Tragödie […] gelungen ist, wieviel reifes Können und intuitives Draufgängertum darin vorhanden ist, wenn man bedenkt, dass es die literarische Arbeit eines Bühnenneulings ist.“17
Der Rezensent selbst muss mit einer freundschaftlich gemeinten Ermahnung fertig werden. Wegener, der sich zur Zeit im belgischen Ostende aufhält, schreibt über „Schollenbruch“: „Paul Zechs Erstlingsband ist mir eine Enttäuschung geworden“. Er bemängelt, in dieser Ausgabe stünden nur Gedichte, die „ein falsches, ungünstiges Bild seines Talentes geben. Besonders gegen den Schluss des Buches findet sich manches direkt wertlose, inhaltlich dürftige und unreife Gedicht.“ Dennoch vertritt er die Ansicht: „Wer Zechs weitere Entwicklung kennt, weiß, dass der Dichter sich von dem Träumerisch-Landschaftlichen immer mehr entfernt und sich einer kraftvolleren Erfassung des in Arbeit, Not und Leidenschaften ächzenden und taumelnden Menschendaseins nähert.“18
Zech reagiert gelassen und antwortet Wegener: „Wer mich kennt, weiß auch, dass ich in Sachen der Kunst absolute Wahrheit verlange. Und da die Auffassung von Lyrik und deren geistigem Wesen tausendfach verschieden ist, so darf man sich eben nicht wundern, auch abfällige Beurteilungen zu hören.“ Eine Spitze kann er sich doch nicht verkneifen: „Ihre Meinung ist ja unter den 23 bisher erschienenen die abfälligste.“ Versöhnlich fährt er fort: „Aber darum doch keine Feindschaft.“ Ihm liegt an der Freundschaft mit dem Weggefährten und ihm vertraut er auch an, wie es in seinem Inneren aussieht: „Was mich reservierter gemacht hat, ist die vollständige geistige Zerrüttung, in der ich mich seit Wochen befinde und die durch allerlei wenig angenehme Dinge äußerer und innerer Art verursacht wurde. Man verzweifelt am letzten Sinn des Lebens.“ Zech bedrücken der Streit mit Lasker-Schüler und die Mitgliedschaft in der „Deutsch-religiösen Gemeinschaft“. Hinzu kommen finanzielle Sorgen: „Verzeihen Sie, dass ich den Brief nicht nach Ostende senden konnte. Schäbiger Dinge wegen.“19 Auslands-Briefporto kann er sich nicht leisten.
Lasker-Schüler will ihrerseits die Verbindung zu Zech wieder herstellen. Von der Ostsee schreibt sie ihm in Elberfelder Mundart: „Lewer Pool Zech, wat es dat, dat De‘ nich herkömmst! Oder häst De’ geschreewen – on Ding Breef is nicht ongekömmen?“20 Zwei Tage später wiederholt sie die Aufforderung.21 Sie bittet vergeblich. Er fährt weder hin noch gibt er ihr Antwort.
Paul Zech will Emmy Schattke wiedersehen, doch von ihr erreicht ihn kein Brief. Auch darunter leidet er und beginnt „Der blassen Blonden in der Ferne“ Botschaften in Sonettform zu senden. Die gelangen jedoch nicht nach Essen, sondern werden in Berlin für ein Buch zur Seite gelegt. Erste Verse lauten: „Westwärts, wohin die weißen Lämmerwolken schweben, / […] muss die Fabrikstadt liegen, der ich in Verdruß / den Rücken wandte.“ Auf die gleiche Weise erinnert sich der Verfasser an Spaziergänge in Elberfeld: „Einst hab ich alle Berge jener Stadt erklommen / mit dir“, und Ausflüge in die Umgebung: „Wir standen lange auf dem steingetürmten Grat / der Schlossruine, während unten Hämmer pochten / Schwungräder Donner brausten und aus Schornsteinspitzen / die Schwindsucht eingepferchter Tagelöhner quoll.“
Außerdem beschreibt Zech erotische Erlebnisse, die es nie gegeben hat: „O Frau, der ich in Jahren angenahter Reife / mich hingab wie ein Büßer und ganz hüllenlos: / wohl wuchs mir Wundervolles tiefst aus deinem Schoß, / Wunder, die ich im Fernen erst begreife.“ Ohne Schattke fühlt er sich in Preußen wie im Exil und bereut seinen Entschluss, das Wuppertal verlassen zu haben: „Wer nur ließ mich im Murren am Geschick erblinden / und wer hieß mich zu wandern aus dem Heimattal?“ Fälschlich unterstellt er der Freundin, Ähnliches zu empfinden: „Rauch-schwarze Stadt, du Lästerbank und Mörderzelle, / […] was weißt du viel von Einsamkeit in Frauenschößen, / vom Schrei nach dem Geliebten, wie ihn jene brüllt, / die ich betrog mit Wanderschaft.“ Er unterstellt, Schattke verbringe die Zeit ohne ihn als „blaß-verweinte“ Frau, die sich frage, „was jener treiben mag, der sich in Gram verfing / und wie ein Ausgewiesner in die Fremde ging.“22 Indes, die Freundin kann in Essen anscheinend gut ohne ihn leben.
In einem Brief an Wegener klagt Zech: „Was ich hier [in Berlin] an Enttäuschungen erlebt habe, bringt gut ein Drittel meines verflossenen Lebens zusammen.“ Das kulturelle Leben der Hauptstadt schildert er so, als sei der Text beim Antisemiten Münchhausen abgeschrieben: „Nichts wie Spiegelfechterei und übles Literatentum diktiert die Richtung der Kunst. Galizische Juden haben das Ruder und will man gegen den Strom schwimmen ist man unten durch. Alles Dreck und Fäulnis oben und unten.“23 Vergessen scheint die Hilfe, die ihm von Lasker-Schüler und Walden zuteil wird. Anscheinend wertlos sind für ihn auch die Freundschaften mit jüdischen Kollegen und Künstlern, wie etwa mit Hiller, dessen Lyrikanthologie er heimlich schlechtmacht. (In Erich Mühsams Tagebuch ist zu lesen: „Paul Zech schreibt einen netten Brief, in dem er mein [negatives] Urteil über die Kondorleute bestätigt, zumal meine Vermutung, dass er nur aus Versehen hinein gekommen ist und legt ein lyrisches Flugblatt bei ‚Waldpastelle‘.“)24
Anschließend lamentiert Zech weiter: „Man muss alle Nerven zusammenhalten, um nicht fortzugehen. Meyer ist schon angesteckt davon und ich werde mich hüten, noch ein zweites Buch dort zu verlegen.“ Alles läuft nicht so, wie er sich das gewünscht hat. Von Schattke getrennt und von Erspartem lebend, will er Ende des Sommers nur eines – weg aus Berlin und zurück ins Wuppertal: „Ich habe Sehnsucht nach Elberfeld und ich denke Ende des Monats wieder dort zu sein. Soll ich nun einmal hungern, kann es auch in Elberfeld sein. Da hab ichs billiger. […] Ein paar gute Verbindungen habe ich hier angeknüpft, die kann ich aber auch in Elberfeld pflegen.“ Er träumt von einer Idylle im Bergischen Land: „Was ich mir wünsche ist: ein kleines Haus irgendwo am Waldesrand.“
Zech schlägt Wegener vor, Hillers Anthologie „Der Kondor“ zu besprechen, und nennt ihm als Abnehmer für einen solchen Text die Zeitschrift „Xenien“. Bei dieser Gelegenheit bittet er: „Sie könnten dann eventuell den ‚Schollenbruch‘, der gar nicht abgeht, miterwähnen.“ Schuld am ausbleibenden Erfolg ist seiner Ansicht nach nicht das Werk, sondern mangelnde Reklame dafür von Seiten des Verlags. Insgesamt laufen in Berlin die Dinge für ihn jedoch nicht so schlecht, wie er Wegener glauben machen will. Am Ende des Briefs heißt es: „Das ‚Berliner Tageblatt“ habe ich auch halb gewonnen. Im ‚Zeitgeist‘ kommt eine Arbeit über Else Lasker-Schüler. Der ‚Weltspiegel‘ brachte kürzlich eine Novelle“.25
Spree-Bohème
Lasker-Schüler schickt Zech die Nachricht: „Lieber Dichter, ich bin wieder da. Wohne: Grunewald-Berlin. Humboldtstr. 13 II. Vordervilla 2te Querstraße über der Brücke von Halensee bei Enderlein.“ Sie möchte sich mit ihm verabreden: „Besuchen Sie mich heute Abend 9 Uhr? sonst bitte schreiben Sie vorher.“26 Im nächsten Brief gibt die Dichterin ein Kompliment weiter: „Hans Ehrenbaum-Degele sagt: ich bin geradezu entzückt von Paul Zech. Mit ihm möchte ich mich befreunden! Sie werden keine Reue haben. Ich bitte Sie seien Sie Sonnabend wie verabredet im Café des Westens. Halb 9 Uhr.“ Auf Elberfelder Platt erinnert sie sich an ihre Geburtsstadt: „Ich grüße Sie herzlich on emm Namen aller Färwer on Knoppmaker. Ihr Prinz von Theben.“27 Wie wichtig Lasker-Schüler die Treffen mit Zech sind, zeigt auch eine Karte, die sie ihm tags darauf aus Hessen schickt, wo ihr Sohn die Odenwaldschule besucht: „Ich bin Freitag wieder zu Haus. […] Schreiben Sie mir wann ob Freitag oder Sonnabend wir uns alle im Café treffen wollen. […] War sehr anstrengend, bin sehr kaput. Ihr Prinz Jussuf.“28
Mit seiner Antwort lässt sich Zech Zeit. Ihn beschäftigt ein Brief von Zweig, der ihm schreibt: „Ich habe mich sehr gefreut, […] von Ihnen einen außerordentlichen Essay über Mombert […] zu lesen, der alle guten Eigenschaften hat, Farbe, Maß und Gewalt. Auch sonst sah ich von Ihnen Verse und zwar sehr schöne.“ Dann heißt es: „Weniger erfreut bin ich über Ihren Zusammenhang mit den Kondor-Leuten, deren aufdringliches Wesen mir im tiefsten antipathisch ist und die den Lärm statt der Leistungen machen. Sie spüren ja wohl selbst, wie wenig dichterisch diese Lyrik ist.“ Nachdrücklich warnt Zweig vor der Berliner Bohème: „Sie selbst lieber Paul Zech, passen mir mit ihrer stillen, ruhigen und wahrhaft dichterischen Art in diesen Kaffeehauslärm schlecht hinein.“29
Verleger Meyer hat Kenntnis davon erhalten, wie gut sich Zech mit Else Lasker-Schüler versteht. Das möchte er für seine Zwecke nutzen und bittet ihn, die Dichterin als Mitwirkende für seinen „Zweiten Autorenabend“ zu gewinnen. Der soll bei der Buchhandlung „Reuß & Pollack“ in der Potsdamer Straße stattfinden: „Sie brauchte nur fünf bis sieben der biblischen Gedichte zu lesen.“ Um dem Vermittler die Aufgabe schmackhaft zu machen, lädt Meyer ihn zu sich nach Hause in die Waghäuseler Straße in Wilmersdorf ein: „Kommen Sie bitte Donnerstagabend halb 7 zu uns zum Butterbrot.“ Mit „uns“ meint er sich und seine Gattin Resi Langer. Die Ansage, es solle Butterbrot geben, ist entweder ein Scherz des Gastgebers, der ein bescheidenes Mahl ankündigt, oder Meyer will demonstrieren, wie wenig er an den Büchern und „lyrischen Flugblättern“ verdient, die bei ihm erscheinen.
Im Verlauf des Treffens möchte der Verleger auch herausfinden, ob der Gast ihm behilflich sein könnte, für eine seiner nächsten Veranstaltungen weitere Autoren zu gewinnen: „Stefan Zweig wäre fein.“ Abschließend warnt er vor Karl Kraus: „O, nur nicht in der ‚Fackel‘ inserieren. Ich tat es einmal und nicht wieder.“30 Da Meyer auf die Fürsprache Zechs bei Lasker-Schüler und Zweig hofft, ist er bemüht, ihn nicht zu verärgern. Deshalb lobt er seine Gedichte in einer ansonsten negativen Kritik von Hillers „Kondor“: „Zech, dessen ‚Waldpastelle‘, ‚Frühe Ernte‘, [recte: ‚Das frühe Geläut‘], ‚Schollenbruch‘ ich verlegte, und von dem ich anderes bald bringen werde, fällt ganz aus dem Rahmen radikaler Strophen, weil er im Grunde doch auf viel zu konservativen Füssen steht (im besten Sinne!).“31
Noch bevor Zech in den Genuss des Meyerschen Butterbrotes kommt, nimmt er eine Einladung von Lasker-Schüler an, die zurück in Berlin ist: „Peter Baum, Hans Ehrenbaum-Degele, Georg Koch, Ernst Blaß […] wir sind alle bei Dalbelli[s] italienischer Weinstube Bülowstraße 14 morgen Freitag um punkt neun Uhr. Bitte kommen Prinz von Theben.“32 Das Lokal ist ein Künstler- und Literatentreff. Es gehört zu den bevorzugten Aufenthaltsorten der Dichterin. Ehrenbaum-Degele nennt sie „ihren reinen Liebesfreund“ oder „Tristan“. Er stammt aus wohlhabender Familie. Den Eltern gehört eine luxuriöse Villa im Grunewald. Zeitschriften wie „Der Sturm“, „Pan“ sowie die „Bücherei Maiandros“ veröffentlichen seine Gedichte und Prosatexte. Mit ihm schließt Zech Freundschaft. Beide verabreden spontan eine Landpartie, gemeinsam mit Lasker-Schüler. Zech schildert dem Jüngeren seine schlecht bezahlte Tätigkeit als Mitarbeiter von Zeitungen und Zeitschriften, mit der er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie aufbringen muss. Beiläufig erwähnt er, es sei ihm bisher noch nicht gelungen, in Berlin eine feste Anstellung zu finden.
Ein weiteres Treffen, zu dem Lasker-Schüler ihre Freunde eingeladen hat, findet einen Tag nach der geselligen Runde bei Dalbelli im „Café des Westens“ statt, das im Volksmund „Café Größenwahn“ heißt. Hier lernt Zech einen Mann kennen, den die Dichterin so beschreibt: „näher besehen, hübsch aber – ein Rind“.33 Es handelt sich um Leopold Hubermann, Bruder des Violinvirtuosen Bronislaw Hubermann, einen problematischen Menschen, der seine Ehefrau misshandelt und sie hungern lässt. Er gehört zur Berliner Bohème, bezeichnet sich als Schriftsteller und hat keinen Pfennig in der Tasche. Zech entwickelt Sympathie für ihn, weil er zwar aus reichem Hause stammt, aber in Armut lebt wie er selbst: „Bis zum Jahre 1913 war keine Zeile einer dichterischen Leistung Hubermanns […] bekannt, obwohl er häufig genug auf unseren gemeinsamen Heimgängen, zwischen drei und vier Uhr morgens im Zuge der Kaiserallee bis zur Wilhelmsaue, Verse […] deklamierte.“34
Zu den Kulturschaffenden Berlins, die Zech durch Lasker-Schüler kennenlernt, gehört auch Karl Vogt. Er ist Darsteller am Königlichen Schauspielhaus, arbeitet als Regisseur an der „Neuen Freien Volksbühne“ und schreibt für Waldens „Sturm“. Die Dichterin portraitiert ihn mit Versen: „Karl Vogt / Der ist aus Gold – Wenn er auf die Bühne tritt, / leuchtet sie. / Seine Hand ist ein Szepter, wenn er Regie führt. […] / Er kann nur selbst den König spielen / Im Spiel. / Morgen wird er König sein / ich freu‘ mich.“35
Bald nach den durchzechten Nächten bei Dalbelli und im „Café Größenwahn“ erhält Zech zwei weitere Einladungen. Die erste schickt ihm Ehrenbaum-Degele. Der sagt die geplante Landpartie ab und kündigt ein Treffen an, das erneut in einem Weinlokal stattfinden soll: „Vergessen Sie aber nicht, selbst Sonnabend zu Lutter und Wegner (Keller!) Ecke Französische und Charlottenstraße zu kommen und A. R. Meyer samt Frau Dr. Hadwiger mitzubringen.“ Der Brief weckt bei Zech Hoffnungen auf ein baldiges Ende seiner Geldnöte, denn darin heißt es: „Sollten Sie noch keine Stellung haben, so könnten wir mal mit Schütze, Tägliche Rundschau, [einem] Bekannten meiner Eltern sprechen, vielleicht Freitag um elf Uhr?“ Darunter schickt Lasker-Schüler „Viele, viele Grüße – der Prinz von Theben“.36 Von ihr stammt die zweite Einladung: „Wir wollen uns morgen um 1 Uhr bei Aschinger treffen gegenüber Stadtbahn Friedrichstraße.“
Auf der Suche nach einer Festanstellung für Zech hat die Dichterin den Kollegen Gustav Landauer angesprochen. Der ist zu einem Treffen bereit. Sie weiß auch von den Bemühungen ihres „Tristan“ in gleicher Angelegenheit: „Hans Degele wird sich umtun[,] hat viele gute Freunde an Zeitungen will mit Ihnen darum sprechen. Also auf Wiedersehn morgen ein Uhr. Donnerstag.“ Wie selbstlos sie sich für andere einsetzt, obwohl sie persönlich leidet, zeigt der Schluss ihrer Nachricht: „Hatte heute sehr schwierigen Tag. Ihr Prinz von Theben.“ Unter der Zeichnung eines Kometen steht: „mir geht‘s sehr schlecht immer innere unmotivierte Angst“.37 Die ist begründet, denn Walden hat die Scheidung von ihr beantragt. Das Gespräch mit Landauer am nächsten Tag bringt ihrem Freund nichts. Er bleibt weiter ohne feste Anstellung.
Hilfe bei der Stellensuche bekommt Zech auch von Zweig. Der schickt ihm ein Empfehlungsschreiben für Paul Fechter, den Leiter des Feuilletons der „Vossischen Zeitung“. Bedauernd räumt er ein, beim „Insel Verlag“ nichts für ihn tun zu können. Seinerseits äußert er zwei Bitten: Zech solle erstens prüfen, ob das Barmer Theater sein neues Stück „Das Haus am Meer“ aufführen würde, und zweitens Alfons Petzold, einem jungen österreichischen Kollegen, der „aus den untersten proletarischen Berufen stammt und Ziegelarbeiter, Hausknecht und derlei mehr gewesen ist“, bei seinem Fortkommen helfen.38
Zech sagt beides zu. Dabei fällt ihm ein: „Gott, ich habe ja eine ähnlich harte Schule durchmachen müssen […]. Aber ich blicke auf diese harte Frohnzeit [!] mit mehr Liebe zurück, als auf andere, angenehmere Episoden meines Lebens. Und so werde ich auch wohl für Petsold [!] sicher Sympathie finden.“ Anschließend berichtet er von beruflichen Erfolgen: „Das Berliner Tageblatt hat sich sehr anständig benommen. Ich bekam ein festes Buchreferat, das heißt, ich bin der langen Reihe von Referenten angegliedert.“ Weiter teilt er mit: „Am Montag lese ich hier vor und ich hoffe mit Glück.“ Weniger erfolgreich ist er bei der Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft für sich und seine Familie. Nach wie vor logiert er als Untermieter bei Georg Koch: „Bis ersten November bleibe ich bestimmt noch in dieser Wohnung.“39
Beim „Zweiten Verlagsabend von A. R. Meyer“ in der Buchhandlung „Reuß & Pollack“ tritt Lasker-Schüler nicht auf, obwohl der Verleger sich das gewünscht hat. An ihrer Stelle liest Meyer selbst aus eigenen Werken. Zu Beginn der Veranstaltung stellt Anselm Ruest die Mitwirkenden vor, unter ihnen Else Hadwiger, Meyers Frau Resi Langer und Heinrich Lautensack. Zech rezitiert unveröffentlichte Gedichte. Im Publikum sitzt Ernst Blass. Der verfasst für Franz Pfemferts literarische Zeitschrift „Die Aktion“ einen gereimten Bericht über die Veranstaltung: „Lautensack am Meyer-Abend / Wirkte einfach, frisch und labend. […], / Dass sein Geist nicht aufgeweckt, / Ward ersetzt durch Dialekt. / […] Blieb der Beifall auch sehr schwach, / Lebhaft klatschte der Verlach.“ Ähnlich äußert er sich über den Auftritt des Verlegers und schließt: „O, ich möchte von Paul Zech‘en, / den ich schätze, hier nicht sprechen. / Nur Frau Resi Langer sei / Schnell erwähnt noch, eins zwei drei: / Las mit vielem schönen Fleiße / Schur und Ruest und Herrmann (-Neisse).“40
Mit seinem ersten öffentlichen Auftritt in Berlin ist Zech zufrieden. Stolz lässt er Wegener wissen, er habe „über Erwarten gute Presse gefunden“.41 Einen weiteren Erfolg meldet er dem Münchner Schriftsteller Heinrich Franz Bachmair: „Von der Vossischen Zeitung habe ich den Auftrag bekommen über Else Lasker-Schülers neuen Roman zu schreiben.“ Da der Kollege zugleich Verleger ist und das Werk der Freundin herausbringen will, fordert er ihn auf: „Senden Sie mir sobald wie möglich die Aushängebogen, damit ich noch vor dem Erscheinen im Buchhandel das Referat einsenden kann.“ Zusätzlich bietet er weitere Dienste an: „Interessieren wird es Sie ferner, dass ich vom Berliner Tageblatt das Referat über Lyrikbücher bekommen habe. Ich werde wohl in der Lage sein, die Versbücher Ihres Verlages zu rezensieren“.42
Zech informiert auch Wegener über die neue Aufgabe: „Für den Anfang wenigstens etwas. Zudem bin ich noch Lektor bei Oesterheld.“ Dieser Verlag beschäftigt ihn ebenfalls nur als freien Mitarbeiter. Beide Tätigkeiten sind schlecht bezahlt: „zum Leben ist das alles noch zuwenig“. Ihm bleibt nur eines übrig: „Ich muss noch gehörig Feuilletons schinden“. Ferner erfährt der Adressat: „Anfangs November erscheint bei A. R. Meyer mein ‚Schwarzes Revier‘ als Doppelflugblatt. […] Der zweite, eigentliche Gedichtband ‚Die Brücke‘ erscheint April bei Rowohlt.“ Von einer Rückkehr ins Wuppertal ist keine Rede mehr. Vielmehr heißt es im Brief: „Langsam, sehr langsam fasse ich in Berlin Fuß“, und „ich laß den Mut nicht sinken.“
Dennoch will Zech wissen, was sich im Wuppertal tut. Er fragt: „Haben Sie das neue Buch von Boeddinghaus gesehen?“ Bei diesem Herrn handelt es sich um einen Elberfelder Textilfabrikanten, der Mitte des Jahres als „Paul Jörg“ eine Lyrik-Sammlung mit dem Titel „Gekrönte Stunden“ herausgebracht hat. Dank reichem Buchschmuck von Fahrenkrog ist die Ausgabe zu einer protzigen Schwarte geraten. Der Künstler hat Zech beauftragt, die Neuerscheinung im „Volkserzieher“ zu besprechen, doch das erfährt Wegener nicht. Vielmehr wird dieser auf ein Thema angesprochen, das ihn selbst betrifft: „Im literarischen Zentralblatt [las ich] Ihre Kritik über Lissauers ‚Strom‘. Bei mir wird dieser unverschämte Jude nicht so glimpflich fortkommen. Ich sah ihn kürzlich im Lessingtheater. Er wiegt gut seine drei Zentner und ist der arroganteste Pimpf, den Berlin beherbergt.“43
Diese Drohung macht Zech wahr. In der Zeitschrift „Bücherei Maiandros“ zieht er über die erste Veröffentlichung Ernst Lissauers, „Der Acker“, her: „Geschminkte Pose und Association aus labyrinthischer Selbstbespiegelung. Ein programmatisches Gestammel. Bedeutungslos im Formalen und bemerkenswert in mancherlei Gedankenblitzen.“ Nicht anders fällt sein Urteil über dessen zweites Werk, „Der Strom“, aus: „angespanntester Willen zum Weltgedicht. Aber auch nur Willen. Nicht mehr. […] Schludern, Herr Lissauer, ist noch lange nicht Gebären.“ Einige Aussagen in diesem Beitrag ermöglichen Rückschlüsse auf die Ansichten des Rezensenten über gesellschaftliche Themen, wie beispielsweise die „richtige“ Geisteshaltung: „Zu rügen ist […] das bewußt Nationale in Versen [Lissauers], die an und für sich zu schwach sind, um solche falsche Monumentalität zu tragen. Es ist immer verdächtig, Gesinnungen, die selbstverständlich sind, in pathetischer Anpreisung zu kolportieren.“
Nationale Gesinnung betrachtet Zech demnach als Bürgerpflicht für jeden Deutschen. Aufschlussreich erweist sich auch die nachfolgende Aussage zum Judentum: „Else Lasker-Schüler und Lissauer sind Stammverwandte. Aber Else Lasker-Schüler hat den Mut zu bekennen: ‚Der Fels ist morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe.‘ Lissauer hingegen verleugnet das Brüchige des Rassefelsens und hüllt sich in bierselige, deutsche Philisterschwammigkeit. Er wird zum flagellantischen Renegaten.“ Zech geht so weit, Münchhausen gegen eine seiner Ansicht nach unberechtigte Kritik zu verteidigen: „die balladischen Stücke des Bandes [‚Der Strom‘] sind im Grunde konservativer, als der von Lissauer bekämpfte Konservatismus des Börries Freiherr von Münchhausen.“44
Wegener hat nichts gegen den gescholtenen Berliner Kollegen einzuwenden. Er unterscheidet zwischen Person und Werk: „Dass Lissauer als Mensch so widerwärtig ist, war mir unbekannt. Aus seinem ‚Strom‘ habe ich nichts davon gemerkt.“ Das Werk von Boeddinghaus, nach dem Zech gefragt hat, befindet sich nicht in seinem Besitz: „Können Sie mir nicht eins verschaffen?“ Am Ende seines Briefs gibt er ein Gerücht weiter: „Ringermann will gehört haben (von Ihrer Frau?), dass Sie gar nicht mehr zurückkommen.“45
Der Erdbeermund
In der Antwort an Wegener lässt Zech die Frage nach der Dauer seines Aufenthalts in Berlin offen und verrät über einen Besuch in Elberfeld lediglich: „Ich denke Mitte November da zu sein.“ Wichtig ist ihm dieser Tage, dass sein „lyrisches Flugblatt“ „Das schwarze Revier“ bald erscheint. Er erhofft sich davon ein ähnliches Aufsehen, wie es Gottfried Benns „Morgue“ zuteil geworden ist: „Meyer lässt 25 Exemplare auf Japan abziehen […]. Nach Meinung des Verlegers dürften sie bald vergriffen sein. Ludwig Kainer schneidet einen Originalholzschnitt dazu“. Beim Erscheinen trägt die Ausgabe auf der Titelseite jedoch eine Xylographie von Ludwig Meidner. Wegeners Bitte kann Zech nicht erfüllen: „Das Buch von Boeddinghaus […] werde ich Ihnen wohl kaum geben können, da ich mit dem Dichter (!) verkracht bin.“
Die Tätigkeit als Buchreferent macht Zech nicht immer Freude: „Erst gestern habe ich noch den Roman eines Barmers [Heinrich Reth: ‚Noch ist die blühende goldene Zeit‘] vermöbeln müssen. Wenn die Wuppertaler sich so wie dieser Onkel gebärden, retten sie für Elberfeld nichts.“46 Obwohl ihm das Werk missfällt, behält er ein sprachliches Bild daraus im Gedächtnis. Reth beschreibt die Lippen eines jungen Mädchens mit den Worten: „Der lustige Ausdruck um den Erdbeermund verschwand plötzlich.“47 Damit hat Zech die Metapher gefunden, mit der sein Name im 20. und 21. Jahrhundert verbunden sein wird.
Im weiteren Verlauf des Briefes bestätigt der Schreiber Wegeners Vermutung zum derzeitigen Aufenthalt eines Elberfelder Kollegen: „Dass Vetter in München ist, erfuhr ich. Er ist uns allen böse, da Meyer seine Verse […] zurückschickte. […] Sie waren zu schlecht.“ Danach behauptet Zech: „Denken Sie, ich schreibe jetzt einen großen Film aus dem Bergmannsleben. Da lässt sich vielleicht Geld mit verdienen.“48 Den passenden Titel hat er auch schon gefunden: „Der große Streik“. Möglicherweise ist er während des Butterbrotessens beim Ehepaar Meyer durch Resi Langers Schilderungen ihrer Erlebnisse in den Babelsberger Filmstudios auf diese Idee gekommen. Das erhoffte große Geld bleibt jedoch aus, da das Drehbuch, sofern es überhaupt existiert, nie verfilmt und nur sein Treatment veröffentlicht wird.
Der Münchner Verleger Bachmair hat die von Zech erbetenen Druckbogen zur Post gebracht und ihm mitgeteilt: „Was ein Essaibuch über Else Lasker-Schüler betrifft, bin ich gerne bereit es zu verlegen, nur wäre es mir unmöglich, Sie im voraus dafür zu honorieren.“49 Die Antwort aus Berlin lautet: „Auf einen Honorarvorschuß mach ich durchaus keinen Anspruch. Nur wäre es mir lieb, wenn Sie schon für die Vorausgabung des Romans einen Prospekt drucken ließen, und das Erscheinen des Essais darin anzeigten.“ Bei dem Text über das Werk der Freundin geht es Zech ausnahmsweise nicht ums Geld. Er macht Bachmair Vorschläge zu Aussehen sowie Verkaufspreis der Broschüre und ergänzt: „Ich würde mich verpflichten das druckfertige Manuskript bis zum ersten Februar zu liefern. Meines Erachtens sind die Frühjahrsmonate für die Bearbeitung der Presse am geeignetsten. Dann ist der Weihnachtssturm vorüber.“50 Lasker-Schüler lädt Zech ein, die geplante Publikation mit ihr zu besprechen. Außerdem will sie mit ihm über eine Reise ins Bergische Land reden.51
Den Auftritt in ihrer Heimatstadt hat Lasker-Schüler mit mehreren Briefen an den Vorsitzenden der Literarischen Gesellschaft vorbereitet. An Honorar verlangt sie keine 300 Mark wie üblich, sondern nur 200. Als Zech die Freundin am Sonntagnachmittag besucht, überredet sie ihn, auf ihre Kosten mit nach Elberfeld zu fahren. Zu Anfang der neuen Woche schreibt sie an Kerst: „Bitte holen Sie mich um vier Uhr morgen Dienstag vom Hotel Kaiserhof am Döppersberg [ab.] Wir sehen uns dann den Saal an […] Paul Zech kommt mit.“52
Die Reise nach Elberfeld verläuft wie geplant. Vor dem Treffen mit Kerst hat die Dichterin noch Zeit, sich im Atelier Bender fotografieren zu lassen. Aber die Lesung selbst wird eine Riesenblamage. Nicht für Lasker-Schüler, sondern für ihre Zuhörer aus dem „Muckertal“. Schon bald nach Beginn der Veranstaltung verlassen sie scharenweise den Saal. Ihnen missfallen sowohl Textauswahl als auch Vortragsweise der Dichterin. Kurzzeitig droht die Gefahr eines vorzeitigen Endes.53 Noch am selben Abend beschwert sich Lasker-Schüler mündlich bei Kerst und schriftlich bei einer Lokalzeitung über die gastgebende Gesellschaft sowie das Publikum. Dem Vorsitzenden der „Literarischen Gesellschaft“ gibt sie den Rat, künftig nur Dilettanten zu Lesungen einzuladen, die dem Geschmack der Zuhörerschaft besser gerecht würden.
Am Morgen nach dem Desaster trifft Lasker-Schüler mit Zechs Ehefrau, deren Mutter sowie seinen Kindern zusammen. Einen weiteren Tag später wird die Dichterin von ihrem Begleiter im Hotel abgeholt und er unternimmt mit ihr einen Ausflug ins Bergische Land, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Für beide ist es eine Genugtuung, dass ein Teil der örtlichen Presse den Vortragsabend lobt. Walden erhält eine Ansichtskarte, die das „Düsseltal. Am Steg“ zeigt. Auf der Rückseite steht: „Mit Else Lasker-Schüler bin ich nach hier gefahren. Es hat einen Skandal gegeben. Ich werde darüber im Sturm berichten. Einstweilen beste Grüße Ihr Paul Zech. Sonnabend bin ich wieder in Berlin.“54
Während der Rückfahrt leidet die Dichterin. Am Tag nach der Ankunft klagt sie: „Ich bin sehr krank. Ich fühl mich wenigstens so: auch fang ich an Hypochondrie zu leiden und das Bett wird immer ewiger, immer unentrinnbarer“.55 Paul teilt Helene auf einer Postkarte mit: „Liebes Herz, ich bin gut angekommen. Es kommt mir alles sehr fremd vor. Ich habe viel zu laufen, weil inzwischen viel eingelaufen ist. Anfang der nächsten Woche schreibe ich mehr. Was haben die Kinder gesagt?“ Im Nachsatz steht: „Rudolf hat […] geschrieben. Es geht ihm nicht gut.“56 Die beiden Brüder halten demnach zu dieser Zeit Verbindung miteinander.
Am Wochenende kauft sich Zech die neueste Ausgabe des „Volkserziehers“, die seine Besprechung des Buchs „Gekrönte Stunden“ von Boeddinghaus alias Paul Jörg enthält. Um Fahrenkrog zu schmeicheln, hat er ihn gebeten, ihm bei der Beurteilung von dessen eigenen Illustrationen zu helfen, die in diesem Werk enthalten sind, und daraufhin einen vierseitigen Text mit „Bemerkungen“ sowie die Anweisung erhalten: „Den hier so im Allgemeinen angedeuteten Maßstab legen Sie nun als urteilende Instanz wohl am besten selbst bei den einzelnen Blättern an. In manchem werde ich Ihnen wohl nichts Neues gesagt haben“.57
Zech scheint Boeddinghaus zu loben, wenn er schreibt: „Jörgs dichterische Wirkungen beruhen, soweit sie überhaupt zu durchleuchten sind, auf allerintimster, man könnte fast sagen, auf naturalistischer Beobachtung der anflutenden Geschehnisse […] unter völliger Ausschaltung des kühlen Intellekts.“ Das könnte mit anderen Worten ebenso gut heißen: „Das Buch ist unverständlich und geistlos.“ Realiter fährt der Rezensent fort: „Es wird eben darum nicht schwer sein, den Dichter Paul Jörg als einen Künstler zu bezeichnen, der unbedingt das Recht hat, gehört zu werden.“ Die Hälfte seiner Besprechung widmet Zech den Illustrationen Fahrenkrogs. Mit seinem Lob verunglimpft er wieder einmal das zeitgenössische Kunstschaffen: „Vor allem wird die souveräne Verachtung des sogenannten ‚Neuen‘ auffallen.“58
In der gleichen Ausgabe des „Volkserziehers“ erläutert Fahrenkrog zum soundsovielten Mal den Aufbau und die Ziele der „Germanisch-deutschen Religions-Gemeinschaft“. An den Anfang seines Artikels, der mit einem Hakenkreuz verziert ist, stellt er ein eigenes Gedicht: „Arbeit und Berufung“. Dessen letzte Zeile wird in verkürzter Form über dem Tor des Konzentrationslagers Auschwitz zu lesen sein: „Heil Arbeit! Du machst frei.“59
Nun muss sich Zech Angelegenheiten widmen, die während seines Besuchs in Elberfeld liegen geblieben sind. Dazu gehört ein Schreiben an Paul Block vom „Berliner Tageblatt“. Dem hat Lasker-Schüler ein Manuskript „Unser Café“ geschickt, in dem sie schildert, wie ihr im „Größenwahn“ Lokalverbot erteilt worden sei. Der Artikel ist bisher nicht erschienen. Zech hakt nach und behauptet, der Kellner habe seine Freundin aus dem Lokal gewiesen, weil sie nichts bestellen wollte. Blocks sarkastische Antwort lautet: „Wenn ich Millionär wäre, könnt ich versuchen, solche Dichtermiseren zu lindern. Leider bin ich nur Redakteur und als solcher dem Ungeheuer Publikum vorgeworfen. […] fünfhundert starrköpfige Abonnenten sind stärker als alle Dichter.“ Er denkt nicht daran, die Beschwerde drucken zu lassen und gibt Zech den Rat: „Das ist traurig, aber es ist so; und wenn wir es recht bedenken, ist es nicht einmal ganz so traurig, denn unser Leben besteht aus Kompromissen und wer das nicht glauben will, stirbt daran.“60 Lasker-Schüler veröffentlicht den Text später im Buch „Gesichte“ und das „Größenwahn“ verliert einen erheblichen Teil seiner Gäste endgültig ans „Josty“ am Potsdamer Platz.
Dieser Verkehrsknotenpunkt markiert die Mitte Berlins und ist in der zeitgenössischen Literatur ein beliebtes Thema sowie in der Kunst ein oft gewähltes Motiv. Ernst Ludwig Kirchner und Ludwig Meidner halten in den nächsten Jahren den Platz und das Geschehen darauf in ihren Bildern fest.61 „Die Aktion“ veröffentlicht ein Gedicht mit dem Titel „Auf der Terrasse des Café Josty“. Es stammt von Paul Boldt, der im westpreußischen Christfelde nahe der Stadt Culm in der Weichselniederung, weniger als 50 Kilometer von Zechs Geburtsort entfernt, geboren ist: „Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll / Vergletschert alle hallenden Lawinen / Der Straßentrakte: Trams auf Eisenschienen, / Automobile und den Menschenmüll.“62 Sein Landsmann aus Briesen beschreibt das Café in einem Prosatext: „Eine Insel ist diese Terrasse am Pol. Alle vier Winde, die so zusammentrafen, breiten ihren Raub sichtbar vor mir aus. Da lärmen Wagen, die den Geruch der Vorstädte wie schlechten Atem ausspeien.“63
Zech hat einen zweiten öffentlichen Auftritt in Berlin. Diesmal beim fünften Leseabend des literarischen Cabarets „Gnu“, der bei der Buchhandlung „Reuß & Pollack“ in der Potsdamer Straße stattfindet.64 Er trägt Verse aus seinen „Rotterdamer Impressionen“ vor und verschafft dadurch dem Publikum mit ungewohnter Offenheit Einblick in sein Leben.65 Von Lasker-Schüler hat ihn zuvor die Nachricht erreicht: „Warum kommen Sie nicht? Sie haben gewiss kein Geld wie‘s mir oft geht? Ich kann jetzt ohne Opfer zehn [Mark] entbehren – seien Sie zu mir nicht hochmütig und aber auch nicht ein Wort deswegen.“66 Die Dichterin ist bereit, ihm noch mehr von ihrem Honorar abzugeben, das sie in Elberfeld so schwer verdient hat. Obwohl es ihr schlecht geht, setzt sie sich auch bei Rowohlt für ihn ein. Mit diesem Verleger verhandelt Zech über die Herausgabe eines Buches. Ohne im Besitz einer Zusage zu sein, hat er Wegener mitgeteilt, sein Gedichtband ‚Die Brücke‘ werde im April dort erscheinen.“67
Am Abend des ersten November besucht Zech Lasker-Schüler. Morgens ist sie von Walden geschieden worden. Das Ehepaar hat schon zwei Jahre lang in Trennung gelebt. Dennoch belastet die Freundin das Aus ihrer Ehe schwer. Der Besucher bringt statt Blumen eine Tüte Äpfel aus Elberfeld mit und versucht der Freundin zu helfen, indem er von seinem Buch über ihr Werk berichtet. Am nächsten Tag bedankt sich Lasker-Schüler bei Zech für den Besuch und die „so selbstverständliche Güte“, mit der er ihr in dieser schwierigen Lebensphase beistehe. Weiterhin leidet sie: „Jetzt, wo ich kein Fieber mehr habe, fühle ich mich so schwach, als ob meinen Armen die Flügel gebrochen wären. Das Fieber hat mir noch die Illusion des Fliegens gegeben.“ Die von manchen Zeitgenossen als egozentrisch verschriene Dichterin ist, wie sich hier erneut zeigt, um das Wohl ihrer Mitmenschen auch dann besorgt, wenn sie sich selbst in Not befindet: „Aber ich spreche von mir und Ihnen geht es ebenso schlecht in allen Dingen“. Sie will Werfel schreiben, er solle sich bei Rowohlt für das neue Buch des Freundes einsetzen. Wegen einer Übernahme der Kosten, die beim Transport des Zechschen Mobiliars und Hausrats von Elberfeld nach Berlin anfallen würden, hat sie schon mit Ehrenbaum-Degele gesprochen.
Falls dieser Freund nichts geben sollte, will Lasker-Schüler Folgendes machen: „Heute verlange ich durch den Anwalt Uhr und Ring – wenn Sie das Geld für den Umzug nicht bekommen, versetzen wir [beide] sofort.“ Sie bestellt Grüße an Pauls Frau, seine Schwiegermutter sowie die beiden Kinder und lässt ihn wissen: „Ihre Äppel stehn noch auf dem Boden in der Düte. Ich hebe sie auf bis Sonntag.“ Die kranke Dichterin versucht, ihren Freund aufzubauen: „Also haben Sie Mut, die Sache wird schon schief gehen. Ihr armer Prinz von Theben.“68 Wenige Tage später treffen die beiden wieder zusammen. Das geht aus einem Brief des Schriftstellers Max Herrmann an seine Lebensgefährtin hervor: „Komme soeben vom Verlagsabend. Saß stundenlang mit Else Lasker-Schüler, Zech, Leonhard, Ehrenbaum-Degele, Peter Baum, Benn, Meyer zusammen.“69
Anfang November eröffnet Walden in seiner „Sturm“-Galerie eine Ausstellung mit Werken von Ludwig Meidner, Jakob Steinhardt und Richard Janthur. Das Trio hat sich als Gruppe den Namen „Die Pathetiker“ gegeben. Zech, der sich unter den Gästen der Vernissage befindet, kommt mit den drei Künstlern ins Gespräch. Ermutigt durch seine bisherigen Erfolge, schlägt er Meidner die Herausgabe einer Zeitschrift vor. Sie soll sich durch ein qualitätvolles Äußeres deutlich von anderen Blättern unterscheiden und weder auf billigem Papier noch in Massenauflage erscheinen.
Die Ausstellung der „Pathetiker“ erhält in der Presse überwiegend schlechte Kritiken. Hiller kämpft gegen diese Verrisse an, wobei er ein Fehlurteil fällt, indem er schreibt, Meidner unterscheide sich „erfreulich von jenen die gesamte Revolution kompromittierenden Russo-Münchnern a la Kandinsky, deren impotente und nichtmal dekorative Albernheit nur übertroffen wird von der Grandiosität ihres Hochstaplermutes.“70 Das schlechte Presse-Echo hält Zech nicht von dem Plan ab, mit den „Pathetikern“ zusammenzuarbeiten. Seine Reise zu einem Leseabend nach Frankfurt tritt er nicht an. Auch ein geplanter Besuch bei Hermann Meister vom Saturn-Verlag in Heidelberg und der in Elberfeld, den er angekündigt hat, entfallen.71 Grund dafür ist ein immer wieder aufgeschobenes Treffen mit Stefan Zweig, das nun in greifbare Nähe zu rücken scheint. Der Kollege schreibt: „ich komme also tatsächlich für den 19., 20. und 21. nach Berlin und freue mich sehr, Sie dadurch sehen zu können. […] Ich zähle darauf, Sie nun endlich kennen zu lernen.“72 Wegener erkundigt sich bei Zech: „Warum hört man nichts von Ihnen? Haben Sie schon einen Tag bestimmt, an dem Sie mit dem Dampfroß in unser ewiges Regennest hereingepoltert kommen? […] Hier geht das Leben seinen alten und schläfrigen Gang.“ Vor einem Monat hat er die Lesung von Lasker-Schüler in der Elberfelder Stadthalle besucht und gehört zu denjenigen, die an Werk und Person der Dichterin keinen Gefallen finden: „Über Else Lasker-Schüler habe ich noch hin und wieder nachgedacht. In meiner Friedlichkeit – sie nennts ja Dilettantismus – bin ich nicht gestört worden durch die Anzapfungen, auch ist mein Urteil durch ihren entflammten Zorn nicht anders geworden.“73
Zech „schindet Feuilletons“ und bemüht sich um die Festanstellung bei einer örtlichen Zeitung oder Illustrierten. Zwei Lichtblicke gibt es in seinem Alltag. Zum einen das Treffen mit Zweig, zum anderen der Besuch eines Leseabends von Resi Langer, die nochmals im Berliner „Architektenhaus“ auftritt. Als er nach Hause kommt, ist vom Wiener Kollegen die Mitteilung da: „ich bin für zwei Tage hier in Berlin. Morgen Mittwoch bin ich besetzt von zwei Uhr bis etwa vier Uhr, dann können wir uns treffen, vielleicht abends ab sieben Uhr bin ich im Hotel und habe Zeit bis Viertelzehn.“74 Zur verabredeten Zeit stehen sich die Briefpartner am 20. November 1912 im Hotel Fürstenhof erstmals persönlich gegenüber, nachdem sie zweieinhalb Jahre lang miteinander korrespondiert haben.
Wenige Tage nach dieser Begegnung fährt Zech nach Elberfeld, um Helene endgültig von der Notwendigkeit eines Ortswechsels zu überzeugen, den er selbst noch vor kurzem angezweifelt hat, und den Umzug der Familie zu organisieren. Er bemüht sich, in kurzer Zeit mit möglichst vielen Bekannten zusammenzukommen. Die Verbindungen ins Wuppertal möchte er pflegen, weil hier immer noch leichter Beiträge an Zeitschriften und Zeitungen zu verkaufen sind als in der Hauptstadt.
Zech trifft auch Robert Renato Schmidt, den er vor Jahren bei den Veranstaltungen der „Literarischen Gesellschaft“ kennengelernt hat. Der elf Jahre Jüngere, dessen Vornamen laut Geburtsurkunde „Robert Wilhelm Johann“ lauten, zeigt literarische Neigungen. Im Heidelberger Verlag von Hermann Meister hat er schon Gedichte veröffentlicht75 und in diesen Tagen erscheint von ihm bei A. R. Meyer ein weiteres „lyrisches Flugblatt“: „Frauen“.76 Mit dieser Nummer geht der Verleger kein Risiko ein, denn die Eltern des Autors haben alle Kosten im Voraus beglichen. Schmidt stammt aus einer reichen Familie. Er kann sich nicht entscheiden, ob er studieren möchte und, falls ja, welches Fach. Sein Vater, der Chemiker Dr. Robert Emanuel Schmidt, ist Vorstandsmitglied der Farbenfabriken Bayer. Die Familie besitzt im Elberfelder Zooviertel eine Jugendstilvilla. Dem jungen Mann vertraut Zech an, er beabsichtige, in Berlin eine eigene Zeitschrift erscheinen zu lassen. An diesem Projekt wolle er ihn nicht nur als Autor, sondern zugleich als Herausgeber beteiligen.
Eine Ansichtskarte vom „Café Josty“, die Zech in Elberfeld erreicht, macht ihm Hoffnung auf eine schnelle Lösung seiner finanziellen Probleme. Lasker-Schüler weist ihn an: „Sofort nach Berlin kommen. Sich bei Ludwig Kainer vorstellen, werden wahrscheinlich Redakteur am Simplicissimus. 250 Mark Gehalt, aber nichts sagen. Prinz von Theben.“77 Den Mitarbeiter des Satireblattes und dessen Gattin, die Künstlerin Lene Schneider-Kainer, kennt sie durch Walden. Das Ehepaar wohnt in Steglitz. Häufig sind dort Schriftsteller, Maler und Musiker zu Gast. Entgegen Lasker-Schülers Annahme ist Kainers Einfluss jedoch nicht groß genug, um Zech beim „Simpl“ als Redakteur unterzubringen, er kann aber künftig als freier Mitarbeiter Beiträge für die Zeitschrift liefern. Seine wirtschaftliche Situation verbessert sich dadurch nicht wesentlich.
Lene Schneider-Kainer: Else Lasker-Schüler Öl auf Leinwand, 1913
Nach der Rückkehr in die Hauptstadt schreibt Paul an Helene: „Hast Du schon der Packer wegen gehört?“78 Nicht nur das ist geschehen. In Elberfeld stehen die Möbel und Transportkisten bereit zur Abholung. Dem Familienoberhaupt selbst ist es endlich gelungen, in Berlin eine passende Unterkunft zu finden. Verleger A. R. Meyer, zu Hause in Wilmersdorf, Waghäuseler Straße 8, hat ihn auf eine leerstehende Wohnung aufmerksam gemacht, die sich bei ihm um die Ecke befindet. Sie liegt im dritten Stock des linken Seitenflügels der Babelsberger Straße 13. Das neue Zuhause der Zechs ist um einiges größer als ihre Mansarde in Elberfeld. Es verfügt über ein Wohnzimmer mit Balkon, eine Küche, zwei Kammern und ein Schlafzimmer. Die Familie zieht in einen Stadtteil, der von Künstlern als Quartier bevorzugt wird. In unmittelbarer Nachbarschaft logieren Gerhard Marcks und Richard Scheibe. Die Ateliers von Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein befinden sich in der wenige hundert Meter entfernten Durlacher Straße 14, heute: 15/15 a.
Bachmair mahnt den Vertrag zur Veröffentlichung der Essays über Lasker-Schüler an, den er noch nicht erhalten hat. Zech entschuldigt das Versäumnis, indem er auf den Umzug seiner Familie hinweist, und schickt das Papier mit dem Vermerk zurück: „Eine kleine Abänderung habe ich mir erlaubt. Sie werden verstehen, wenn Sie meine wenig rosige finanzielle Lage in Betracht ziehen.“79 Ohne Rücksprache mit Bachmair zu nehmen, ist von ihm sein Honorar beträchtlich erhöht worden.
Aus Elberfeld hat Zech einen „Kalender für das Bergische Land 1913“ mitgebracht, weil darin außer dem Gedicht „Sommernacht“, das von ihm stammt, Beiträge von Bloem, Idel, Carl Robert Schmidt und weiteren Kollegen stehen, die er gut kennt.80 Seine besondere Aufmerksamkeit gilt einer Erzählung in Elberfelder Mundart: „Kal em Glöck“. Sie stammt von Paula Buschmann, geborene Rehse.81 Schnell werden in ihm Erinnerungen an die frühen Jahre im Bergischen Land und an seine Jugendliebe wach. Er schreibt ein Feuilleton „Zwei Rosen“ und veröffentlicht es in der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung“, bei der er sicher sein kann, Paula werde den Beitrag zu Gesicht bekommen.82
Im Verlag von A. R. Meyer erscheint das „zweite Buch der Bücherei Maiandros“ mit Zechs Verriss des Lissauer‘schen Lyrikbandes „Der Strom“.83 Zur gleichen Zeit gibt Meister im Saturn-Verlag „Eine Anthologie der jüngsten Belletristik“ heraus, die überwiegend expressionistische Prosa enthält. Sie trägt den Titel „Flut“. Vertreten sind darin Zech mit „Herbstabend“ sowie Zweig, Brod, Lasker-Schüler und fünfzehn weitere Autoren.84 Für Lasker-Schüler plant der Verleger ein Sonderheft des „Saturn“, das ausschließlich ihrer Person und ihrem Werk vorbehalten sein soll. Zech hat sie dafür, ohne eine mögliche Vergütung zu erwähnen, um Überlassung ihres Gedichtes „Jakob“ sowie jenes Fotoportraits gebeten, das in Elberfeld aufgenommen worden ist. Die Dichterin reagiert anders, als er erwartet: „Ich fordere für das Gedicht Jakob mit dem Bild 25 Mark. Ich kann unmöglich noch ohne Honorar schreiben. Sonst bitte ich das Gedicht mit Bild retour. Kenne ich den Herrn Meister aus Elberfeld? Gruß Prinz von Theben.“ Auch die Pläne des Freundes zur Gründung einer Zeitschrift gefallen ihr nicht. Postskriptum mahnt sie: „Ich würde mich sehr besinnen mit der Monatsschrift (faule Sache).“85
Mitte Dezember trifft in der Babelsbergerstraße das Zech‘sche Umzugsgut aus Elberfeld ein und der Familienvater holt Frau und Kinder vom Anhalter Bahnhof ab. Von nun an muss er nicht mehr für zwei Haushalte aufkommen, aber seine finanziellen Probleme bleiben. Ein Gedicht, das vor Monaten schon im „Sturm“ gestanden hat und an Weihnachten nochmals im „Prager Tagblatt“ erscheint, gibt darüber Aufschluss: „oh immer die Sorge ums liebe Brot: / Hungern heißt atmen, Sattsein ist Tod. / Leblose Speichen sind wir am Riesenschwungrad.“86 Am gleichen Tag veröffentlicht die Zeitschrift „Der Niederrhein“ ein weiteres Gedicht von Zech: „Weihnachtsfreude“. Dessen erste Strophe endet: „Sieh, der Stern, den wir in Alltagshast verloren / Strahlt durchs Dunkel: Christus ward geboren, / Freue dich, o Christenheit.“87 Als Fahrenkrog die Verse liest, ärgert er sich. Vor wenigen Monaten erst hat ihn der Verfasser im gleichen Blatt als Stifter der „Germanisch-deutschen Religions-Gemeinschaft“ gefeiert. Nun ist ihm ein wichtiges Mitglied seiner Sekte abhanden gekommen, das sich zudem wieder zum Christentum bekennt.
Nach den Feiertagen erreicht Zech ein Brief von Bachmair, dessen Inhalt ihm Silvester und Neujahr verdirbt: „Lasker-Schüler schrieb uns heute, dass ihr Essai-Buch ‚Gesichte‘ […] in einem anderen Verlage erscheinen werde. […] Wir haben nunmehr nach Abgabe dieses Werkes wenig Interesse mehr an Ihrem geplanten Buch über die Dichterin.“88 Somit bleiben Einkünfte aus, mit denen er fest gerechnet hat.
Begegnung mit Franz Marc
Lasker-Schüler lädt zu einem neuen Treffen Freunde und Bekannte ein, unter ihnen das Ehepaar Kainer, den Bildhauer Koch sowie die Schriftsteller Baum, Ehrenbaum-Degele und Zech. Es findet am vierten Januar in der Josty-Dependance am Zoologischen Garten statt. Dort hält sie eine Überraschung bereit. An diesem Samstagabend stoßen Franz Marc und seine Frau Maria zu der Caféhausrunde. Die Eheleute folgen damit einer Einladung der Dichterin, mit der sie seit einigen Monaten im Briefwechsel stehen und deshalb ihre Not kennen. Sie haben ihr vorgeschlagen, für einige Zeit zu ihnen nach Sindelsdorf in Bayern kommen, und planen eine Hilfsaktion zu ihren Gunsten.
Ehrenbaum-Degele und Zech berichten Marc von den Plänen für eine Zeitschrift, die sie zusammen mit den „drei Pathetikern“ herausbringen wollen. Der Künstler sagt zu, Zeichnungen von sich und Heinrich Campendonk zur Verfügung zu stellen, sobald er wieder zurück in Bayern sei. Damit scheinen die ersten Träger großer Namen für das Projekt gewonnen, da auch Zweig wissen lässt: „Ich freue mich sehr auf Ihre neue Zeitschrift und bin selbstverständlich einverstanden, dass Sie den Absatz aus dem Verhaerenbuche honorarfrei zu Abdrucke bringen und will Ihnen auch gerne ein Gedicht zu Verfügung stellen.“ Auf diese Zusage hin ist auch der Name für die Zeitschrift gefunden: „Das neue Pathos“. So lautet der Titel des Zweig‘schen Beitrags, den die Herausgeber für ihr Blatt übernehmen.89 Nur unwillig folgt Zech einem Hinweis Zweigs, der lautet: „Auch Lissauer, den Sie wohl nicht ausschalten wollen, wird Ihnen gerne etwas geben; berufen Sie sich da bitte nur auf mich.“90 Um den Wiener Freund nicht zu verprellen, muss er den missliebigen Kollegen zur Mitarbeit auffordern, und das wenige Tage nachdem er dessen neuestes Werk verrissen hat.
Auf der Suche nach Autoren wendet sich Zech an den Niederländer Jan Greshoff: „Ich möchte gern ein paar neue bedeutende holländische Lyriker kennen lernen […], die etwa von 1875 [bis] 1885 geboren sind. Würden Sie vielleicht die Güte haben, und mir die Dichter und deren charakteristische Bücher nebst Verleger nennen?“91 Er behauptet, Abonnent von Greshoffs Zeitschrift „De witte mier“ („Die weiße Ameise“) zu sein, was nicht der Fall ist, denn dazu fehlt ihm das Geld. Derzeit weiß er nicht, ob er am nächsten Monatsersten die Wohnungsmiete bezahlen kann.
Wie gewünscht erhält Zech aus Holland mehrere Bücher und bestätigt Greshoff die Sendung. Nach seinem bisherigen Schaffen befragt, antwortet er: „Sie haben schon recht vermutet. Ich bin seit Jahren im ‚Sturm‘ mit Gedichten vertreten“. Weiter diktiert ihm seine Phantasie: „Vor einigen Monaten bin ich auch in die Redaktion dieser Zeitschrift getreten.“ Als Ort seiner Herkunft gibt er an: „Ich bin aus dem Rheinland gebürtig. Elberfeld.“ Für die Jahre im Ausland erfindet er: „Ich war lange in Geldern, sodan [!] in Amsterdam lange Jahre, auch in Rotterdam als Korrespondet [!] in kaufmännischen Stellungen. Bei einer Rotterdamer kunstbegeisterten Familie lernte ich die holländische Literatur kennen und lieben.“ Nach konkreten Hinweisen auf Bücher und Artikel, die er geschrieben hat, geht erneut die Phantasie mit ihm durch: „Für die von meinem Verleger geplante Anthologie der Lyrik aller heutigen Dichter, werde ich die Holländer gemeinsam mit meinem Bruder übertragen, der des Holländischen in Wort und Schrift so mächtig ist wie des Deutschen.“ Den Vornamen des Bruders nennt er nicht, aber weder Rudolf noch Robert oder Gustav können eine Laufbahn vorweisen, wie Paul sie erfindet: „Er war etwa zehn Jahre in Holland und seinen Kolonien als Kaufmann.“ Über seine eigenen Sprachkenntnisse teilt er mit: „Ich selbst kann das Holländische nur mittelmäßig. Das heißt, für Konversation und Korrespondenz reicht es aus.“92
In Waldens „Sturm“-Galerie wird am 15. Januar 1913 die erste deutsche Ausstellung mit Werken von Robert Delaunay eröffnet. Der Künstler ist zusammen mit Guillaume Apollinaire angereist. Bei der Vernissage lernt Zech beide Herren kennen und stellt sich ihnen als Schriftsteller vor. Sein französischer Kollege hält sich während des Berlinbesuchs unter anderem in der Königlichen Bibliothek auf. Darüber schreibt er: „ich machte mich mit einem Leser bekannt, dessen Gesicht mir sympathisch war. Er erläuterte mir die literarischen Vorlieben der Deutschen.“ Dieser Zufallsbekannte nennt ihm die Namen von Altenberg, Hille, Scheerbart, Ehrenstein, Döblin und Zech. Apollinaire notiert: „Der Dichter Paul Zech war früher Bergmann in Holland und Westfalen.“ Das beruht ebenso auf einer falschen Auskunft, die er bekommen hat, wie die Behauptung: „All diese Autoren wohnen in Berlin und versammeln sich im Café Josty um Herwarth Walden“.93 Nicht Walden ist Mittelpunkt der Gruppe, sondern dessen geschiedene Gattin.
Auf mehrere Briefe und Karten von Greshoff reagiert der Empfänger nicht sofort. Deshalb entschuldigt er sich: „Ich war einer Ausstellung wegen in Budapest. Gestern bin ich hier wieder eingetroffen und traf zum Glück noch M[onsieur] Robert Delaunay und Guillaume Apollinair [!] hier an. Delaunay hat bei Walden ausgestellt.“94 Da ihm aus Holland Verweys Hommage „De Schilder. Aan Kandinsky“ („Der Maler. An Kandinsky“) zugestellt worden ist, teilt er Greshoff mit: „das Gedicht von Albert Verwey an Kandinsky wird in der nächsten Sturmnummer veröffentlicht“. Zur Mitarbeit an der Zeitschrift des Kollegen aufgefordert, erklärt er: „Für den ‚Witte Mier‘ will ich sehr gern einen Artikel schreiben“. Der Beitrag erscheint unter dem Titel „Berlinische Brief: Over de jongste duitsche Lyriek“. Beginnend bei Liliencron geht Zech auf das Schaffen von mehr als zwanzig Zeitgenossen ein. Unter dem Beitrag findet sich von Greshoff eine freundliche Vorabbesprechung der ersten Nummer des „Neuen Pathos“.95
Die „Druckerei für Bibliophilen“ (!) liefert im Januar „Das schwarze Revier“ aus.96 Erich Mühsam lobt es: „Zech ist im ‚Kondor‘ nur mit einigen nicht sehr belangvollen aber sauberen Landschaftspoesien vertreten. In […] ‚Das schwarze Revier‘ stellt er sich erst als tüchtiger selbständiger Kerl vor, der besonders die soziale Not der Zeit poetisch-kräftig erfasst hat.“97 Angesichts des Erfolges, den das „lyrische Flugblatt“ erzielt, verbreitet der Verfasser die Legende, vor allen anderen Kollegen den Bergbau als Thema in die deutsche Literatur eingeführt zu haben. Ein Exemplar schickt Zech mit persönlicher Widmung an Apollinaire.98
Aus Sindelsdorf meldet sich Franz Marc bei Zech: „Ich schicke Ihnen mit gleicher Post eine Rolle, enthaltend zwei Zeichnungen von mir und vier Zeichnungen von Heinrich Campendonk. Suchen Sie sich bitte von den Blättern aus, was und wieviel sich für Ihre Zeitschrift eignet.“99 Der Empfänger reicht die Arbeiten an Meidner weiter, weil dieser für die Sparte Bildende Kunst in der Zeitschrift zuständig ist. Gegenwärtig portraitiert der Künstler zeitgenössische Schriftsteller, darunter Zech. In seinen Erinnerungen heißt es dazu: „[Er] machte den Eindruck eines slawischen Typs mit Sattelnase; er war immer, auch an trüben Tagen, in gleicher Weise aufgekratzt.“100
Meidner bestätigt Marc: „Zech und ich haben Ihre und Herrn Campendonks Zeichnungen erhalten und je eine […] ausgewählt.“ Dennoch erscheinen beide Werke später nicht im „Neuen Pathos“. Dafür kann Geldmangel die Ursache sein, wie sich aus den folgenden Sätzen ergibt: „Es wäre uns natürlich lieber wenn wir […] Zeichnungen von Ihnen erhalten könnten die sich durch Strichätzung vervielfältigen lassen. Von jenen getönten Blättern müssen wir Autotypien herstellen lassen und das ist natürlich sehr teuer.“ Möglicherweise fordern aber die Künstler selbst ihre Werke zurück, weil Meidner den Vorbehalt äußert: „Herrn Campendonks Zeichnungen sind von hohem Geschmack, aber ihre Frömmigkeit, Einfalt und Strenge passt nicht gut zur Haltung des ‚neuen Pathos‘. Wir Maler möchten ein wenig Aufruhr und Trompetengeschmetter in die Seiten dieser Zeitschrift bringen.“ An der Hilfsaktion für Else Lasker-Schüler, die das Ehepaar Marc gestartet hat, will sich Meidner nicht beteiligen. Gründe dafür nennt er nicht, sondern konstatiert lediglich: „Berlin ist ein zynisches Pflaster; sie lassen einen hier achselzuckend krepieren.“101
Auf eine Anfrage von Wegener hin macht Zech nur vage Andeutungen, was ihn zum Artikel über die „Gekrönten Stunden“ von Paul Jörg veranlasst hat: „Dass mein literarischer Stunk in Sachen Boeddinghaus vielen meiner Freunde sehr rätselhaft vorkam, ist begreiflich und ich mag mich dagegen auch nicht wehren, da ich es noch nicht an der Zeit halte, diesen schönsten Witz meines Lebens aufzublähen.“ Erläuterung findet jedoch, welche Zugeständnisse ihm beim Schreiben abverlangt werden: „Zeitungskritiken sind für mich nur ein proletarisches Nachder-Decke Strecken. In den seltensten Fällen kann man reden wie einem der Schnabel gewachsen ist. […] Nur was ich in meinen Büchern gebe ist mein reines Blut.“ Er hofft, in zwei bis drei Jahren überwiegend von deren Honoraren leben zu können, obwohl es zurzeit nicht danach aussieht: „Ein Novellenbuch und ein Versband liegen fertig ohne für einen Verleger in Frage zu kommen.“102
Im Februar-Heft des „Saturn“ erscheint von Leopold Hubermann der Beitrag „Bohème“. Darin diagnostiziert er die nächtlichen Zusammenkünfte der Berliner Künstler und Schriftsteller in ihren Stammcafés: „Die Bohèmes sind Psychologen, ein Herdenwesen hat nicht Eigenseele, das heißt [sie] gehen auf Seelenraub; sie kundschaften drum begierig einander ihre Geheimnisse aus – wehe dem, der sie preisgibt, er hat sein Geheimnis, seine Seele verloren.“103
Zech gehört nun fest zur Literaten-Szene Berlins. Das zeigt ein anonymer Beitrag zu Fasching in Nummer drei der „Bücherei Maiandros“. Dessen Verfasser zieht zeitgenössische Autoren durch den Kakao: „Einstein ist kein Stein. Jede Zeit hat den Kondor, den sie verdient. Wer andern Gruben gräbt, zecht selbst darin. Das Pfemfern ist des Hillers Lust. […] Das Gebet des alten Lissauers vor der Schlacht. […] Morgenstern hat Boldt im Munde.“ Es folgt die Variante: „Morguenstunde hat Benn im Munde“.104 Das Beiblatt des Buches enthält Zechs Essay „Karl Kraus in Berlin“. Darin geht der Autor auf die zahllosen Fehden innerhalb der Berliner Szene ein: „Wann endlich wird einmal einer den Gotha für die nicht mehr auszukennenden Verästelungen innerhalb der großen Literaturfamilie, der vielen zwieträchtigen, einträchtigen und stupiden Lager herausbringen?“105 Der Beitrag erscheint im Verlag von A. R. Meyer und nicht im „Sturm“, weil die Zusammenarbeit von Walden und Kraus vor einem Jahr zu Ende gegangen ist.
Aus München bekommt Zech Post von Wassiliy Kandinsky. Den hat er um ein Exemplar des Almanachs „Der blaue Reiter“ sowie um eine Handzeichnung für das „Neue Pathos“ gebeten. Der Künstler zeigt sich großzügig: „Ich habe Piper den Auftrag gegeben, Ihnen ein Belegexemplar zu schicken. Da das Buch in 300 Exemplaren erschienen ist, so ist die Anzahl der Belegexemplare sehr beschränkt: 10 Stück!“ Dem zweiten Wunsch will er auch entsprechen: „Für Ihre Zeitschrift sende ich Ihnen dieser Tage eine schwarz-weiße Zeichnung. Wenn ich mal wieder später zum Holzschneiden komme, stelle ich Ihnen gerne auch einen Stock zur Verfügung. Dafür müßte ich aber Ihr Format kennen.“ Zechs Vorschlag, das Gedicht „De Schilder. Aan Kandinsky“ von Albert Verwey auf Deutsch bei Walden zu veröffentlichen, stimmt er zu: „Wolfskehl übersetzte mir den Inhalt des Gedichtes, welches wirklich sehr schön ist. Es freut mich sehr zu hören, dass Sie eine Übersetzung in den ‚Sturm‘ bringen wollen.“106 Wie wenig der Schriftsteller und Übersetzer Karl Wolfskehl den Kollegen Paul Zech schätzt, ahnt der Künstler nicht.
Von Kandinsky ist schon am Vortag an Verwey die Mitteilung ergangen: „ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das schöne starke ausdrucksvolle Gedicht […]. Mir fehlt leider die Möglichkeit die Form des Gedichtes zu genießen […]. Ich habe aber gehört, dass Paul Zech das Gedicht ins Deutsche übertragen will“.107 Die Mitteilung löst bei Verwey Befremden aus und Kandinsky schickt in der Folge keine Arbeit nach Berlin. Dem „Neuen Pathos“ entgeht deshalb ein Werk aus dem Künstlerkreis des „Blauen Reiters“.
Zu Jahresanfang hat Zech Verhaeren auf die im „Panther“ publizierte Neufassung seines ursprünglich in der Barmer ‚Allgemeinen Zeitung‘ erschienenen Beitrags aufmerksam gemacht und ihm drei der Nachdichtungen von „Les heures“ mit der Bitte zugesandt, sie veröffentlichen zu dürfen. Das Schreiben ist vom Empfänger mit der Frage nach Wien weitergeleitet worden: „Très cher Zweig, / Je reçois la lettre suivante de M. Zech. Il y joint trois de mes poèmes traduits par lui. Que faut-il que je lui réponde et qui est ce traducteur?”108 („Lieber Zweig, ich habe folgenden Brief von Herrn Zech erhalten. Er hat drei Gedichte von mir beigefügt, die von ihm übersetzt worden sind. Was soll ich ihm antworten und um wen handelt es sich bei diesem Übersetzer?“) Zweigs Antwort ist verloren gegangen. Zech bekommt keine Antwort aus Belgien und wendet sich ein zweites Mal an Verhaeren: „Heute kann ich Ihnen wiederum einen kleinen Aufsatz über die Stunden beifügen. Und ich erlaube mir noch einmal die Anfrage: darf ich die Übersetzungen aus Ihren Versen in einer kleinen Zeitschrift veröffentlichen?“109 Zwar ist eine Zusage nicht überliefert, doch dürfte sie erteilt worden sein, denn die Übertragungen erscheinen im „Neuen Pathos“ und in den „Weißen Blättern“.
Die von Walden gezeigte Delaunay-Ausstellung hat Erfolg. Als der Künstler und Apollinaire längst abgereist sind, trifft sich die Berliner Avantgarde in der „Sturm“-Galerie, um über die Bilder des Franzosen zu diskutieren. Anlässlich einer solchen Zusammenkunft schickt der Hausherr Dehmel eine Postkarte: „Verbindliche Grüße an Sie und Ihre Frau“. Zu denen, die mit unterschreiben, gehört auch Zech.110 Dieser unterstützt einen zweiten Spendenaufruf zugunsten von Lasker-Schüler, den Kraus in der „Fackel“ veröffentlicht. Außerdem beteiligt er sich an den Vorbereitungen für eine Berliner Benefizveranstaltung. Die Dichterin hält sich zurzeit in München auf und bittet ihn: „sprechen Sie ein paar Worte auf dem Podium vorher am 9. [Februar,] dass ich der Prinz von Theben bin und, dass es sich nicht um Bettelei aber um Tribut handelt. So retten Sie dem Prinzen seine Ehre.“111 In bergischer Mundart äußert sie noch den Wunsch: „Kömm ens morgen om 6 Uhr 42 om Anhalter-Bahnhof morgen Freitag eck komm weher on freue meck Deck tu sehnn. On größ Ding Weib on Dinne Blagen van meck.“112 („Komme bitte morgen um 18:42 Uhr zum Anhalter-Bahnhof. Morgen Freitag. Ich komme zurück und freue mich Dich zu sehen. Und grüß‘ Dein Weib und Deine Kinder von mir.“)
Zech holt die Dichterin ab. Auch spricht er vor der Lesung einige Worte zu ihrem Schaffen. Tags darauf erscheint im „Berliner Tageblatt“ der erste Teil seiner Einführung in das Werk der Freundin. Feuilleton-Chef Block verweist vorab auf die Spendenaktion von Kraus. Den Artikel Zechs ergänzt er so: „Der ‚Zeitgeist‘ bringt hier ein von Liebe und Verständnis gezeichnetes Portrait der Dichterin. Möge es die gute Sache fördern.“113 Sein Wunsch geht nur zum Teil in Erfüllung. Zwar kommt einiges Geld zusammen, aber die Hilfsaktion löst auch bösartige antisemitische Reaktionen aus.
Walden nimmt Zech weder die Huldigung an Kraus übel noch die Freundschaft mit seiner geschiedenen Frau. Er widmet ihm sogar eine ganze Ausgabe des „Sturm“.114 Das Portrait des Autors auf dem Titelblatt stammt von Meidner. Direkt daneben steht die Übertragung des Verwey‘schen Gedichts „Der Maler. An Kandinsky“ mit den irritierenden Verfassernamen: „Paul Zech und Reek“. Bei dieser Angabe handelt sich um ein Missverständnis innerhalb der Redaktion. Möglicherweise ist mit „Reek“ Zweig gemeint. Im Innenteil der Nummer finden sich drei Gedichte Zechs: „Der Agitator“, „Die Ahnungslosen“ und „Der Kohlebaron“, ergänzt von Meidners Titelzeichnung für „Das schwarze Revier“ sowie Rudolf Leonhards Besprechung dieses „lyrischen Flugblattes“.
Das „Sturm“-Heft findet nicht nur Beifall. Die Übertragung der Verse „De Schilder“ löst auch Kritik aus. Wolfskehl fragt Verwey: „Haben Sie die sehr schlechte Übersetzung Ihres schönen Kandinsky-Gedichtes in dem Rüpelblatt ‚Sturm‘ gesehen? […] ich hätte gern eine dichterische Traduktion gemacht wenn mir die ‚Sturm‘-Version nicht den Spaß verdorben hätte.“115 Mit einiger Verspätung erhält er Antwort: „Eben wegen des ‚Sturm-Versuchs‘ würde es mich freuen, wenn noch jetzt eine gute Übersetzung erschiene. Die Verdeutschung [Zechs] ist scheußlich. Sie hat keine einzige gute Zeile; gibt auch den Sinn nirgends wieder.“ Über das Zustandekommen dieser Fassung lässt Verwey wissen: „Sie erschien ohne meine Einwilligung, wurde mir einfach nach der Erscheinung zugesandt. Nach meiner Gewohnheit habe ich nicht geantwortet, bin auch auf sonstige Annäherung der Redaktion nicht eingegangen.“116
Zech schreibt an Dehmel: „Auf Veranlassung meiner Kameradin Else Lasker Schüler sandte ich Ihnen mein lyrisches Flugblatt ‚Das schwarze Revier‘. Ich bin sehr begierig zu wissen, welchen Eindruck diese Verse auf Sie gemacht haben und wie Sie darüber denken.“ Seine Verbundenheit mit der Dichterin wird durch das Wort „Kameradin“ und den Hinweis deutlich: „wir beide sind aus Elberfeld“. Ebenso wenig wie Letzteres stimmt eine weitere Behauptung. An zwei deutschen Orten, wo er unter Tage gearbeitet haben will, ist er nur als Besucher gewesen: „Ich muss bemerken, dass es sich hier um Studien aus den Bergwerken Mons, Charleroi, Bochum, Essen undsoweiter handelt.“117
Dehmel erfüllt Zechs Bitte: „hier das gewünschte Gedicht für die neue Zeitschrift mit dem ältlichen Titel“. In Klammer fügt er hinzu: „warum so oberlehrerhaft?“, spart aber an anderer Stelle nicht mit Lob: „Ihr ‚Schwarzes Revier‘ ist ein wirklich wertvolles, nicht bloß kostbares Stück Arbeit. Solche sachliche Scharwerkerei bringt uns weiter als alle schöngeistige Flitterdichtung.“ Vorbehalte hat er dennoch: „Mitunter ist […] Ihre Sprache noch etwas prunksüchtig gespreizt“. Er meldet auch Zweifel an, ob die Form des Sonetts für die neuen Inhalte geeignet sei: „Man baut doch auch keine moderne Lokomotive im Stil einer Renaissance-Karosse.“ Außerdem macht er den Kollegen auf Josef Winckler aufmerksam und empfiehlt ihm die Lektüre von dessen „Eisernen Sonetten“.118
Mit einem Dankschreiben reagiert Zech auf die Überlassung des erbetenen Gedichts zum honorarfreien Abdruck und die wohlwollende Beurteilung des „Schwarzen Reviers“. Die formalen Einwände des Kollegen lässt er nicht gelten: „Gewiß, die aufgelöste Sonettform ist nur eine Krücke. Aber ich muss bekennen, dass die Schwere und Abseitigkeit der Materie mich zu einer Konzession veranlassten. Aber dies wird die Zeit wegfegen.“ Nur halbherzig verteidigt er dagegen den Titel „Das neue Pathos“: „[Er] passt uns allen nicht recht. Da aber gerade für neue Zeitschriften oft die entlegensten und zufälligsten Namen herhalten müssen, verstanden wir uns nach langer Wahl und Qual zu diesem zwar programmatischen, aber immerhin sehr nahe liegenden Namen.“119
Auf Zweigs Mahnung hin, Lissauer dürfe in der ersten Nummer des „Neuen Pathos“ nicht übergangen werden, hat Zech den Kollegen zur Mitarbeit aufgefordert und ihm ausdrücklich mitgeteilt, dieser Wunsch stelle keine Bestechung dar. Genau darum handelt es sich aber. Das weiß der Empfänger und antwortet süffisant: „Ich würde nie vorausgesetzt haben, dass Sie einen literarischen Bestechungsversuch machen wollen: das liegt ganz außerhalb des Horizontes, der von dem überhaupt möglichen Niveau überblickt wird.“ Lissauer lädt Zech zu sich nach Hause ein: „Es würde mich freuen, Sie persönlich kennen zu lernen. Im Café spricht man nicht ungestört.“ Er will nun auch eine Rezension von Zechs Werken veröffentlichen: „vielleicht bringen Sie mir auch einiges mit, falls Sie die Neigung haben.“ Aus Wien weiß er, weshalb sich Zech an ihn gewandt hat: „Mein Freund Stefan Zweig hat mir auch von Ihnen gesprochen.“ Das Treffen kommt zustande. Für den Gast ist der Fußweg von Wilmersdorf zur Eisenacher Straße in Schöneberg, wo Lissauer wohnt, ein Gang nach Canossa.
Bei Walden erkundigt sich Zech, wie gegen die Verfasser von zwei Artikeln vorzugehen sei, in denen Lasker-Schüler und ihr Werk verunglimpft werden.120 Gleichzeitig versucht er, ihr auch auf andere Weise zu helfen. Dem Kollegen Rudolf Hartig, der ihn um Unterstützung für die Herausgabe einer Anthologie zeitgenössischer Lyrik gebeten hat, gibt er den Rat: „Lasker-Schüler war bis gestern in München, schreiben Sie bitte noch einmal […] und berufen Sie sich auf mich. Ferner bitten Sie auch Hans Ehrenbaum-Degele […]. Haben Sie an Franz Werfel gedacht? Den werden Sie kaum umgehen können.“ Dem Brief fügt er eine autobiographische Notiz bei, die stimmige Angaben zu seinem Lebenslauf und Schaffen enthält, darunter den Hinweis auf die Tätigkeit bei den „Farbenfabriken“ in Elberfeld sowie die Erstausgabe des „Schwarzen Reviers“ im Jahre 1913.121
Aus Wien kommt ausschließlich Anerkennung. Zweig schreibt: „wunderschön ist Ihr Essay über die Lasker-Schüler, innerlich reich und bewegt, voll Glanz und Stil.“ In einer österreichischen Zeitschrift will er „Das schwarze Revier“ besprechen und regt an, ein Exemplar davon an den Kollegen Alfons Petzold zu schicken, weil der die Möglichkeit habe, darüber in einer sozialistischen Zeitung zu schreiben.122 Zech bedankt sich für das Lob und bezeichnet in gespielter Bescheidenheit den Artikel über die Freundin als „Schülerarbeit“. Außerdem teilt er mit: „Das neue Pathos schwillt langsam an. Montag sind die Prospekte fertig.“ Mittlerweile liegen ihm zu viele Texte und Bilder vor. Trotzdem behauptet er: „Lissauer, mit dem ich zufällig bekannt wurde, gibt auch etwas für das Pathos.“123 Von Zufall kann keine Rede sein. Diesen Kollegen kann er nach wie vor nicht ausstehen. Er will Zweig gefällig sein. Aus ähnlichen Erwägungen ist ein Exemplar des „Schwarzen Reviers“ per Post an Petzold gegangen.
Verärgert über Zechs jüngsten Artikel im „Berliner Tageblatt“ häuft Münchhausen in einem Brief an seinen Freund, den Anglisten Levin Ludwig Schücking, antisemitische Vorurteile: „Die Lasker-Schüler, […] verwandt und befreundet mit Mosse und seit Jahren von der Berliner Judenschaft als Sappho ausgeschrieen [!], ist weitaus die übelste Jüdin des Tiergartens, hat aber die ganze Geschicklichkeit ihrer Rasse im Anfertigen von poetisch höchst moderner Ware.“ Im gleichen Stil geht es weiter: „Anthologien, die sie nicht genügend berücksichtigen, werden im ‚Berliner Tageblatt‘ totgemacht. Seit ich vor Jahren […] ein wenig kühl [über sie] geschrieben habe, ist meine Stellung in der Berliner Judenwelt wackelig.“
Auch der Verfasser des Artikels bekommt sein Fett weg: „Zech ist der Elberfelder Konditorlehrling, gebürtig aus Schleswig, der mir seit Jahren seine Verschen schickt.“ Die Herkunft des einstigen Bewunderers kennt er immer noch nicht, will aber über dessen Vergangenheit wissen: „Er ist Vollblutgermane (auch äußerlich nach seiner Type) und war heftig antisemitisch, aber noch heftiger ruhmbegierig.“ Münchhausen lügt: „als ich ihm schrieb, das wäre eine gefährliche Zusammenstellung für die zeitgenössische literarische Laufbahn und er sollte damit doch lieber bloß Konditor bleiben, da … Lies seinen Artikel!“124 Der Baron hat Zech niemals geraten, das Schreiben aufzugeben und stattdessen ein Handwerk auszuüben. Im Gegenteil. Der jüngere Kollege ist von ihm gelobt und ermutigt worden, seine Karriere als Schriftsteller weiter voranzutreiben.
Rilke und Bulcke
Während der Vorbereitungen für die erste Nummer des „Neuen Pathos“ hat sich Zech gegenüber dem Verleger Otto Borngräber bereit erklärt, eine Rilke-Monographie zu verfassen. Vor Fertigstellung des Manuskripts wendet er sich an den Dichter persönlich: „Ich habe nun die Arbeit fast vollendet und bitte Sie, mir zu Vervollständigung der Monographie ein paar Sätze zu diesem zu schreiben: Erstens. Wie denken Sie über Ihr Schaffen. Zweitens. Welche Ziele haben Sie.“ Zusätzlich bittet er um eine Portrait-Aufnahme.125 Den Brief schickt er an den „Insel Verlag“ mit der Bitte, ihn weiterzuleiten.126 Verlagsleiter Anton Kippenberg sagt das zu.127 Rilke teilt er aber mit: „An Herrn Zech […] geschrieben: Sie seien verreist und schwer erreichbar. Bezüglich der Photografie bereits ablehnend beschieden.“128 In der Monographie, die 1913 erscheint, fehlt ein Brief von Rilke, den ihr Verfasser späteren Angaben zufolge vor mehr als sechs Jahren erhalten hat.129 Das Werk kommt ohne Portrait und Stellungnahme des Dichters zum eigenen Schaffen heraus.130
Im März wendet sich Staatsanwalt Carl Bulcke per Leserbrief an die Öffentlichkeit: „ein Herr Paul Zech [hat] für sein Gedicht ‚Aufblick‘ den ‚außerordentlichen Preis Ihrer Königlichen Hoheit‘ und so weiter, bestehend aus einer ‚silbernen Blumenschale‘ erhalten. Ein Herr Paul Zech aus Elberfeld, geboren im Jahre 1881.“ Das Datum ist dem Schreiber wichtig: „Ich erwähne das Geburtsjahr, hätte es sich um einen jungen Herrn gehandelt, so wäre diese Mitteilung unterblieben“. Zwischen seinem eigenen Gedicht „Du, die ich liebe“ und den Versen des Preisträgers weist er mehrere Übereinstimmungen nach und folgert: „Der einunddreißigjährige Herr Paul Zech aus Elberfeld hat sich danach seine silberne Blumenschale reichlich leicht verdient.“ Den betreffenden Zeitungsausschnitt bewahrt der Beschuldigte lebenslang auf, nimmt aber öffentlich keine Stellung zu seinem Inhalt.131
Im „Berliner Tageblatt“ steht die Ankündigung: „‚Das neue Pathos‘ wird eine neue Zeitschrift heißen, die unter der Redaktion von Paul Zech vom 15. März an zweimal monatlich erscheinen soll.“132 Der Herausgeber muss bereits jetzt die übernächste Nummer planen und bei der Druckerei wartet Werbematerial darauf, an Bibliotheken, Buchhandlungen, Kollegen und Freunde verteilt zu werden. Lene Schneider-Kainer schreibt ihm: „Sehr geehrter Herr Zech! Donnerstag ist es mir leider nicht möglich. Vielleicht telefonieren Sie einen anderen Tag. Besten Dank für die Prospekte.“133 Die Künstlerin malt sein Portrait.
Lasker-Schüler ist nach der Scheidung mittellos und befürchtet, in der Öffentlichkeit als Bettlerin dazustehen.134 Zech sucht nach weiteren Möglichkeiten, ihr zu helfen. In einer Besprechung des Romans „Mein Herz“ weist er auf die Notlage der Dichterin hin: „Else Lasker-Schüler, diese Tänzerin durch kosmische Gefühlsverstellungen, steht einsamer denn alle im Bann des Gegenwartslebens.“135 Der Artikel löst einige böse Schmähungen, aber auch verständnisvolle Stellungnahmen aus. Aus München schreibt Verleger Bachmair dem Verfasser: „Sie werden es mir nicht verübeln, wenn ich als einen geringen Beweis meiner Erkenntlichkeit Ihnen einige meiner Luxusausgaben übermitteln lasse, die Ihnen, wie ich hoffe, einige Freude machen werden.“136
Lene Schneider-Kainer: Paul Zech Öl auf Leinwand, 1913
Emmy Schattke will Lasker-Schüler ebenfalls beistehen. Deshalb nimmt sie nach längerem Schweigen wieder Verbindung mit Paul auf und fragt nach Einzelheiten aus dem Leben der Dichterin. Der ist überrascht und erfreut: „Ich bin zu aufgeregt, Ihnen heute ausführlicher zu schreiben. Ihr Brief hat mich sehr erregt, liebe Freundin! Ich habe nichts vergessen und werde nichts vergessen. Sie tun mir bitter unrecht, wenn Sie Gegenteiliges glauben.“ In einem muss er sie enttäuschen: „Von Else Lasker-Schüler kann ich Ihnen keine Daten geben, da Else Lasker-Schüler nichts preisgibt.“ Wenigstens die Berliner Adresse der Dichterin teilt er Emmy mit, rät aber: „Schreiben Sie ihr bitte nichts von Armut und ähnlichem. Sie leidet unter dem Wie und Was der Sammlung.“
Schattkes Nachricht nimmt Zech zum Anlass, der Absenderin ein Wiedersehen vorzuschlagen: „Lasker-Schüler liest am 17. März bei Osthaus in Hagen. Ich komme wahrscheinlich auch hin.“137 Zuvor besucht er in Berlin gemeinsam mit der Dichterin den Rezitationsabend einer Kollegin, den der „Sturm“ so ankündigt: „Bess Brenck-Kalischer liest am Sonntag, dem 9. März unter dem Titel ‚Neue Prosa‘ Novellen von Siegmund Kalischer, Jung, Ehrenstein, Widmann, Lasker-Schüler.“ In der gleichen Ausgabe wendet sich Zech gemeinsam mit über fünfzig Kulturschaffenden, unter ihnen Apollinaire, Döblin, Klee und Léger, gegen eine Verunglimpfung Kandinskys im „Hamburger Fremdenblatt“.138
Einen Artikel über die Lesung der Schriftstellerin stilisiert Zech zum sprachlichen Kunstwerk: „Beß Brenk-Kalischer, eine unentdeckte, mit literarischem Ehrgefühl behaftete Sprecherin von anderer Leute Erzähltem, muss sicher mehr Idealismus besitzen, denn alle die Schreiber zusammen, deren flammende Zeilen sie in den halbleeren Saal hinschmiß“. Bewundernd hebt er die Auswahl der Texte hervor: „Es gehört wirklich ein Instinkt allerschärfster Witterungsmöglichkeit dazu, den […] verlästerten und angespienen Franz Jung [zu lesen]. Gar nicht zu reden von Albert Ehrenstein und Else Lasker-Schüler.“ Der Rezensent glaubt: „Beß Brenk-Kalischer als Mittlerin dieser unornamentalen amoralischen und psychopathisch gebänderten ,neuen Prosa‘ wird […] trotz halbgefüllter Säle weiter schürfen und feilbieten dürfen mit der Geste eines Jeremias und dem Pathos Jochanaans.“139
Im „Berliner Tageblatt“ bespricht Zech Adolph Levensteins Buch „Die Arbeiterfrage“. In diesem Werk sind die Ergebnisse einer Umfrage unter 5000 Arbeitern aus den Bereichen Bergbau, Metallverarbeitung und Textilherstellung zu ihrem Verhalten im Betrieb sowie ihrer eigenen Befindlichkeit zusammengefasst.140 Über diesen Artikel urteilt Brigitte (Beckmann-) Pohl, die erste Biographin des Autors: „So lange es um das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht, positioniert sich Zech für den Arbeiter, ihm gehört seine Empathie. Als es aber um weltanschauliche und ethische Fragen geht, wertet er überheblich, geradezu spießbürgerlich, wie es wahrscheinlich der Leser der ‚Literarischen Rundschau‘ erwartet hat.“141
Lasker-Schüler bittet Zech um Hilfe bei der Vorbereitung zu ihrer Reise nach Hagen. Er soll für sie eine Zugverbindung auswählen, mit der sie vom Anhalter Bahnhof aus noch vor Einbruch der Nacht ans Ziel gelangt und ihr den Abfahrtstermin telefonisch durchsagen.142 Entgegen diesen Planungen fährt sie erst abends. Schattke wird von Zech gewarnt: „Lasker-Schüler ist sehr reizbar und kriegerisch. […] Sie war sehr krank die letzten Monate. Also Vorsicht in der Konversation ist nötig.“ Zwar stellt er in Aussicht: „Ob ich auch komme, entscheidet sich am Sonntag“, doch besitzt er weder genügend Geld noch hat er Zeit, um die Dichterin zu begleiten. Deshalb beugt er vor: „Ich bin rasend beschäftigt.“ Das Wiedersehen mit der Freundin findet nicht statt. Ihre Hilfe will er dennoch in Anspruch nehmen: „Was sagen Sie zu unserer neuen Zeitschrift? Können Sie mir nicht einige Subskribenten beschaffen?“143 Die Adressatin ist enttäuscht, fährt aber trotzdem zur Lesung der Dichterin nach Hagen.
Kurt Erich Meurer, ein 1891 in Meinigen geborener Schriftsteller, der in Berlin die „Neue Theaterzeitschrift“ redigiert, bietet Zech an, Lyrik von ihm zu veröffentlichen. Der Herausgeber des „Neuen Pathos“ revanchiert sich dafür einige Zeit später mit dem Abdruck eines Gedichts des Kollegen in der zweiten Nummer seines eigenen Blattes.144 Nicht in die Druckvorlagen der ersten Ausgabe aufgenommen wird ein Beitrag Zweigs, den dieser mit der Bemerkung einreicht: „Lieber Freund, hier ein kleines Opus!“ Das geschieht, obwohl er Zech zwei Wohltaten erweist: „Über Ihre Gedichte habe ich eben an die Wiener Neue Freie Presse eine Anzeige gegeben.“ Von größerer Tragweite ist die Nachricht: „Verhaeren sandte mir einen Brief von Ihnen ein, ich übersetzte ihm den Inhalt und sagte selbstverständlich, er möge Sie autorisieren.“145
Walter Hasenclever erklärt sich von Leipzig aus bereit, am „Neuen Pathos“ mitzuwirken. Dazu reicht er das Manuskript seines Gedichtbandes „Der Jüngling“ bei der Redaktion ein und schlägt vor: „Ich bitte Sie nun, sehr verehrte Herren, daraus für Ihre Zeitschrift etwas Angemessenes auszuwählen“. Zech veröffentlicht aber lediglich ein Gedicht. Hasenclevers Kollege Kurt Pinthus, von dem der zweite Teil des Briefs stammt, bittet um ein Exemplar der ersten Nummer des „Neuen Pathos“. Die will er in etlichen Zeitschriften, mit denen er zusammenarbeitet, ankündigen. In eigener Sache macht er schon jetzt Werbung: „Vielleicht sind Ihnen übrigens einige jugendliche Versuche von mir bekannt geworden, die in dem ‚Neuen Leipziger Parnass‘ zu finden sind.“146
Der Druck der ersten Ausgabe des „Neuen Pathos“ steht unmittelbar bevor, und die Anzahl der Herausgeber ist mittlerweile auf vier angewachsen. Für die Zusammensetzung des Gremiums gibt es eine einfache Erklärung. Meidner und Zech, beide mittellos, haben zwei junge Autoren gefunden, die zwar selbst ebenfalls kein Geld besitzen, deren Eltern aber vermögend genug sind, um das Projekt zu subventionieren. Ehrenbaum-Degeles Eltern haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Mit dem Vater von Robert Renato Schmidt soll ein Treffen stattfinden. Der Sohn teilt Zech dazu mit: „Nächsten Mittwoch reisen wir auf etwa vier Wochen nach Palermo. Wir fahren über Berlin. Da können wir uns eine Stunde sprechen. Wollen Sie Mittwoch um sechs Uhr abends im Hotel Adlon sein?“ Schmidt jun. gehört zu der Generation junger Leute, die, meist materieller Sorgen enthoben, im Deutschen Kaiserreich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus Langeweile eine Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeisehnt. Er bekennt: „Ich bin in der letzten Zeit überhaupt von einer großen Gleichgültigkeit gewesen, das weiß ich wohl. Alles ist mir riesig bedeutungslos erschienen. Ich bin von einer großen inneren Müdigkeit […].“ Er ist sich nicht der Privilegien bewusst, die er genießt: „jedes mal, wenn ich nach Hause komme, merke ich, wie ich da fremder und fremder werde, [wie] man überhaupt in allem Tiefen und Eigenen ganz allein steht, wie unter Felsen. […] Ich lese fast nie Zeitungen.“ Immerhin will er als Autor im „Neuen Pathos“ vertreten sein: „Ich schicke Ihnen morgen die Novelle, von der ich sprach. Sie ist allerdings ziemlich lang.“147 Zech veröffentlicht den Beitrag später ungekürzt.
Am Ostermontag 1913 sitzt im „Café Josty“ eine Gruppe von Literaten zusammen, die alle mit dem Verleger Kurt Wolff zu tun haben. Als das bemerkt wird, schreibt einer aus der Runde nach Leipzig: „Von einer Vollversammlung Ihrer Verlagsautoren die besten Grüße Otto Pick“. Albert und Carl Ehrenstein setzen ihre Namen darunter, danach stellt Franz Kafka zu laufenden Verlagsverhandlungen richtig: „Sehr geehrter Herr Wolff! Glauben Sie Werfel nicht. Er kennt ja kein Wort der Geschichte. Bis ich sie ins Reine habe schreiben lassen, schicke ich sie natürlich sehr gerne.“ Zech beschränkt sich auf einen „Herzlichen Gruß“ und seinen Namenszug. Lasker-Schüler malt ein Konterfei des Prinzen Jussuf und unterschreibt mit „Abigail Basileus III.“148
Die Zusammenkunft im Josty dient auch der Vorbereitung einer Reise der Dichterin nach Prag. Dort soll sie vor dem „Klub deutscher Künstlerinnen“ aus ihren Werken lesen. Pick hat dieser Vereinigung mitgeteilt, beim ständigen Begleiter Lasker-Schülers, Paul Zech, handle es sich um einen bekannten Schriftsteller, der an der Moldau ebenfalls Gelegenheit erhalten müsse, aus seinen Werken vorzutragen. Die beiden Herren kennen sich seit längerem. Als Lyriker sind sie von Hermann Meister im „Saturn“ vorgestellt worden149 und Zech hat die Zeitungsleser im Wuppertal wissen lassen: „Ein Dichter […] von Inbrunst des persönlichen Schauens und Formens ist der junge Prager Otto Pick.“150
Durch Lasker-Schüler lernt Zech den Studenten Rudolf Börsch kennen, der den Wunsch hat, Schriftsteller zu werden. Ihm schreibt er: „Sie hatten die Güte, mein Schollenbruch so außerordentlich warm und verständnisvoll zu besprechen. Ich kann nicht umhin, Ihnen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.“ Dem Neunzehnjährigen vertraut er an: „Gerade dieses Buch, das meine schönsten Erlebnisse auf dem Dorfe dokumentiert, liebe ich, obwohl es in der Form und im Erlebnis jetzt sehr fern von mir liegt, außerordentlich.“ Wenn Zech schreibt: „Ich bin von Kind an der Scholle verlobt, meine Väter waren durch Jahrhunderte Bauern“, so trifft das weder auf die väterliche noch auf die mütterliche Linie der Vorfahren zu. Seinem Brief legt er „Das schwarze Revier“ bei und behauptet: „Ich habe etwa drei Jahre im Ruhrkohlenrevier gewirkt, war in den Belgischen und Englischen Gruben tätig. Die abseitige Welt dieser industriellen Komplexe wußte ich, wenn auch nur in Silhouetten, zu bannen, jedoch ohne jegliche politische Färbung.“151 Die Behauptung, diese Lyrik sei unpolitisch, ist neu.
Am Abend des 26. März wird Zech von Familie Schmidt im „Adlon“ empfangen. Er ist nervös, weil es jüngst Streit mit Meidner gegeben hat, und ihm später am Abend noch ein Besuch im Atelier des Künstlers bevorsteht. Die Verhandlungen mit Schmidt senior verlaufen nach Wunsch. Der sagt zu, sich künftig an der Finanzierung des „Neuen Pathos“ zu beteiligen.
Erleichtert macht sich Zech auf den Weg nach Friedenau zur Wilhelmshöher Straße 21. Dort wohnt Meidner in einer Mansarde „unter glühendem Schieferdach […] in einem billigen Atelier, mit einer eisernen Bettstadt, einem Stuhl einem Spiegel und einer Anzahl Kisten“, die ihm als Tische und Schränke dienen.152 Es herrscht drangvolle Enge. Der Streit über den Inhalt und das Äußere der neuen Zeitschrift, unter anderem über die Veröffentlichung der Arbeiten von Marc und Campendonk, hat viele Literaten und Künstler zum Kommen veranlasst. Meidner berichtet dem Kollegen Raoul Hausmann: „Mittwoch Abend war großer Tumult bei mir […]. Neue Pathos Sache, Lärm, Streit, Beleidigungen. Schließlich gab ich zwei Zeichnungen. Aussöhnung mit Zech.“153 Am nächsten Morgen schreibt er dem Kontrahenten: „Lieber Herr Zech. Es ist nicht gut, wenn Künstler, […] sich hassen und schmähen – und so bitte ich Sie herzlich, all die Beleidigungen, Verdächtigungen und Gehässigkeiten, welche Sie in den letzten Wochen von mir erleiden mussten, zu verzeihen und zu vergessen.“ Er räumt ein, schon öfter von solchen Wutanfällen gepackt worden zu sein: „Ich ging tagelang herum, wie besessen von Rachgier und Fanatismus, einem Fanatismus anarchistischer Färbung. […] Doch eines morgens war alles weg, die Welt war wieder gerecht und gut, ich war gesund.“154
Schon vor Beginn der Fahrt in die „Goldene Stadt“ schreibt Zech an Rudolf Hartig: „Von einer Reise nach Prag zurück [!], finde ich Ihren Brief vor.“ Der Kollege, den er seit Elberfelder Zeiten kennt, hofft nach wie vor auf einen Beitrag von Lasker-Schüler für sein geplantes Buch, doch er muss erfahren, sie wolle „für Anthologien nichts hergeben“. Die Adressen der Schriftsteller René Schickele und Hans Carossa, nach denen der Kollege ebenfalls gefragt hat, behält Zech für sich. Angeblich kennt er sie nicht. Der Grund ist jedoch ein anderer. Das ergibt sich aus seinem Rat an Hartig, auf Beiträge bestimmter Autoren zu verzichten: „Sie mißkreditieren die Anthologie dadurch.“ Unter den Namen, die Zech in dem Zusammenhang nennt, befindet sich auch der von Anselm Ruest. Ausdrücklich empfiehlt er dagegen, Robert Renato Schmidt und Kurt Erich Meurer zur Teilnahme aufzufordern.155
Hasenclever äußert die Hoffnung, den Herausgeber des „Neuen Pathos“ bald persönlich kennenzulernen. Über seinen Geburtsort schimpft er: „Ich selbst bin Rheinländer (aus Aachen, dieser blöden Stadt)“. Weil er den Angaben des Kollegen, dessen Herkunft betreffend, Glauben schenkt, folgt der Zusatz: „und habe so ein natürliches Verwandtschaftsgefühl zu guten rheinischen Dichtern.“ Auf Zechs Ankündigung hin, im „Berliner Tageblatt“ über Hasenclever einen Artikel zu veröffentlichen, folgt der Kommentar: „Ich bin Ihnen herzlich dankbar für den schönen Plan […] und hoffe, ich kann gelegentlich auch für Sie etwas tun, vielleicht grade im Rheinland.“156
Eine weitere Nachricht, die Zech noch vor seiner Pragreise erreicht, kommt von Petzold aus Bozen. Er hat, wie von Zweig empfohlen, „Das schwarze Revier“ erhalten, um darüber in einer österreichischen Zeitung zu schreiben. Nun teilt er mit: „Zur Zeit als Sie mir Ihr ‚Revier‘ sandten, fing meine dumme Lunge zu streiken [an], so dass der Arzt mir jede Arbeit verwies […]. Ich bat deshalb meinen Freund Dr. Stern von der Arbeiter Zeitung, das Büchlein zu besprechen und sende Ihnen nun seine Rezension.“157 Stern verbindet seinen Artikel mit einem Spendenaufruf für Lasker-Schüler.
Kafka lästert
Am Nachmittag des 4. April, einem Freitag, besteigen Lasker-Schüler und Zech am Anhalter Bahnhof den Schnellzug nach Prag. Die Reise dauert sechseinhalb Stunden. Bei ihrer Ankunft am Franz-Josef-Bahnhof werden sie von Freunden und Bekannten empfangen, unter ihnen Otto Pick, Paul Leppin und Anton Macek. Mit der Straßenbahn fahren sie zum Hotel, in dem die Gäste untergebracht sind. Nachdem das Gepäck abgestellt ist, geht die Gruppe noch aus. Überwältigt vom Anblick des nächtlichen Altstädter Rings fängt die Dichterin am Rande des Platzes laut zu singen an, was einen Polizisten auf den Plan ruft. Vergeblich versuchen die Begleiter, dem Wachtmeister klarzumachen, bei der fremdländisch gekleideten Dame handle es sich um den Prinzen Jussuf von Theben, der rituelle Gebete verrichte. Der Ordnungshüter gibt sich unbeeindruckt: „Das ist mir burscht [!], hier darfs niemand nicht singen.“ In seinem Diensteifer wird er von einem der Umstehenden bestärkt, der erklärt: „Sie ist nicht der Prinz von Theben, sondern eine Kuh vom Kurfürstendamm!“ Leopold B. Kreitner, Augen- und Ohrenzeuge der nächtlichen Episode, erkennt in dem Herrn, der dem Schutzmann diesen Hinweis gibt, Franz Kafka.158
Nach etlichem Hin und Her landet die Dichterin in ihrem Hotelbett und nicht in polizeilichem Gewahrsam, wie sie später Karl Kraus berichtet. Am Samstag kann sie ausschlafen, denn die Lesung beginnt erst um acht Uhr abends. Das Anwesen, in dem sich die Klubräume befinden, liegt am Riegerquai an der Moldau in Sichtweite des Nationaltheaters. Vor ausverkauftem Saal wird die Veranstaltung zu einem großen Publikumserfolg. Vermutlich befindet sich auch Kafka unter den Zuhörern, trotz seiner Abneigung gegen die Kollegin. Nach der Lesung kehren Lasker-Schüler und ihr Freund in Begleitung der Gastgeber im „Café Arco“ ein.
Zechs Lesung findet am Sonntagmorgen ebenfalls am Riegerquai statt. Im Verlauf der Matinée trägt er zunächst Verse aus dem „Schwarzen Revier“ vor. Darauf folgen zwei Novellen aus dem unveröffentlichten Prosaband „Der schwarze Baal“. Pick hat für das „Prager Tagblatt“ einen Artikel über das Schaffen des Berliner Kollegen geschrieben, den es in seiner Sonntagsausgabe veröffentlicht. Darin heißt es: „Immer fiel die wohltuende Knappheit seiner lyrischen Schöpfungen auf, während seine Literaturkritiken energisch für eine neue Kunst sich einsetzten.“ An gleicher Stelle wird Else Lasker-Schülers Lesung vom Vorabend besprochen: „Die Hörer standen unter dem Banne dieser einzigartigen, durchaus instinktiven und visionären Kunst […] und sandten der Dichterin begeisterten Beifall nach.“159
Nach der Matinée begeben sich der Vortragende und die Dichterin mit den Prager Freunden ins „Café Louvre“. Dort schreiben sie gemeinsam eine Postkarte an Albert Ehrenstein. Zech meldet: „in Prag wurde die große Schlacht geschlagen“. Pick ergänzt: „Größter Erfolg!“160 Den Nachmittag und Abend verbringt die Schar in der „Goldenen Stadt“ und erst gegen Mitternacht nehmen die Gäste eine Straßenbahn zum Franz-Josef-Bahnhof. Die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges wollen sie sich im dortigen Restaurant aufhalten, stehen aber vor verschlossenen Türen. Um halb zwei ist es soweit. Der D 37 setzt sich Richtung Berlin in Bewegung. Frühmorgens erreichen die Reisenden ihr Ziel. Im „Prager Tagblatt“ heißt es an diesem Montag über Zechs Lesung: „Das Publikum, nicht zahlreich, aber gewählt, begrüßte den Dichter mit stürmischem Beifall.“161 Die Zeitung „Bohemia“ wird im Detail deutlicher: „Den Vortragenden, der bloß im schlichten Smoking las, grüßten leider nur wenige mit reichstem Beifall.“162
Am Dienstag meldet Otto Pick aus Prag: „heute sandte ich Ihnen die Kritiken und dem ‚Berliner Tageblatt‘ […] ein Feuilleton: ‚Der Prinz von Theben und die Prager‘. Bitte, fragen Sie an, ob es erscheinen wird. […] Wir sprechen alle von den schönen paar Tagen mit Ihnen und Else Lasker-Schüler.“ In gleichem Maß wie diese Mitteilung freut den Empfänger eine weitere: „Einen kleinen Überschuss, den der Vorverkauf ergab, sende ich Ihnen nächster Tage.“163
Zurück in Deutschland hadert Zech mal wieder mit der Berliner Literatenszene. An Dehmel schreibt er: „Wie jetzt für den völlig unbegabten Blass Propaganda gemacht wird, das grenzt schon an Amerikanismus. Wir paar Leute, die dagegen ankämpfen, sind gegen den Ansturm zu schwach, zu wenig frech, zu wenig pöbelhaft.“ Er glaubt zu wissen, wer für diese Manipulationen verantwortlich ist und welche Gründe dabei eine Rolle spielen: „Dass der Berliner Caféhaussumpf, der mir zum Halse herauswächst, für seine sterilen Äußerungen ganz andere und einträglichere Geschäfte macht, liegt eben in der trefflich organisierten Cliquenwirtschaft.“ Solche Äußerungen hindern ihn nicht daran, ebenfalls derartige Geschäfte zu machen und die Nächte im „Caféhaussumpf“ der Hauptstadt zu verbringen.
Auf Dehmels Empfehlung hin hat Zech Josef Wincklers „Eiserne Sonette“ gelesen und eine Nummer der Zeitschrift „Quadriga“ zumindest durchgeblättert. Nun schreibt er nach Blankenese: „Es ist verblüffend, wie der Dichter […] fast dieselben Stoffe meistert, die ich auch im ‚Schwarzen Revier‘ künstlerisch umrissen hab.“ Ihm missfällt jedoch die Tendenz der Gedichte des Kollegen: „Stellenweise bricht ein so gefährlicher Byzantinismus durch, dass man verzweifeln möchte.“ Aufgeschlossen zeigt er sich gegenüber Dehmels Bitte, er solle den Arbeiterdichter Gerrit Engelke fördern: „In der Tat, Engelke ist als ein starkes Talent zu begrüßen. Wir bringen schon im zweiten Heft unserer Zeitschrift drei Gedichte.“ Sein Urteil ergänzt er durch einen Hinweis auf den eigenen Werdegang, dessen Darstellung allerdings erheblich von der Wirklichkeit abweicht: „ich habe während meiner mehrjährigen Tätigkeit als technischer Beamter in den Kohlegruben Westfalens eine unerhörte Summe dichterischer Kraft bei den Bergarbeitern kennengelernt.“
Zech, der bei seiner Prager Matinée „im schlichten Smoking“ auf dem Podium erschienen ist, scheint es mittlerweile wieder ratsam, seine proletarische Herkunft zu verschleiern. Gegenüber Dehmel betont er: „Dass uns aus den unintellektuellen Kreisen die stärksten Begabungen reifen, ist mir bekannt […].“ Bewusst unterlässt er es, zu bekennen, selbst aus diesen Kreisen zu stammen.164
Auf Zechs Polemik gegen Winckler und Blass erwidert Dehmel: „ich begreife, dass Ihnen an den Eisernen Sonetten manches nicht gefallen will, schon aus Rivalität; aber gegen den Vorwurf der politischen Streberei muss ich den Dichter in Schutz nehmen.“ Seine Forderung lautet: „Überhaupt solltet Ihr jungen Dichter einander immer das Beste zutrauen. Gönnen Sie dem Kurt [recte: Ernst] Blaß doch seinen Tageserfolg! Wenn kein Dauerwert in ihm steckt, wird er umso rascher abgewirtschaftet haben.“165 Dieser Rat zeigt Wirkung. Zech ändert seine Meinung über Blass.
In der zweiten Aprilwoche 1913 liefert die Berliner „Druckerei für Bibliophilen“ das erste Heft des „Neuen Pathos“ in einer Auflage von 100 Exemplaren mit je 31 Seiten aus. Mutmaßlich auf Meidners Einspruch hin fehlen jene Werke, die Marc und Campendonk zum Abdruck angebotenen hatten. Er selbst ist mit drei Grafiken vertreten. Die weiteren drei Herausgeber Zech, Schmidt und Ehrenbaum-Degele finden als Autoren mit zwei beziehungsweise einem Gedicht Berücksichtigung. Von den „Pathetikern“ kommt lediglich Steinhardt mit einer Grafik „Der Prophet“ zum Zuge. Zweigs Beitrag steht auf Seite eins, dem folgen Verhaerens Verse „Begeisterung“ („übertragen von Paul Zech“) sowie ein „Zwiegesang überm Abgrund“ von Dehmel. Lasker-Schüler fragt in der letzten Zeile eines Gedichts „An den Herzog von Vineta“ Gottfried Benn: „wie soll ich dich rufen?“ Den beschäftigt als lyrisches Thema „Der junge Hebbel“. Drei weitere Gedichte stammen von Franz Werfel, Walter Hasenclever und – Ernst Lissauer (!). Das Heft wird mit einem Beitrag, „Gruppenbildung in der Literatur“ von Rudolf Leonhard beschlossen,166 von dem zusätzlich noch ein Gedicht abgedruckt ist.
Schon kurz nach dem Erscheinen der neuen Zeitschrift erreichen die Herausgeber zahlreiche Stellungnahmen. Anerkennung kommt von zwei Kollegen, die mit Beiträgen darin vertreten sind. Franz Werfel schreibt an Zech: „Ihre Gedichte haben mich diesmal am stärksten berührt. […] wie hat es Ihnen denn in Prag gefallen – und hält mich Frau Lasker-Schüler für unwiderruflich abscheulich?“167 Gottfried Benn lobt: „das Neue Pathos ist sehr nach meinem Geschmack“. Sein Brief endet: „Sehr in Eile (Kaninchen, Mäuse, Affen schreien nach mir). Benn.“168 Der Mediziner kann von seinen Einkünften als Schriftsteller nicht leben und arbeitet deshalb als Arzt am Krankenhaus in Charlottenburg.
Lasker-Schüler, die sich ebenfalls meldet, schreibt nichts darüber, was sie von der Zeitschrift hält. Nachwirkungen der Scheidung beeinträchtigen noch immer ihren Alltag: „ich lieg im Bett – Unterleibsentzündung – hatte 40 Grad Fieber in der Nacht. Ich singe immer.“ Aufgrund ihrer finanziellen Misere kommt sie ohne Umschweife zur Sache: „Dehmel ist entzückt über mein Gedicht im Neuen Pathos. Ich fordere 300 Mark von Ihnen!“ Aber sie denkt nicht nur an sich: „Und ich will mir Saturn bezahlen lassen dann teil ich mit Ihnen.“169 Wie angekündigt, hat Meister die April-Ausgabe seiner Zeitschrift ausschließlich der Dichterin gewidmet. Abgedruckt ist ihr Gedicht mit den oft zitierten Zeilen: „Paul Zech schreibt mit der Axt seine Verse. / Man kann sie in die Hand nehmen, / So hart sind die“. Das Heft enthält ferner ein Fotoportrait sowie eine Zeichnung von der Dichterin.170
Hasenclever ist für seinen Beitrag im „Neuen Pathos“ ein Belegexemplar zugegangen. Er dankt und kündigt an, auch an der zweiten Nummer mitwirken zu wollen. Außerdem fragt er, ob es möglich sei, dieser Ausgabe einen Prospekt für sein Buch „Der Jüngling“ beizulegen, das dieser Tage erscheint. Als Ausgleich wolle er „Das schwarze Revier“ in einer rheinischen Zeitung besprechen. Bedauernd stellt er fest: „Es ist schade, dass Sie auf Ihrer Reise Berlin–Prag nicht über Leipzig gekommen sind; hoffentlich wird Gelegenheit sein, uns bald einmal alle kennen zu lernen.“171 Auch Pinthus möchte Beiträge liefern, gefährdet aber die erwünschte Zusammenarbeit, indem er dem Herausgeber mitteilt: „meine letzten Gedichte habe ich übrigens an Herrn Lissauer geschickt, vielleicht sehen Sie sich diese Verse einmal an, von denen ja Lissauer sehr viel hält.“172
Zweig kleidet seine Anerkennung für die Zeitschrift in die Worte: „ich habe hier in Wien das erste Heft des Neuen Pathos vorgefunden, das ich außerordentlich in Druck, Ausstattung finde. Hoffentlich findet es das Interesse, das es verdient. Ich bin gern bereit, Ihnen in jeder Weise dabei behilflich zu sein.“173 Zweigs Freund, der Lyriker Arthur Silbergleit will sich gleichfalls für das Periodikum und die Werke des Kollegen einsetzen: „Ich […] hoffe zuversichtlich, die Besprechungen liefern zu können. Ihren Rilke-Essai erhielt ich bisher nicht (dies der Ordnung halber!) Ich hätte Sie sehr gern heute im Café Josty aufgesucht, doch empfing ich selbst Besuch zu dieser Zeit.“174 Die beiden Autoren werden Freunde. Verse von ihnen erscheinen nicht zufällig in derselben Ausgabe der Zeitschrift „Über Land und Meer“: Zechs „Einsame Dämmerstunde“175 und Silbergleits „Stimmen“.176
Neben Anerkennung erfährt Zech auch harsche Kritik. In Pfemferts „Aktion“ erscheint von Paul Boldt ein Gedicht „Lektüre“, das persönliche Angriffe auf ihn enthält: „Ach, ich will Galle haben! Ich will mich entrüsten! / Schmeißt doch die Dichterschädel ein! / Zech, Bab, Lissauer – macht doch ein Pogrom! Schleift doch die Messer für die fetten Gurgeln! / Gott schenke sie doch den Chirurgeln! Mit einem Kehlkopfkarzinom.“177 Die Polemik des Verfassers wendet sich gegen patriotische Töne in den Werken der drei Kollegen, wobei er zwar Anlass zur Entrüstung hat, was das Schaffen von Julius Bab und Ernst Lissauer, nicht aber in gleichem Maß, was das von Zech anbelangt.
In der „Bücherei Maiandros“ zeichnet René Schickele mit Worten eine Karikatur seines Kollegen: „Der so begabte Paul Zech scheint in voller Deroute und im Begriff, sich zur Vollziehung eines Selbstmords auszustrecken. Sein Kopf liegt auf dem hervorragendsten Teile Ernst Lissauers, das Ohr dicht an der bürgerlich soliden Verdauungsmusik, die es da mit altpreußischen Märschen gemischt zu hören gibt.“ Der Verfasser lästert weiter: „Den Rest seines irdischen Leibes hat er dem reizenden Stefan Zweig anvertraut. Sein Geist geht bereits im ‚Daheim‘ um. Und das Ganze heißt ‚Das neue Pathos‘. Es scheint gut zu stehen um die beste Sache. Es gibt schon Überläufer.“178 Schickele, der seit 1909 in Straßburg sowie Paris gewohnt und gearbeitet hat, lebt seit einem Jahr mit seiner Familie im mecklenburgischen Fürstenberg.
Paul Zech im Jahre 1913
Unbeeindruckt von den Angriffen auf sein Blatt macht sich Zech an die nächste Ausgabe. In einem Brief an Dehmel steht, er habe dafür „einen idealen Drucker gefunden […], der vom zweiten Heft an die Zeitschrift im Handdruck herstellt und [zwar] mit einer neuen kräftigen Fraktur.“179 Dieser Mann heißt Eduard Wilhelm Tieffenbach. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Erna betreibt er die „Officina Serpentis“. Ihre Werkstatt befindet sich im Untergeschoß der Steglitzer Martinstraße 10, in einem der Stockwerke darüber wohnt das Ehepaar. Bei den Tieffenbachs lernt Zech den Schriftgestalter Emil Rudolf Weiß und dessen Frau, die Bildhauerin Renée Sintenis, kennen. Deren Tierplastiken bleiben ihm lebenslang im Gedächtnis. Noch Jahrzehnte später erinnert er sich an „Kälber mit unwahrscheinlichen Beinen und entsetzlich großen Angstaugen“.180
Dehmels Rat befolgend hat Zech seine Vorbehalte gegen das Schaffen Josef Wincklers aufgegeben. Mit dem Kollegen steht er nun brieflich in Verbindung: „Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre anerkennenden Worte und die Übersendung der Beiträge.“ Der gebürtige Westpreuße bezeichnet gegenüber dem Kollegen die Region an Rhein, Ruhr und Wupper als seine Heimat, in der er vor Jahrzehnten den Lebensunterhalt als Arbeiter verdient hat. Winckler nimmt das erfreut zur Kenntnis: „Dass Sie im rheinisch-westfälischen Industriegebiet auch praktisch tätig waren, halte ich zum Verständnis unserer Bestrebungen für sehr glücklich.“181
Entgegen Zechs Ankündigung ist seine Lyriksammlung „Die Brücke“ bisher nicht erschienen, aber aus Leipzig kommt von Kurt Pinthus überraschend das Angebot: „Sie haben vielleicht von der Idee unserer Kinobücher gehört. Wenn Sie uns ein Stück einsenden wollen, so würden wir uns sehr freuen.“182 Zech möchte unbedingt mitmachen, zumal er, wie Wegener erfährt, ein geeignetes Manuskript in der Schublade hat, „Der große Streik“.183 Dem Text liegen Ereignisse des Dreibundstreiks zugrunde, die auch das Thema seines Gedichtes „Streikbrecher“ sind. Zwischen beiden Texten gibt es wörtliche Übereinstimmungen.184 An Adolf Knoblochs Stück „Tiefen“ hat Zech den versöhnlichen Schluss beanstandet, der keinen Bezug zur Wirklichkeit besitzt. Nun bietet er selbst in seinem Filmskript eine ähnliche Lösung an, obwohl er den vergeblichen Kampf der Kumpel um soziale Gerechtigkeit im Ruhrgebiet kennt, der nur ein Jahr zurückliegt. Davon unabhängig gehört er mit seinem Beitrag zu den Autoren des legendären „Kinobuchs“ aus der Frühzeit der Filmgeschichte.
Während Zech als Herausgeber des „Neuen Pathos“ neben Kritik auch viel Lob erfährt, muss er als Schriftsteller mit einer Niederlage fertig werden. Wolfskehl hat Verwey eine eigene Übersetzung des Gedichts „An Kandinsky“ geschickt und von ihm die Antwort erhalten: „Könnte die Übertragung in Deutschland gedruckt werden, sodass der schlechte Eindruck von Zech weggenommen würde, dann sollte mich das gewiss freuen.“185 Tatsächlich bevorzugt Walden die Übertragung von Wolfskehl für seine Kandinsky-Monographie, die im Mai erscheint.186
Lasker-Schüler bittet Zech um Auskunft: „Sie sagten mir doch 800 Balladenbücher sind von mir bei Meyer fort. Er schrieb mir – denken Sie nur 200. Ich bitte Sie dieses Mal kein Diplomat zu sein. Wir müssen das ruhig besprechen.“ Die Dichterin ist dringend auf Einkünfte angewiesen: „Mir geht‘s materiell schlecht.“ Künftig will sie nichts mehr bei Meyer veröffentlichen, der mittlerweile unter dem Pseudonym „Munkepunke“ bekannt ist: „Ich habe satt für die Leute zu arbeiten. Gott sei Dank bin ich eingekehrt zu Wolff-Rowohlt.“187 Auch Zech plant seit längerem, den Verleger zu wechseln, weil er sich von seinem jetzigen vernachlässigt und unter Wert verkauft fühlt. Er hofft, als Autor ebenfalls von Kurt Wolff unter Vertrag genommen zu werden, zumal Werfel im ehemaligen Unternehmen Rowohlts als Volontär arbeitet. Die Angelegenheit bespricht er im „Josty“ mit Lasker-Schüler zu mitternächtlicher Stunde.
Am nächsten Morgen erhält Zech Post von Benn: „Ausschließlich aus persönlicher Verehrung für Sie versuche ich, Ihnen ein anderes Gedicht zur Verfügung zu stellen, ohne große Hoffnung jedoch, Ihnen damit zu gefallen.“ Es handelt sich um zwei Strophen mit dem Titel „Drohung“: „aber wisse: / ich lebe Tiertage. Ich bin eine Wasserstunde. / Des Abends schläfert mein Lid wie Wald und Himmel. / Meine Liebe weiß nur wenig Worte: / es ist so schön an deinem Blut.“188 Dem Datum folgt die Aufforderung: „Darf ich um Postkarte bitten, ob Sie es bringen?“189 Benn erhält eine Zusage. Seine Einlassung, er stelle den Text aus Verehrung für den Herausgeber des „Neuen Pathos“ zur Verfügung, kann bezweifelt werden, denn es gibt eine Liebesbeziehung zwischen ihm und Lasker-Schüler.
Zech hat trotz der Ablehnung seines Essay-Bandes über Lasker-Schüler den Kontakt mit Bachmair nicht aufgegeben. Nach dem Erhalt einiger Texte für seine Zeitschrift „Die Neue Kunst“ teilt dieser dem Absender mit: „Die Novelle ist leider zu lang. Vielleicht schicken Sie mir einmal einige kürzere. Die vier Gedichte dagegen habe ich behalten. Sie erscheinen im ersten Heft, das für Mitte Juni zu erwarten ist.“ Er schlägt vor: „In Berlin sah ich unlängst die erste Nummer Ihres ‚Neuen Pathos‘. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Zeitschrift mir gegen die ‚Neue Kunst‘ tauschweise zusenden wollten.“190 Zech ist einverstanden: „Ich hätte Ihnen schon Heft eins gesandt, aber wir haben uns in dem Drucker getäuscht und bekamen die Zeitschrift nicht so heraus, wie wir wünschten.“
Aufschluss über die anfänglichen Schwierigkeiten des Blattes liefern die Sätze: „Nun druckt Tieffenbach auf der Handpresse, was sich bei der kleinen Anzahl (100 Exemplare) machen lässt. Er druckt Heft eins noch einmal und sobald es da ist, bekommen Sie es nachgeliefert.“ Zech scheint jetzt, wie er Bachmair berichtet, als Autor stark gefragt: „was ich schreibe, geht gleich weg. Ich gebe Ihnen daher jetzt gleich eine kürzere Arbeit; denn ich weiß nicht, ob ich später noch darüber verfügen kann. Die Arbeit kommt nämlich in ein Buch, das ich Ende des Jahres herausbringen will.“191
Munkepunke in die Küche!
Wie schon in Elberfeld sucht Zech auch in Berlin Erholung vom Alltag nicht zusammen mit seiner Familie, sondern unternimmt alleine ausgedehnte Spaziergänge. Oftmals zieht es ihn zu den Grünflächen in der Nähe, wo ihm in der Millionenstadt ein Rest von Natur verblieben ist. Wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt liegt der Hindenburgpark. In den flüchtet er abends, denn der bietet ihm eine Erlebniswelt, die seine schriftstellerische Phantasie beflügelt: „Mein Park liegt in Häuserwand, Glasaugen und rauchsträhnigen Himmel geklemmt. Schwimme ich ihm zu, durch breitzottige Straßenwellen, gekreuzt von fauchenden Wagen und vielerlei Menschengewicht […], fallen acht Abendschläge vom Turm.“ Stundenlang streift er durch die Anlage, verweilt am Kanal, der sie durchquert, und denkt sich Geschichten über Menschen aus, denen er begegnet. Spät kehrt er nach Hause zurück: „Und ein Hof ist wieder. Unheimlich still. Und mein bücherschwüles Zimmer. Ich zünde die grüne Lampe an.“192 Wenn er zu müde für solche nächtlichen Spaziergänge ist, setzt er sich auf den Balkon und träumt. Im Gedicht schildert er, was er dann sieht: „Am Abend stehn die Dinge nicht mehr blind / Und mauerhart in dem Darüberspülen / Gehetzter Stunden; Wind bringt von den Mühlen / Gekühlten Tau und geisterhaftes Blau. / Die Häuser haben Augen aufgetan“.193
Da der Familienvater selten etwas gemeinsam mit Frau und Kindern unternimmt, springt die Freundin für ihn ein. Rudolf Zech jun. (Rudi) erinnert sich: „Sehr viel verdanke ich […] Else Lasker-Schüler und ihrem Sohn Paul […]. Wir gingen oft gemeinsam in den Zirkus, fuhren Dampfer auf märkischem Gewässer, durchstreiften belebte Straßen und beobachteten das Tierleben im Berliner Zoo.“ Auch wenn der Hausherr nicht in der Babelsberger Straße 13 anwesend ist, findet sich die Dichterin bei dessen Ehefrau und Kindern ein. In Rudis Bericht heißt es dazu: „Das anregende Geplauder der Else Lasker-Schüler öffnete uns den Blick für außergewöhnliche Dinge. Zu Hause wurde gemalt und gezeichnet, wobei sie die Rolle des Lehrers übernahm.“194
Der achtjährige Sohn Zechs und seine zwei Jahre jüngere Schwester haben sich rasch in Berlin zurechtgefunden, Freundschaften geschlossen und besuchen in Wilmersdorf die Schule. Dagegen fühlt sich Ehefrau Helene in der Hauptstadt nicht heimisch. Paul lässt sie oft allein, wenn er in den Caféhäusern Geschäfte zu erledigen hat oder spazieren geht. Sie sieht ihre Befürchtungen bestätigt und sehnt sich zurück ins Bergische Land.
Im Juni erscheint die zweite Nummer des „Neuen Pathos“. Wie das erste Heft umfasst sie etwa dreißig Seiten. Der längste Beitrag stammt von Schmidt. Zech ist mit zwei Gedichten sowie einer Verwey-Übertragung vertreten. Von Ehrenbaum-Degele, Benn, Pinthus, Albert Ehrenstein und Engelke finden sich jeweils zwei Gedichte, von Werfel, Loerke und Meurer je eins. Das Heft enthält insgesamt fünf Grafiken. Sie stammen von Meidner und Steinhardt. Engelke, dessen Beiträge Zech auf Dehmels Anregung hin akzeptiert hat, meldet sich bei Zech: „Ich danke Ihnen für die Annahme der Gedichte. Ich war verwundert und erfreut, gleiche Bestrebungen, wie ich sie in solcher Ähnlichkeit nicht vorhanden glaubte, zu finden.“195 Eine weitere Nachricht trifft von Lasker-Schüler ein: „Bitte schreiben Sie doch dem Saturn für die ungeheure Summe, die ich bekam, möchten sie doch das Glichée [!] meiner Photografie an Professor Kohut sofort senden. Für seine Literaturgeschichte.“196 Ohne Wissen der Freundin nimmt Zech eine Einladung Waldens und dessen zweiter Gattin an.197 Auf die Zusammenarbeit mit dem Herausgeber des „Sturm“ möchte er nicht verzichten.
Der Student Rudolf Börsch will einen Artikel über den Verfasser des „Schwarzen Reviers“ schreiben, und benötigt dafür dessen Veröffentlichungen. Mehrfach versucht er, sich mit Zech zu treffen, doch die verabredeten Gespräche kommen nicht zustande. In Briefen an den Studenten sucht der Autor nach Ausreden: „Sie waren am Sonnabend plötzlich verschwunden als ich hinaus kam“,198 heißt es da, und: „Ich habe Sie am Sonnabend im Josty vergeblich gesucht.“199
Für seine Rilke-Monographie hat Zech das Buch „René Maria Rilke ‚Leben und Lieder‘, Straßburg, 1894“ benutzt. Nun bittet ihn Fritz Adolf Hünich, der beim „Insel Verlag“ als Lektor tätig ist, ihm diese seltene Ausgabe zugänglich zu machen, weil er annimmt, sie sei in seinem Besitz. Die Antwort nach Leipzig lautet: „Das Erstlingswerk Rilkes habe ich vor etwa vier Jahren in Straßburg in einem Antiquariat entdeckt und für einen unverschämt teueren Preis erstanden. Meine Freude daran währte nicht lange.“ Die angebliche Ursache dafür: „Irgend ein ‚Freund‘ hat es gelegentlich mitgehen geheißen und nun suche ich schon Jahr und Tag danach.“ Das Werk ist Zech nicht gestohlen worden, sondern nie in seinem Besitz gewesen. Zech fährt fort: „Meines Wissens existiert nur noch ein Exemplar und das dürfte in der Königlichen Bibliothek in Berlin sein.“200 Dort hat er 1912 das Buch eingesehen.
Seit dem Erscheinen von Boldts Gedicht „Lektüre“ wartet Zech auf eine Gelegenheit, sich am Verfasser und dem Herausgeber der Zeitschrift, in der das Pamphlet erschienen ist, rächen zu können. Jetzt kommt ihm die Idee, der Schmähung seines Werkes an gleicher Stelle ein Lob entgegenzusetzen. Dieser Plan gelingt. Im Juni steht in der „Aktion“ eine positive Besprechung des „Schwarzen Revier“.201 Verfasser ist ein „Paul Robert“. Zech hat den Artikel selbst geschrieben und ihn Pfemfert unter anderem Namen zugeschickt. Die Aufdeckung des Schwindels zieht sich über ein Vierteljahr hin und bereitet dem Verursacher jede Menge Ärger.
Mehr Verdruss als Freude verschafft Zech auch die Wochenschrift „März“. Sie veröffentlicht zwar fünf Gedichte aus dem „Schwarzen Revier“, aber in der gleichen Ausgabe schreibt Blass eine Glosse über deren Verfasser: „Sicher ist es hübsch, ein Könner zu sein auf dem Gebiet des Hübsch-Sicheren (und des manchmal mehr als Hübsch-Sicheren). Wenn man überhaupt ein Könner ist. Wenn man aber schon mal ein Könner ist, dann – (?)“202 Diese Sätze muss Zech von einem Kollegen lesen, den er gegenüber Dehmel als „völlig unbegabt“ bezeichnet.203 Gegen Blass kann er sich schlecht wehren, weil der einflussreiche Fürsprecher hat, die nicht verprellt werden dürfen. Seinem Ärger macht er in einem Artikel für die Monatszeitschrift „Xenien“ Luft. Darin bespricht er, wieder unter dem Pseudonym „Dr. Paul Robert“, zwei Lyrikanthologien, die unlängst erschienen sind. Zum einen die Sammlung „Der Mistral“, herausgegeben von Meyer, Lautensack und Ruest.204 Zum anderen „Fanale“ aus dem Saturn-Verlag.205 Im ersten Buch gefällt ihm kein einziger Beitrag, im zweiten hält er jeden für ein Meisterwerk. Darüber hinaus macht er öffentlich seinem Ärger über „Munkepunke“ Luft: „Man versuche für A. R. Meyer eine Stelle als Küchenchef ausfindig zu machen, damit er uns nicht noch weiterhin die Literatur zu Brei verrühre, wie es auch durch die in seinem Verlage erscheinenden Flugblätter zum Teil geschieht.“ Lautensack und Ruest bleiben gleichfalls nicht verschont. Der Kritiker tadelt: „Die Herausgeber des ‚Mistral‘ besitzen aber nicht einmal soviel Blick und Anstand, um zu wissen, dass man nicht gut auf der einen Seite Autoren verprügelt, auf der anderen Seite als moderne Dichter anpreist.“206
Zündstoff birgt auch Zechs Besprechung der „Fanale“. Diese Anthologie hat Meister den Gedichten von sechs „rheinischen Lyrikern“, unter ihnen Zech, vorbehalten. Der pseudonyme Rezensent lobt die Autoren, indem er andere heruntermacht: „Endlich emanzipiert sich hier der Rhein von jener deprimierenden Feuchtfröhlichkeit, die sich um Walter Bloem, Rudolf Herzog und Genossen schart“. Zur selben Zeit verhandelt er mit Bloem über die Uraufführung eines seiner Stücke, denn der ist am Stuttgarter Hoftheater als Chefdramaturg engagiert. Die abfällige Bemerkung über dessen Schaffen steht im Gegensatz zum Lob, mit dem er Monate zuvor den Roman „Volk wider Volk“ bedacht hat: „Bloem […] fasst kräftig zu. Seine Bilder haben Kolorit und Beweglichkeit. Seine Gestalten haben Mark und Bein. Er kennt nicht die billige Tränenrührseligkeit“.207 Von den sechs Autoren der „Fanale“ nennt Zech vier lediglich mit Namen, ohne auf deren Gedichte einzugehen. Nur Robert R. Schmidt widmet er neun Zeilen und räumt schließlich drei Viertel des Beitrags dem Autor ein, um dem es ihm ausschließlich geht: „Paul Zech ist der älteste und ausgereifteste Dichter dieses Kreises.“ Dem Lob folgt der Abdruck des Gedichts „Fabrikstadt an der Wupper“.208
Albert Ehrenstein teilt Zech mit: „das neue Pathos erhielt ich. Ausstattung und Inhalt haben mir ausgezeichnet gefallen.“ Der Brief enthält auch die Nachricht, Kokoschka gestatte den Herausgebern, von den Bildern, die er bei Cassirer in Berlin ausstellt, Fotos machen zu lassen. Er genehmige ferner, diese Aufnahmen im „Neuen Pathos“ zu veröffentlichen. Den Vorschlag lehnen die Herausgeber ab, da Fotografien ihrer Meinung nach nicht zum Erscheinungsbild einer Zeitschrift passen, die auf der Handpresse gedruckt wird. Ehrenstein weist Zech ferner darauf hin: „In meinem Schulkollegen Dr. Luitpold Stern (vom ‚Strom‘ und ‚Arbeiterzeitung‘) haben Sie und Meidner einen Schätzer gefunden.“209 In der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ liest Zech über „Das Neue Pathos“: „Der gemeinsame Wille aller Mitarbeiter […] zielt dahin: starkes Gefühl für die Welt und ihre Erscheinungen stark und menschlich herauszuschleudern.“ Der anonyme Verfasser des Artikels lobt: „Die Herausgeber haben in geschickter Weise verstanden, […] Proben dieses ‚neuen Pathos‘, von den älteren Begründern an bis zu den Allerjüngsten, die sich mehr und mehr einer Form annähern, welche in der Malerei Expressionismus genannt wird, zusammen zu bringen.“210 Zweigs Anerkennung für die zweite Nummer der Zeitschrift fällt knapper aus: „Vielen Dank für das schöne Heft.“211
Zech arbeitet an einem zweiten Theaterstück, „Der Turm“. Im Manuskript einer späteren Überarbeitung steht die Widmung: „Geschrieben Sommer und Herbst 1913 für meinen Landsmann, den Dichter Peter Baum.“212 Der „Landsmann“ ist unschwer als falsche Behauptung zu erkennen. Nur die Zeitangabe trifft einigermaßen zu. Inhaltlich geht es um das Sektenwesen im Wuppertal. Die Handlung ist als Vater-Sohn-Konflikt angelegt, einem der häufigsten Themen expressionistischer Dramatik. Auch das spricht für die vom Autor genannte Datierung.
Lasker-Schüler möchte im nächsten Heft des „Neuen Pathos“ eine Antwort auf Benns „Drohung“ veröffentlichen. Dazu hat sie Zech drei Gedichte zugesandt: „Giselheer dem Heiden“, „Giselheer dem Knaben“ und „Giselheer dem König“. Sie ermahnt ihren Freund: „bitte genau meine Correktur, bin sonst außer mir“. Zudem ordnet sie an: „Schicken sie mir sofort Journal.“ Den Wunsch kann er ihr erst einen Monat später erfüllen und die Druckanweisungen sind zu dem Zeitpunkt nur teilweise berücksichtigt. Der barsche Ton der Dichterin erklärt sich aus ihrer Stimmungslage: „Bin sehr herunter, weltmüde etcetera.“ Angeblich hat sie eine Kränkung erfahren: „Ehrenbaum-Degele soll scheußlich von mir sprechen, seh ich [ihn], geb ich ihm eine Backpfeife. / Was soll das alles?“213 Dem „reinen Liebesfreund“ Hans gelingt es innerhalb weniger Tage, Lasker-Schüler zu versöhnen.