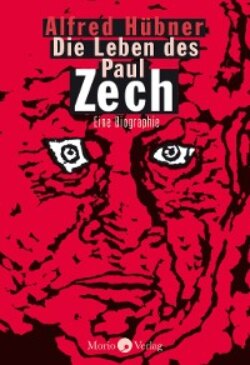Читать книгу Die Leben des Paul Zech - Alfred Hübner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStreit mit Ludwig Meidner
Eine Zuspitzung des Konflikts unter den Herausgebern des „Neuen Pathos“ hat sich in der kargen grafischen Ausstattung der zweiten Ausgabe des Blattes angekündigt. Nun teilt Meidner Albert Ehrenstein vertraulich mit: „Walden ist für mich erledigt, ebenso Herr Zech. Ich erfuhr durch einen Zufall – einer meiner Bekannten belauschte es im Café – dass Herr Tieffenbach und […] Zech beabsichtigen, diese Zeitschrift zu einer rein arischen zu machen.“ Einzelheiten der Unterhaltung kennt Meidner nur vom Hörensagen: „Die jüdischen Mitarbeiter sollen allmählich hinausgeschmissen werden und der zweite Jahrgang des neuen Pathos […] wird ganz von norddeutsch-evangelischem Schollengeruch erfüllt sein.“ Angeblich ist folgende Vorgehensweise geplant: „Tieffenbach […] will auf eine sehr perfide Art meinen Austritt erzwingen: meine Zeichnung im nächsten Heft soll verdruckt und ganz verschmiert wiedergegeben werden. Ich werde natürlich allen jüdischen Mitarbeitern […] Mitteilung davon machen.“ Aus diesem Grund fragt Meidner nach Franz Werfels Adresse und schildert im Detail, wie sehr er unter dieser „Infamie“ leidet.214
Der unbekannte Lauscher dürfte Inhalt und Verlauf des Gesprächs nicht völlig frei erfunden haben. Das legen Zechs judenfeindliche Äußerungen in seinen Briefen an Wegener über den Literaturbetrieb in Berlin nahe. Eine durchgehend antisemitische Haltung der übrigen Herausgeber des „Neuen Pathos“ als Ursache für das Ende von Meidners Mitarbeit darf jedoch ausgeschlossen werden. Das zeigen Inhalt und Erscheinungsbild des Blattes ab Mitte 1913. Die nächste Doppelnummer enthält Ehrensteins Gedicht „Jehova“. Von anderen jüdischen Autoren wie Lasker-Schüler, Hasenclever und Werfel erscheinen ebenfalls Beiträge. Es finden sich darin sogar Texte von Blass und Lissauer, die Zech nicht ausstehen kann und deren Werke er schlecht findet.
Auch die grafische Ausstattung der Zeitschrift ist in der folgenden Zeit keineswegs nur „Ariern“ vorbehalten. Steinhardt liefert nach wie vor Radierungen und wird zu einem engen Freund Zechs. Das belegt der Briefwechsel des Ehepaares Jakob und Minni Steinhardt mit Rudi und Hella Zech in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts. Zu der Zeit äußert sich auch Meidner nochmals zu dem Streit, ohne auf dessen Ursache einzugehen: „Paul Zech ist ziemlich vergessen und ich selber nicht weniger. Und er war doch sehr begabt und konnte viel. Ich kannte ihn gut und hatte einige Zusammenstöße mit ihm.“215
Was letztlich im Sommer 1913 zum Bruch zwischen zwei der vier Herausgeber des „Neuen Pathos“ führt, ist schwer zu durchschauen. Auslöser könnte Meidners Einspruch gegen den Abdruck der Kunstwerke von Marc und Campendonk sein. Unterstützung erfährt Zech von Lasker-Schüler, die den Wegfall der Beiträge ihres „Blauen Reiters“ Franz Marc missbilligt. Schriftlich äußert sie sich dazu nicht. Wichtiger sind ihr die eigenen Verse für Benn. Bald nach der ersten Anfrage mahnt sie: „Wie ist das mit den Gedichten?“216 Eine Krise, in der die Zeitschrift möglicherweise steckt, erwähnt sie nicht. Das Gleiche gilt für Steinhardt, der Zech gut gelaunt schreibt: „seit einer Woche bin ich in meiner Heimat [Zerkow], pflege mich gut und führe ein süßes faules Leben. Wie geht es Ihnen? Hat Ihnen [Eduard] Fuchs den Linoleum-Schnitt gegeben?“217 Er fragt nach einem Portrait Zechs von seiner Hand, das im „Saturn“ Verwendung finden soll. Nichts deutet auf eine Verstimmung oder die bevorstehende Aufkündigung der Mitarbeit des Künstlers am „Neuen Pathos“ hin.
Oskar Loerke entspricht Zechs Bitte, sich mit einem weiteren Beitrag an der Zeitschrift zu beteiligen: „Verehrter Herr Landsmann, ich freue mich sehr, dass endlich einmal auch unsere Provinz drankommt. Wir müssen uns auch persönlich kennen lernen.“ Damit spielt er auf die gemeinsame Herkunft aus Westpreußen an und fährt fort: „Hier schicke ich Ihnen von mir acht Stücke zum Aussuchen: so wenig oder so viel Sie wollen, das Übrige erbitte ich mir wieder, da Abschriften bei mir das Rarste sind.“218 Dieser Kollege bedeutet für Zech eine wichtige Erweiterung seines Berliner Bekanntenkreises. Mit ihm pflegt er Umgang abseits der Kneipenszene. Loerke lädt ihn zu einem Besuch bei sich zu Hause in der Joachim-Friedrich-Straße ein, erhält sofort eine Zusage und meldet sich erneut: „vielen Dank für Ihr liebenswürdiges Versprechen, Sonnabend zu kommen. Ich wohne im rechten Flügel des Hinterhauses, natürlich ganz oben. […] Sie sind herzlich willkommen.“219
Aus München schreibt Bachmair an Zech: „Ich muss Ihnen noch bestens danken für Ihr außerordentlich schönes Neues Pathos. Ich wollte dies schon längst tun, aber, Sie wissen ja selbst, welche Arbeit und Zeit eine neue Zeitschrift erfordert. Nun ist das erste Heft glücklich im Handel.“220 Damit meint er „Die Neue Kunst“, in der zwei der vier Gedichte stehen, die Zech eingereicht hat.221 Ihr Verfasser zeigt sich erkenntlich, indem er Bachmair ankündigt: „Von Ihren eingesandten Gedichten für ‚Das Neue Pathos‘ werde ich das ‚Vom Fenster aus‘ bringen. Da ich es aber erst in Heft eins oder zwei des zweiten Jahrgangs aufnehmen kann, werden Sie mir wohl in der Zwischenzeit noch ein zweites dazu senden können.“ Über die Querelen unter den Herausgebern der Zeitschrift ergeht er sich in Andeutungen: „Ich bitte Sie um Diskretion dieser Mitteilung, da ich aus bestimmten Gründen nicht wissen lassen darf, wer alles Mitarbeiter am Neuen Pathos ist, soweit es den zweiten Jahrgang betrifft.“
Erstaunlicherweise kündigt Zech Bachmair auch einen Artikel über Blass an: „Ich glaube, dass Sie durch Veröffentlichung meines Aufsatzes diesen Künstler dauernd fesseln. Lieb wäre es mir, wenn der Aufsatz bald gedruckt würde, da das betreffende Buch schon lange heraus ist.“222 Was ein Verriss sein könnte, stellt sich als Würdigung der Verse eines Kollegen dar, über den Zech bisher nur gescholten hat: „Blass ist ein Lyriker von Geblüt. Wenn er sagt: ‚Laternen schlummern süß und schneebestaubt‘ oder ‚mit welchem Glücke bin ich ganz belaubt‘ […] so ist dies keineswegs ein Produkt aus Ästhetik destilliert, sondern Seele – nichts als Seele.“ Er schränkt zwar ein: „Das Mittel der Sprache handhabt er mit einer Gleichgültigkeit, die sich an Stefan George tiefst versündigt“, lobt dann jedoch: „Andererseits aber hat gerade Blaß in der Lautmalerei, in der Wortsymbolik unerhört Fertiges geleistet.“ Bachmair nimmt den Artikel für „Die Neue Kunst“ an.223
Von Zweig kommt ein Brief, der eingangs die erfreuliche Nachricht enthält: „Jüngst sah ich in der Wiener Arbeiter Zeitung Ihr ‚Schwarzes Revier‘ abgedruckt.“ Dann schreibt er: „Ich meinerseits führe gegen Sie Klage, dass ein Buch über Rainer Maria Rilke bei Ihnen erschienen ist und Sie es mir nicht gesandt haben“.224 Das will der Beschuldigte nicht auf sich sitzen lassen: „Ich hatte den Verleger beauftragt, Ihnen das Buch zu senden. Da er augenblicklich verreist ist, konnte ich nicht feststellen, wer die Absendung verbummelt hat. Gedulden Sie sich ein paar Tage. Ich habe kein Exemplar zu Hause.“ Zech bittet Zweig auch um weitere Beiträge für „Das Neue Pathos“ und wiederholt, für das „Berliner Tageblatt“ einen Artikel über die Werke des Kollegen schreiben zu wollen. Zugleich kündigt er an: „Vom Journalismus möchte ich mich unter allen Umständen zurückziehen. Die Kraft, die man dafür aufwendet, ist weggeworfen. Ich hoffe irgend ein Lektorat zu bekommen.“
Trotz der „Lohnschreiberei“ und den Verpflichtungen als Herausgeber bleibt Zech noch Zeit für die Weiterarbeit an seinem Theaterstück „Der Turm“. Zweig erfährt: „Ich habe jetzt soviel Ruhe, dass ich endlich zum Drama komme. Die Vorarbeiten liegen schon seit einem Jahr im Schreibtisch.“ Es gibt eine zweite wichtige Neuigkeit: „Ich habe nun endlich einen seriösen Verleger.“ Damit meint er Erik-Ernst Schwabach. Dieser, Erbe eines großen Vermögens, hat den „Verlag der Weißen Bücher“ gegründet, in dem auch „Die weißen Blätter“ erscheinen. Weiter heißt es an gleicher Stelle: „Im Herbst bringe ich das Gedichtbuch ‚Die eiserne Brücke‘ heraus, im Frühjahr einen Novellenband ‚Baalsopfer‘. Beide Bücher sind die Produktion der Jahre 1909/1912.“
Indem Zech A. R. Meyer indirekt als „unseriös“ diffamiert, tut er ihm Unrecht, denn dieser hat ihm in Berlin zum literarischen Durchbruch und zu einer Wohnung verholfen. Obwohl „Das schwarze Revier“ als “lyrisches Flugblatt“ so erfolgreich ist, lässt der Verfasser Zweig wissen: „Ich bedauere aber doch, dass ich es in der vorliegenden Form herausgegeben habe. Es ist nur ein Drittel der Gedichte, die eigentlich diesem Zyklus angehören. Die anderen zwei Drittel sind meines Erachtens stärker“. Offenbar hat er vergessen, selbst für die Auswahl verantwortlich gewesen zu sein. Zudem ärgert er sich über „Munkepunke“, weil dieser und seine Freunde Meidners Äußerungen über das belauschte Caféhaus-Gespräch weiterverbreiten: „Das neue Pathos entwickelt sich nach außen stetig. Übelwollende Menschen (der A. R. Meyer Kreis gehört hierzu) unterschieben dem Unternehmen antisemitische Tendenzen. Ich lach nur!“225
Zweig antwortet: „Was Sie mir von Alfred R. Meyer schreiben und der lächerlichen Anschuldigung gegen Sie, so glaube ich nichts davon und selbst, wenn man es mir sechsmal gesagt hätte.“ Er erinnert Zech daran, ihn gewarnt zu haben: „Ich muss nur immer an unser gutes Gespräch damals in Berlin denken, wo ich Ihnen alle Gehässigkeiten Ihrer ehemaligen Freunde und des ganzen Berliner Gesindels schon voraussagte für den Fall, dass Sie bald einen Erfolg haben sollten.“226 Was Zweig nicht ahnt: Zech will weiterhin mit diesem „Gesindel“ die Nächte im Berliner „Caféhaussumpf“ zubringen. Er hat viele Freunde in dieser Runde. Unter anderen Rudolf Johannes Schmied, den Verfasser eines erfolgreichen Jugendromans „Carlos und Nicolas“, sowie den Künstler Friedrich von Schennis.
Das dritte Heft des „Neuen Pathos“ müsste turnusgemäß Anfang August in den Handel kommen. Seine Fertigstellung verzögert sich aber um mehrere Wochen, nicht zuletzt deshalb, weil es sich erstmals um eine Doppelnummer handelt. Kurz vor Redaktionsschluss bekommt Zech von Hasenclever das Angebot: „ich schicke Ihnen morgen etwas, ein, ich glaube, Vollendetes: ‚Schlussgesang eines Zwanzigjährigen (am Ende des ersten Akts einer Tragödie)‘. Es sind Verse. Ich muss aber Korrektur haben. Ist noch Zeit?“227 Am nächsten Tag trifft der Beitrag ein. Sein Verfasser fragt im Begleitschreiben: „Wie finden Sie das hier? Es ist der Schluss des ersten Aktes meines Dramas, das sonst in Prosa ist.“ Bei diesem Text handelt es sich um den lyrischen Monolog des „Sohnes“ aus Hasenclevers gleichnamigen Stück, einem der wirkungsvollsten Werke des literarischen Expressionismus. Zech erkennt die Bedeutung des Beitrags und geht deshalb auf die Forderung des Kollegen ein, der wissen will: „Kann es so gedruckt werden und kann ich (bitte!) Correktur bekommen – die ich umgehend retourniere!? Herr Tieffenbach wird schon mit sich reden lassen und das freundlichst tun.“228
Zweig sieht sich durch Zechs Schilderungen in seiner Meinung über die Berliner Bohème bestätigt. Den Angriffen auf den Kollegen kann er Positives abgewinnen: „Nun scheint es ja so weit zu sein und das Widerliche beweist da indirekt ein sehr Erfreuliches.“ Damit meint er Zechs neuesten Erfolg: „Ich bekam gerade auch das Paul Zech-Heft des ‚Saturn‘ mit dem bösartigen Linolschnitt und dem wundervollen ersten Gedicht“.229 Er bezieht sich auf „Heiland der Armen“ und Zechs Portrait von Steinhardt. Die letzte Seite des Heftes enthält Lasker-Schülers Karikatur ihres Freundes, unter der die Parole steht: „Mit Huf und Tritt von Stall zu Stall.“230
Zech informiert Bachmair: „Ich habe den Anfang zu dem Aufsatz ‚Ernst Blaß‘ etwas abgeändert und sende Ihnen das Manuscript anbei. Ich bitte Sie, das beim Satz zu beachten. Korrektur erhalte ich doch?“ Die nächste Frage lautet: „würden Sie mir vielleicht das Honorar für die beiden gedruckten Beiträge anweisen? Ich bin seit Wochen wieder in einer mißlichen Lage.“231 Dieser Bitte entspricht der Verleger nicht, möglicherweise deshalb, weil seine Geduld allmählich zu Ende geht. Er schreibt zurück: „Sie scheinen mich in der Art missverstanden zu haben, als Sie annahmen: Ihre Arbeit sei mir zu wenig umfangreich … und schickten mir daher noch einen ziemlich umfangreichen Vorabschnitt.“232 Bachmair unterbreitet einen Vorschlag, wie der Text zu kürzen wäre, den Zech aber nicht akzeptiert.
A. R. Meyer und Zech wollen ein Abkommen aushandeln, auf dessen Grundlage der Konflikt zwischen ihnen beiden beigelegt werden soll. Eingeschaltet ist der Berliner Rechtsanwalt und Literat Martin Beradt. Ihn charakterisiert der Schriftsteller Paul Mayer in der „Aktion“ so: „Er ist einer der vornehmsten Kämpfer gegen den mumienhaften Begriffsfetischismus der juristischen Scholastik, gegen die Formalisierung der Lebenstatbestände von Anno Dazumal.“233 Als Zech den Entwurf für die Vereinbarung in Händen hält, nimmt er gegenüber dem Anwalt dazu wie folgt Stellung: „da mein Verleger A. R. Meyer seit einigen Wochen gegen mich in einer ganz undiskutablen Weise vorgeht, kann ich beim besten Willen das Abkommen, das wir in Ihrer Gegenwart durchgesprochen haben, nicht anerkennen“. Seine Vorwürfe contra Meyer lauten: „er verbreitet Gehässigkeiten und Verleumdungen gegen meine Person und meine Tätigkeit als Herausgeber der Zeitschrift ‚Das neue Pathos‘.“ Das Übereinkommen will er nicht unterschreiben: „[da] es mir Dinge zumutet, die mir finanzielle und ideelle Nachteile bringen.“234 Er fühlt sich im Recht und sieht keinen Grund, weshalb ausgerechnet er nachgeben soll.
Am 20. August notiert Loerke in sein Tagebuch: „Heute habe ich mir im ‚Sturm‘ […] die Arbeiten von Paul Zech zusammengesucht. Es wird von ihm so viel Rühmens gemacht. Aber an den meisten Gedichten ist das Gedicht vergessen, was mir bei der Feierlichkeit besonders peinlich ist.“ An einigen Versen findet er dennoch Gefallen: „Aber eine Menge Einzelbegabung ist da. Freude des Ausdrückens. Nicht Freude, etwas auszudrücken. Vielfach so. Hervorragend nur ‚Halluzinierte Nacht‘.“235
Lasker-Schüler hat keinen Probeabzug ihrer Gedichte erhalten. Von München aus mahnt sie Zech: „Bitte ja Correktur!“ Auch in einer anderen Sache zeigt sich die Dichterin beharrlich. Da der Freund ihr gegenüber behauptet hat, die gesamte Auflage der bei Meyer erschienenen „Hebräischen Balladen“ sei verkauft, was nicht zutrifft, ist sie schließlich beim Verleger vorstellig geworden. Dieser will nun wissen, von wem die falsche Auskunft stammt. Deshalb fordert sie Zech auf: „schreiben Sie ihm, wenn es wirklich wahr ist. Sie sagten mir doch, die tausend seien verkauft.“236 Ihr Freund weiß sich nur zu helfen, indem er nicht reagiert, aber aussitzen lässt sich weder die eine noch die andere Angelegenheit.
Albert Ehrenstein veröffentlicht im „Berliner Tageblatt“ einen Artikel über „Paul Zechs Gedichte“. Darin werden zwar die „Waldpastelle“ als eine „schollenbrüchige Waldpostille“ und als „Waldpastillen“ bezeichnet, doch der Verfasser lobt „Das schwarze Revier“ indem er Vergleiche mit Werken berühmter Autoren anstellt: „In wenigen Zeilen ist ein ‚Milieu‘ ebenso restlos und poetisch übersponnen und eingefangen wie in den dicken Wälzern von Lemonnier, Zola, Verhaeren.“237 Obwohl er zurück in seine Heimatstadt Wien gezogen ist, zeigt er sich über die Vorgänge in der Berliner Bohème gut informiert: „Ich hoffe, dass mittlerweile die antineopathetische Bewegung abgeflaut ist.“ Eine weitere Besprechung der Werke Zechs hat er an die „Vossische Zeitung“ geschickt und Josef Luitpold Stern von der „Wiener Arbeiter-Zeitung“ vorgeschlagen, zwei Novellen Zechs in seinem Blatt abzudrucken. Ferner rät er dem Kollegen, wie er sich bei seinen Verhandlungen mit Erik-Ernst Schwabach verhalten soll: „es wäre fast besser, wenn Sie sich nur auf ein Jahr mit einer Monatsrente von 100 Mark festlegen könnten, denn nach meinen […] Erfahrungen kann die Summe im zweiten Jahr sukzessive auf 150 bis 200 Mark erhöht werden.“238 Zech verhandelt mit dem Verleger über die Herausgabe je eines Lyrik- und Novellenbandes sowie den Abdruck von Beiträgen in dessen Zeitschrift „Die weißen Blätter“.
Ulrich Rauscher, der in Straßburg als Korrespondent für die „Frankfurter Zeitung“ tätig ist, lobt „Das schwarze Revier“ und seinen Verfasser: „Solche Kraft, wie Zech sie hat, lässt sich nicht verleugnen, manchmal verliterarisieren, aber die Kraft steht immer wieder auf und bewegt die starken Worte.“239
Zech widerspricht Bachmair: „Mir ist sehr daran gelegen, den Blass-Essai ungekürzt heraus zu bringen. Die paar Zeilen Platz mehr, dürften doch keine Rolle spielen. Ich bin gewiss alles andere eher, denn ein Zeilenschinder.“ Diese Selbsteinschätzung stimmt wenig mit der Realität überein. Damit ihm ein Honorar, mit dem er fest rechnet, nicht entgeht, zeigt er sich jedoch kompromissbereit: „Ich habe gegen eine Kürzung schwerwiegende künstlerische Bedenken. Wenn es aber nicht anders gehen sollte, muss ich, so leid es mir tun würde, mich der Kürzung fügen.“
Statt auf Bachmairs Forderung einzugehen, den eingereichten Text zu kürzen, schickt Zech noch mehr Beiträge nach München: „Anbei ein paar Übertragungen Deubelscher Gedichte. Vielleicht haben Sie dafür Verwendung.“ Über das erste Heft seiner Zeitschrift „Die Neue Kunst“ bekommt der Verleger zu lesen: „Von den literarischen Beiträgen halte ich für wertvoll so ziemlich alles außer A. R. Meyer, Emmi Hennings und dem einen Gedicht von mir.“ Das ist kein Schreibfehler, denn danach steht: „Man kann nicht genug selbstkritisch sein.“ Ansonsten hält sich Zech mit Kritik zurück, kann sich aber die Bemerkung nicht verkneifen, „dass mir die Grafik wenig gefällt“. Wenig glaubhaft kündigt er an: „Ich ziehe mich von aller ‚Literatur‘ zurück. Meine Erfahrungen mit der Berliner Bohème waren keineswegs rosig. Man kann nur arbeiten und auf sich selbst hören. Ein Geld ist dabei ja kaum zu verdienen.“
Zum Schluss insistiert Zech: „Wie stellen Sie sich jetzt noch zu dem Essaibuch über Else Lasker-Schüler? Es dürften recht vier Druckbogen sein. Ich möchte dieses Buch nicht für den ‚Modernen Dichter‘ des Herrn Borngräber hergeben, da er mir den Rilke total verhunzt hat.“ Er ignoriert die Tatsache, von Bachmair für diese Publikation schon eine Absage erhalten zu haben und legt nach: „Mein Honoraranspruch für alle Rechte ist sehr mäßig. 75 Mark.“240
Eigenlob stinkt anderen
Ende August liegt als Doppelnummer Heft drei und vier des „Neuen Pathos“ vor. Ehrenbaum-Degeles „Vorspiel zu einem Drama ‚Der Werkmeister‘“ füllt ein Drittel der Ausgabe, Schmidts Gedichte nehmen neun (!) Seiten in Anspruch. Zech ist mit der Erzählung „Die erste Nacht“ sowie Nachdichtungen von Versen Léon Deubels vertreten, denen er eine Meldung über den Tod des Autors im Juni 1913 vorausschickt. Mitherausgeber Schmidt lobt ihn dafür: „Ihre Deubel-Übertragungen sind ganz famos.“241 Von Ernst Blass finden sich zwei „Heidelberger Gedichte“, von Arno Holz, Heinrich Lautensack und Franz Werfel je ein Beitrag. Oskar Loerke hat zwar sechs Gedichte eingereicht, doch sind lediglich zwei im Heft abgedruckt. Else Lasker-Schüler richtet „Drei Gesänge an Giselheer“, das heißt, an Gottfried Benn. Literaturhistorisch nicht weniger bedeutsam ist die Veröffentlichung des Monologes aus Hasenclevers Stück „Der Sohn“.
Ein Ausscheiden Meidners wird nirgends erwähnt. Da Zech nun für den gesamten Inhalt der Zeitschrift verantwortlich ist, hat er Original-Lithografien und Radierungen von zeitgenössischen Künstlern ausgewählt, die erstmals im „Neuen Pathos“ vertreten sind: Raoul Hausmann, Erich Heckel, Waldemar Rösler und Walther Bötticher. Alle zeigen Motive am Wasser, denn sie sollen thematisch zum Erscheinungstermin der Ausgabe im Hochsommer passen. Allerdings kommt das Heft erst heraus, als der Sommer nahezu vorbei ist. Steinhardt, der auch bei dieser Ausgabe ohne Vorbehalt mitmacht, ungeachtet der Kontroverse zwischen den bisherigen Herausgebern, hat eine Radierung und, wie schon in den vorigen Ausgaben, das Signet „Adam und Eva mit der Schlange“ für die „Officina Serpentis“ geliefert.
Kurz nach dem „Neuen Pathos“ erscheint „Das sechste Buch“ der „Bücherei Maiandros“. A. R. Meyer widmet es dem Andenken Deubels und veröffentlicht darin zwölf Gedichte des Franzosen. Zechs Verstimmung über die Publikation wird durch eine Nachricht von Gottfried Benn verstärkt, der fragt: „Von mir erscheint ja demnächst bei Meyer ein neues Heft. Gegen den Verlag lässt sich ja nichts sagen. Wo soll man auch hin?“ Über die jüngste Ausgabe des „Neuen Pathos“ urteilt der Kollege: „Die Blass‘schen Sachen finde ich einfach kindisch. Richtigen Schund“. Er vermutet: „Sie haben wahrscheinlich gewisse Rücksichten nehmen müssen, da er ja einer mächtigen literarischen Partei angehört. Aber im Interesse Ihrer schönen Zeitschrift bedauere ich es sehr.“ Lob findet er für einen anderen Beitrag: „Die Lasker-Schülerschen Gedichte sind wunderschön.“242 Sie gelten ihm persönlich, wie er sehr wohl weiß, doch das erwähnt er nicht.
Hasenclever gefällt „Das Neue Pathos“ ebenfalls. Er möchte weiter Beiträge liefern, lässt aber wissen: „Ich will […] bis 1. Januar in Brügge leben und dort mein Stück vollenden.“ Zech hat ihn gefragt, ob er bereit sei, für die sächsische Presse eine Rezension über „Das schwarze Revier“ zu schreiben, doch er muss passen: „Leider bin ich und Pinthus vollständig mit den Leipziger Neuesten Nachrichten verkracht, sodass man von mir nichts nimmt. Aber Ehrenstein ist ständiger Mitarbeiter in der Bücherschau und könnte dort gut eine längere Sache über Ihre Gedichte veröffentlichen.“243
Zweig unterbreitet den Herausgebern des „Neuen Pathos“ einen Vorschlag, wie sie den Antisemitismus-Vorwürfen gegen ihre Zeitschrift wirksam begegnen könnten: „ein junger Bursche aus Galizien sendet mir Gedichte, die ich einfach genial finde […]. Er heißt […] Jakob [F. Rosner-] Funkelstein. Wollen Sie davon Verse für das Neue Pathos haben? Und dieser Name widerlegt alle Anwürfe des Antisemitismus.“244
Zech geht auf das Angebot nicht ein, nimmt aber erfreut Zweigs Mitteilung zur Kenntnis, er werde ihm bald eines seiner Gedichte schicken. Auch Dehmel bittet er um einen Beitrag für das nächste Heft und spricht eine grundlegende Neuerung an: „Ich hoffe, dass wir dann auch Honorar zahlen werden.“245 Demzufolge ist bisher für Texte sowie Bilder kein Geld an Autoren und Künstler geflossen. Die Zuschüsse der Mäzene Ehrenbaum und Schmidt reichen lediglich für den Druck der Zeitschrift. Aus Hamburg kommt die Antwort: „diesmal kann ich leider nicht dienen; ich habe seit Monaten keinen Vers geschrieben […]. Und jetzt brenne ich darauf, ein Drama auszuarbeiten, dessen Entwurf ich schon seit einem Jahr liegen habe.“246
Das „Kinobuch“ von Pinthus hat Zech auf die Idee gebracht, weitere Texte dieser Art zu schreiben. Er benennt zwei Erzählungen in „Filmstoffe“ um und schickt sie an Heinrich Lautensack, da dieser Kollege bei der „Continental-Kunstfilm-Gesellschaft“ in Berlin arbeitet. Der bedauert: „es thut mir recht sehr leid, Ihnen die beiden Filme […] zurückgeben zu müssen. Aber die Legion‘sache kam […] von vornherein kaum in Betracht, während das ‚Vermaaren‘stück [!] bei keinem unserer Regisseure Anklang finden wollte.“ Zech muss die Hoffnung begraben, in der Filmbranche schnelles Geld zu verdienen. Lautensack fragt ihn noch: „Haben Sie nicht was Neues?“ und lobt: „Letzte Pathos-Nummer sehr schön!!!“247
Lasker-Schüler wiederholt ihre Frage nach einem Belegexemplar: „Warum bekomme ich den Pathos nicht.“ Da sie die Antwort schon zu wissen glaubt, droht sie: „Ist etwa wieder nicht genaue Correktur – dann verlange ich Zweitdruck.“248 Aus Termingründen hat ihr Zech keinen Probeabzug von den drei „Giselheer“-Gedichten geschickt, damit sich das Erscheinen des Heftes nicht verzögert. Nun muss er die Dichterin aufsuchen, um sie zu versöhnen.
Von Zweig erhält Zech überraschend die Nachricht: „Ich treffe Sonntag Nachmittags oder Abend in Berlin ein und möchte Sie sehr gerne sehen. Darf ich Ihnen vorschlagen, abends um 8 Uhr in das Hotel Fürstenhof zu kommen, wo ich noch ein oder zwei andere Freunde treffen will, die Sie zum Teil schon kennen“.249
Vor Antritt seiner Reise nach Brügge meldet sich Hasenclever bei Zech und bestätigt ihm erneut, weiter als Autor beim „Neuen Pathos“ mitmachen zu wollen. Da er noch kein Belegexemplar der neuesten Ausgabe erhalten hat, wiederholt er seine Offerte: „ich kann Ihnen, bei freudiger und gewisser Mitarbeit, nichts Besseres geben als das Heißeste und Aktuellste, an dem ich bin: Das wäre aus meinem Stück, das ich schreibe und das heißen wird ‚Der Sohn‘.“ Er legt dem Herausgeber nahe: „haben Sie Vertrauen, dass das Stück, aus dem Sie vordrucken, gut ist“.250 Die Antisemitismus-Vorwürfe Meidners gegen Herausgeber und Drucker der Zeitschrift erwähnt auch er nicht.
Richard Weißbach schreibt an Zech: „ich höre, dass während ich auf Reisen war, ein Heft des ‚Neuen Pathos‘ mit Beiträgen von Blass und Ehrenbaum-Degele erschienen ist. Ich habe das Heft nicht bekommen.“ Zu Recht fordert der Verleger des „Kondor“ und des Blass‘schen Gedichtbandes „Die Straßen komme ich entlang geweht“ Belege ein, da beide Autoren bei ihm unter Vertrag stehen. Zech geizt mit diesen Handpressen-Drucken, da er Tieffenbach jedes einzelne Stück bezahlen muss.
Ende September wird in Paris eine „Anthologie zeitgenössischer deutscher Lyrik seit Nietzsche“ an den Buchhandel ausgeliefert. Herausgeber ist der achtundzwanzigjährige Franzose Henri Guilbeaux. Er hat für diese Edition Gedichte von vierzehn deutschsprachigen Autoren gesammelt, die Texte in seine Muttersprache übertragen und mit Erläuterungen zu den Verfassern versehen. Das Vorwort stammt von Verhaeren. Zech, der mit den Gedichten „Im Dämmer“ und „Kanalfahrt“ vertreten ist, befindet sich in illustrer Gesellschaft von Stefan George, Hofmannsthal, Rilke und Wedekind.251
Im „Kalender für das Bergische Land 1914“, der ab Herbst 1913 erhältlich ist, unternimmt Zech: „Ein[en] Streifzug durch die neuen Werke der Bergischen Dichter“.252 Zunächst werden die Fragen erörtert: „Was ist bergische Dichtung?“ und „Worin besteht […] das Wesen der bergischen Dichtung?“ Es folgt eine Hymne auf das Schaffen des Elberfelder Kollegen Walter Bloem, an dem ihm vor kurzem unter dem Pseudonym „Dr. Paul Robert“ eine „deprimierende Feuchtfröhlichkeit“ unangenehm aufgefallen ist. Bei der Besprechung des ersten Romans von Else Lasker-Schüler, „Mein Herz“, benutzt er Begriffe aus der Bildenden Kunst: „Fleck sitzt an Fleck, synthetisch und kubisch geordnet wie Farbsträhne[n] auf den Bildern der Modernsten: Franz Marc und Kandinsky“. Um ein Stück deutscher Prosa zu erläutern, verweist er nunmehr auf Werke von Künstlern, über die er zwei Jahre zuvor geschimpft hat: „Was die Expressionisten und andere ‚Isten‘ in halszerbrecherischen Jongleurkunststückchen dem Publikum vorgaukeln“. Wörtlich ist seinerzeit an gleicher Stelle über Fahrenkrogs Gemälde zu lesen gewesen: „Da sind nicht bloße farbige Flecken und Flächen, sondern organisches Leben, das heraustritt aus dem engen Rahmen und den Beschauer überwältigt.“253
Lasker-Schülers Stück „Die Wupper“ bespricht Zech zusammen mit Fahrenkrogs „Baldur“ und stellt beide Werke auf eine Stufe, was ihre literarische Qualität anbelangt. Abgesehen von der peinlichen Instinktlosigkeit, die Verse der jüdischen Dichterin neben ein antisemitisch aufgeladenes Machwerk zu stellen, fällt der Criticus damit ein krasses Fehlurteil. Wegener hat er bei der Niederschrift des Artikels angekündigt: „Im Bergischen Volkskalender für 1914 finden sich […] Witze, die ich um des lieben Friedens willen machen musste. Sie werden seiner Zeit darauf kommen.“254 Damit sind Texte gemeint, in denen er auf die Werke der lokalen „Haus-Dichter“ Friedrich Wiegershaus, Paul Jörg und Emil Uellenberg eingeht, aber nicht schreibt, was er von ihnen hält.
Trotz dieser Zurückhaltung regt sich Widerstand gegen Zechs Artikel. Der Jurist Hermann Ungemach schreibt ihm einen „Offenen Brief“, den die „Bergisch-Märkische Zeitung“ veröffentlicht: „nachdem ich Sie schon seit einiger Zeit im literarischen Teil des Berliner Tageblattes auf dem Sessel des Kunstrichters bewundern durfte, walten Sie dieses Amtes nun auch im Bergischen Kalender für 1914.“ Der Briefschreiber nimmt zunächst an der Form des Zech‘schen Artikels Anstoß: „Ihr Stil ist‘s, von dem wir reden wollen“, fügt aber hinzu: „Es will mir auch scheinen, als habe Ihr Urteil im Kalender sich nicht rein halten können von dem natürlichen Bestreben, Licht den Weggenossen und Schatten den Gegnern zu spenden.“ Anhand von Beispielen beanstandet er in dem „literarischen Streifzug“ schlechtes, vielfach unverständliches Deutsch, schiefe Bilder sowie übermäßigen, häufig auch falschen Gebrauch von Fremdworten sowie Zitaten aus deutscher und ausländischer Literatur.
Über Zechs Werdegang zeigt sich Ungemach gut informiert: „Verehrter Herr, soviel ich weiß, haben Sie sich ohne staatlich gestempelte Bildung durch eigenen Fleiß, aus eigener Kraft zu dem heraufgearbeitet, was Sie sind. Warum tragen Sie diese selbstgeschaffene Bildung nicht als Ihr Ehrenkleid?“ Die von ihm aufgezählten Fehlurteile sind seines Erachtens verursacht durch Geltungsbedürfnis des Autors, Angepasstheit an den Zeitgeist und Dilettantismus: „Sie […] haben damit Ihre Unfähigkeit bewiesen, überhaupt für deutsche Leser über deutsche Kunst zu schreiben. Und woher nehmen Sie gar den Mut und die Fähigkeit, über den Stil anderer Schreiber zu richten?!“ Als „letzte Rettung“ empfiehlt der Jurist dem Rezensenten die Lektüre von Eduard Engels „Stilkunst“.255 Auf den „Offenen Brief“ Ungemachs folgt ein Artikel von Lissauer über „Lob und Talent“, was nicht unbedingt Zufall sein muss.
Zech verfasst eine „Offene Antwort“, die er wieder mit Fremdwörtern vollstopft. In puncto Beleidigungen bleibt er Ungemach nichts schuldig: „Soll ich von einem, der unter mir steht, mir etwas vom Stil vorschmusen lassen?“ Beharrlich hält er daran fest: „Es gilt aber Front zu machen gegen eine Kunstkritik […] die […] den Ehrgeiz bekennt, einen Schleppkahn für fünftausend Idioten vom Stapel zu lassen, zu Nutz und Frommen einer neuen Gauneration“. Er diagnostiziert, der Brief seines Kontrahenten stelle die „Inkarnation einer Blähung“ dar, „die schlechte Verdauung zuweilen verursachen soll.“ In der „Bergisch-Märkischen Zeitung“ findet sich diese Erwiderung ungekürzt, aber mit dem Kommentar wieder: „Nichts kann unseren Lesern besser […] dartun, dass man Paul Zech nicht scharf genug auf die Finger sehen kann. Die ganze verwirrte Aufgeblasenheit des modernen großstädtischen Kaffeehausliteraten scheint uns aus diesen Zeilen Zechs zu sprechen.“ Vorgeworfen wird ihm „mißächtliche Betrachtung des eigenen Volkes“, „alberne geistige Überhebung“, „unklare schnoddrige Schreibweise“ und das „Fehlen einer Antwort auf die erhobenen Vorwürfe“.256
Ungemach erhält von der Redaktion erneut Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Deren erster Satz lautet: „Die Antwort Zechs auf meinen offenen Brief hat die Schriftleitung dieser Zeitung schon treffend gekennzeichnet.“ Der Jurist beschuldigt den Gegner, seinen Brief absichtlich falsch zu deuten: „ich […] habe nicht gesagt, der Bergische Kalender sei für die ‚ungebildeten Stände bestimmt‘, sondern in erster Linie für die ungelehrten Stände. Für den Unterschied von ungelehrt und ungebildet ist Zechs ‚offene Antwort‘ wohl ein Musterbeispiel.“257
Lasker-Schüler hat sich mit ihrem „Wupperfreund“ ausgesöhnt und spricht ihn wieder mit „Lieber Paul Zech“ an. Seine Frau und Kinder begleitet sie weiterhin auf deren Spaziergängen. Zu viert haben sie auch einen Ausflug in die Umgebung der Stadt unternommen. Die Dichterin schreibt dem Familienvater: „Ihrer lieben, reizenden, kindlichen Frau meinen Gruß, sie ist direkt ein liebes Kind, ohne Gemeinheit.“258 Zech selbst verspürt keine Lust, an derartigen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Dazu fehlt ihm seiner Meinung nach die Zeit. Neben der Tätigkeit beim „Berliner Tageblatt“ ist er darauf angewiesen, möglichst viele Artikel für weitere Printmedien zu schreiben, um Geld zu verdienen.
Im Verlauf weniger Monate erscheinen von ihm Texte höchst unterschiedlicher Thematik und Qualität. Hans von Gumppenberg veröffentlicht in der Zeitschrift „Licht und Schatten“ eine schwülstige Liebesgeschichte, „Das Erwachen“.259 Dagegen finden sich im „Saturn“ unter dem Titel „Vorposten“ Verse zum Thema Bergbau. Sie sind von ähnlicher Qualität wie die des „Schwarzen Reviers“. 1913 haben oberschlesische Bergarbeiter erfolglos gegen Hungerlöhne gestreikt. Zech greift das Thema auf und stimmt revolutionäre Töne an: „Wer glaubt, dass wir längst kirr und unberührbar sind? / Listig im Hinterhalt lauern Maschinenschützen. / Von Steppen östlich hergeweht, umrauscht uns guter Wind.“260
Benn schickt Zech ein Exemplar seines zweiten „lyrischen Flugblattes“, „Söhne“. Es enthält die gedruckte Widmung: „Ich grüße Else Lasker-Schüler: Ziellose Hand aus Spiel und Blut“, und handschriftlich den Eintrag: „Herrn Paul Zech mit freundlichem Gruß 5. X. 13. Gottfried Benn.“261
„Munkepunke“ weiß mittlerweile, um wen es sich bei „Dr. Paul Robert“ handelt, der in der „Aktion“ „Das schwarze Revier“ gelobt und die gehässige Kritik über den „Mistral“ für die „Xenien“ verfasst hat. Er greift Zech scharf an, doch dieser sieht sich zu Unrecht verfolgt. Ein Brief von ihm an Bachmair beginnt mit der Behauptung: „Obwohl ich grundsätzlich auf Verleumdungen nicht reagiere, muss ich Ihnen in dem Falle A. R. Meyer contra Zech folgendes mitteilen“. Diese Mitteilung beginnt: „Tatsache ist, und durch eidesstattliche Erklärung beim Vorstand des Schriftsteller-Schutzverbandes festgestellt: Der Verfasser der Kritiken unter dem Pseudonym Paul Robert heißt K. E. Meurer.“ Das ist nicht wahr. Zech widerspricht auch dem Vorwurf, er habe Schulden bei seinem Verleger: „Tatsache ist, dass mir Herr A. R. Meyer niemals Geld geliehen hat, mir ferner noch die Abrechnung über mein Versbuch ‚Schollenbruch‘ bis heute nicht geliefert hat.“ Weiter erfährt Bachmair: „Meyer behauptet, dass er ein Gedicht, das er dem ‚Neuen Pathos‘ anbot, wieder zurückgezogen hat. Tatsache ist, dass dieses betreffende Gedicht in der Redaktionssitzung abgelehnt wurde und [der Verfasser] danach erst den Beitrag zurückforderte.“
Wichtiger als diese falschen Behauptungen sind an gleicher Stelle Zechs Angaben zur Finanzierung des Drucks seiner Werke: „Ich zahlte Herrn A. R. Meyer für das Flugblatt ‚Waldpastelle‘ 60 Mark baar [!]. Für den Band ‚Schollenbruch‘ 95 Mark baar, der Rest von der zu zahlenden Summe, die 200 Mark betrug, dürfte durch Subskriptionen aufgebracht sein. Eine Verrechnung fand bisher nicht statt.“ Auch die „jungbergischen Dichter“ haben für die Veröffentlichung ihrer Texte Geld locker machen müssen: „Für das Flugblatt ‚Das frühe Geläut‘ das ich mit anderen bei A. R. Meyer herausgab, wurden 100 Mark baar bezahlt.“
Großen Wert legt Zech auf die Richtigstellung: „Herr A. R. Meyer hat, wie durch einwandfreie Zeugen nachgewiesen werden kann, behauptet, ich erhalte von dem Vater des Herausgebers Robert R. Schmidt, eine monatliche Rente; was nicht den Tatsachen entspricht.“ Damit hat er Recht. Die Zahlungen kommen der Zeitschrift und nicht dem Herausgeber zugute. Den Vorwurf des Verlegers: „‚Das neue Pathos‘ sei ein Konkurrenzunternehmen, er könne mich wegen unlauteren Wettbewerbs verklagen“, kommentiert er sehr von oben herab: „Ich würde das Vorgehen A. R. Meyers in einem wesentlicheren Falle mit einem außergewöhnlich scharfen ethischen Namensurteile belegen. Schmutz stoße ich nicht einmal mit den Füssen weg.“
Anschließend kommt Zech auf seine Mitarbeit an Bachmairs Zeitschrift sowie die Veröffentlichung der Deubel-Übertragungen zu sprechen, die er nach München geschickt hat. Über das Sonderheft der „Bücherei Maiandros“ für den französischen Dichter behauptet er: „Herr A. R. Meyer ist nur autorisiert, die sechs Gedichte der Flugblätter von Deubel zu übertragen. Die Übertragungen von Cohen und Benn sind in dem Buch ‚In memoriam Deubel‘ nicht von Deubel autorisiert.“ Er kündigt an: „Ich werde durch den Syndikus des Schutzverbandes dagegen Strafantrag stellen“. Das kann er schon deshalb nicht machen, weil er dann Benn zum Feind hätte. Ein drittes Mal fragt er Bachmair: „wie stellen Sie sich zu meinem Anerbieten […] das Essaibuch über Else Lasker-Schüler zu verlegen.“ Der Brief endet: „Im übrigen bitte ich Sie um Diskretion dieser Ihnen privatum mitgeteilten Aufklärungen. Ich bemerke nur, dass ich alle angeführten Dinge zu gegebener Zeit öffentlich bekräftigen werde.“262
Gegenüber Raoul Hausmann klagt Zech: „Differenzen mit A. R. Meyer und Genossen nehmen mir Zeit und Kraft. Ich bin seit drei Wochen wie ein Amokläufer herumgelaufen.“ Den Künstler, der in eine Auseinandersetzung mit der „Officina Serpentis“ verwickelt ist, interessiert viel mehr sein eigener Streit, bei dem er sich nicht genügend unterstützt fühlt. Zech hält dagegen: „Sie irren wenn Sie glauben, dass unser Verhältnis durch die Sache Tieffenbach contra Hausmann getrübt ist. […] Ich bitte Sie nun, mich am Freitag zwischen drei und fünf aufsuchen zu wollen.“263 Bei dieser Gelegenheit soll über einen weiteren Beitrag für das „Neue Pathos“ verhandelt werden. Entweder bleibt der Eingeladene dem Treffen fern, oder es verläuft nicht wunschgemäß, denn in Heft 5/6 ist keine Grafik von Hausmann enthalten.
Am zweiten Oktoberwochenende werden die Auseinandersetzungen um Zechs Rezensionen eigener Werke öffentlich. Pfemfert wendet sich in der „Aktion“ an „Paul Zech, Lyriker und Kritiker, Mitarbeiter des Berliner Tageblatt und des Praktischen Wegweisers“ mit der Aufforderung: „Herr Paul Robert Zech, ich bitte Sie, mir bis Mittwoch (den 15!) den Beweis zu liefern, dass Sie Ihren Verleger verklagt haben.“ Vom Beschuldigten ist ihm mitgeteilt worden, er werde gegen Meyer juristisch wegen falscher Behauptungen vorgehen. Pfemfert fährt fort: „der Vorwurf, Sie seien Ihr eigener Kritiker, muss Ihre lyrische Schaffenskraft lähmen, solange er nicht überzeugend abgewehrt ist. Beweisen Sie mir, dass Sie klagen. Und ich darf wohl hoffen, dass Sie Ihr Wirken als Kritiker bis zur Erledigung der Klage einstellen.“264 Auf Antwort wartet er vergeblich.
Bloem hält sich für wenige Tage zu Besuch in der deutschen Hauptstadt auf. Das Urteil des „Dr. Paul Robert“, der seinen Werken „deprimierende Feuchtfröhlichkeit“ bescheinigt, ist ihm anscheinend nicht zu Gesicht gekommen, oder er hat keine Ahnung, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt. Da er von Zech gedrängt wird, die Uraufführung des Dramas „Der Turm“ am Stuttgarter Hoftheater zu forcieren, will er sich mit ihm treffen: „Ich bin nur noch morgen früh in Berlin und bitte Sie, wenn Sie mit mir zusammen kommen wollen, mich um zehn Uhr im Hotel Exzelsior aufzusuchen.“265 Der Termin findet statt, eine Inszenierung des Stücks in Schwabens Metropole ergibt sich daraus jedoch nicht.
Ein anderes Werk Zechs, die Übertragung des Rimbaudschen Gedichtes „Das trunkene Schiff“, ist an Ernst Hardt gegangen. Der Verfasser hofft, sein Kollege werde zumindest Teile daraus im Rahmen eines „Balladenabends“ in Berlin vortragen, denn der gehört zu den bekanntesten deutschen Autoren. Hardt ist im westpreußischen Graudenz an der Weichsel geboren, nur 30 Kilometer von Briesen entfernt. Der Landsmann lässt Zech wissen: „Ich hatte ‚Das trunkene Schiff‘ in der Übertragung von Ammer gelernt, hab aber für morgen die ursprünglich geplanten Baudelaire und Rimbaud fallen lassen, ich spreche nur deutsche Balladen morgen; darunter auch viel Interessantes; vielleicht kommen Sie hin.“266
Albert Ehrenstein kündigt Zech seinen Besuch an, bittet ihn aber um Diskretion: „weil ich nicht gleich bei meiner zwischen 20. und 25. [Oktober] erfolgenden Ankunft das ganze Café des Westens im Genick sitzen haben möchte“. Er freut sich, „dass das ‚neue Pathos‘ floriert“, und fährt fort: „Was Ihre Feinde anlangt, so kenne ich diesen Zustand aus Erfahrung, ich machte ihn durch, weil ich als einziger Außenseiter Zutritt zum ‚Berliner Tageblatt‘ hatte.“ Zudem warnt Ehrenstein den Kollegen vor einem Fehler, den der schon mehrmals begangen hat: „Seien Sie vorsichtig mit Ihren kritischen Äußerungen über Resi Langer-Meyer, denn eine Konfrontation Ihrer vorjährigen und heurigen Berliner Tageblatt-Berichte würde keine Übereinstimmung ergeben.“ Damit weist er mahnend darauf hin, wie widersprüchlich Zechs Behauptungen oft sind und schlägt ein Treffen vor: „über all diese unerquicklichen Themen, wenn es denn sein muss, näheres mündlich.“267
In der „Aktion“ moniert Pfemfert: „Paul Zech hat sich nicht gemeldet“.268 Diesem bleibt nichts weiter übrig, als stillzuhalten, zumal keiner seiner Kollegen ihm öffentlich Beistand leistet.
Bachmair retourniert kommentarlos jene zwei Gedichte, die Zech zurückverlangt hat. Der Empfänger hakt in München nach: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Anfrage vom letzten Schreiben bald beantworten würden.“ Er gibt die Hoffnung nicht auf, der Verleger werde den Text über Lasker-Schüler in Buchform veröffentlichen und listet auf, was er seinerseits für ihn tut: „Ihre beiden Gedichte kommen in Heft zwei des zweiten Jahrgangs des neuen Pathos zum Abdruck und zwar in guter Gesellschaft: Dehmel, Rilke, Verhaeren, Kandinski [!], Liebermann.“269 In Bachmairs „Neuer Kunst“ finden sich schließlich Zechs Essay über Blass und die Deubel-Übertragungen, doch im „Neuen Pathos“ erscheint kein Beitrag des Münchner Kollegen.
Der „Simplicissimus“ leistet sich auf Kosten Paul Zechs einen Spaß. Er veröffentlicht von ihm ein Gedicht, „Herbstlicher Park“, das so beginnt: „Des Stadtparks brache Blumenbeete gähnen / weit in das blasse Abendrot hinaus.“270 Die Verse sind unter einer Karikatur mit dem Titel „Verlorene Liebesmüh“ platziert. Zu sehen ist eine sommerlich gekleidete junge Dame, die in einer Grünanlage auf einer Bank sitzt und vergeblich nach ihrem Verehrer Ausschau hält: „Mein Gott, nun kommt er nicht – und ich hatte ein paar so nette Zitate über den Herbst auswendig gelernt!“
Der dritten Jahreszeit widmet Zech ein weiteres Gedicht. Auf dem Balkon seiner Wohnung in der Babelsberger Straße sitzend, sinniert er: „Dass mir Eingezwängtem, hier in dieser steinernen Kaserne […] / noch ein Blick gespart ist in oktoberfalbe Ferne / weiß ich kaum zu halten / kaum zu überdenken.“ Sein Blick streift über die Kleingärten von Wilmersdorf hinüber nach Schöneberg: „Wie ein Haus wird auf kaum abgetragenen Gartenfetzen / und ein Turm auf einem neuen Rathausbau: wird mir klar herzugetönt.“ In solchen Ruhephasen kann er für kurze Zeit die Ereignisse der Gegenwart verdrängen: „O, so seltsam sanft umfriedet mich der Horizont / dieser herbstlich eingewiegten Häuser, Front an Front, / dass ich taub bin allen Schrein von Streik und Kriegsgerüchten.“271 Doch den Alltag kann er nicht wegträumen.
Pfemferts Rache
In der „Aktion“ greift Pfemfert Zech erneut an: „Sie kritisieren also unbekümmert weiter? Werden vielleicht bald wieder Dr. Paul Robert etablieren? O nein, so haben wir nicht gewettet. Das würde ich als Zech-Prellerei empfinden.“ Irrtümlich glaubt er, der Gegner verklage „Munkepunke“ tatsächlich: „Mein Vorsatz, das Ergebnis Ihres Prozesses gegen den Verleger A. R. Meyer sprechen zu lassen, ist nun undurchführbar geworden.“272
Trotz solcher Attacken halten andere Verleger weiter zu Zech. Walden veröffentlicht seine Gedichte „Zwei Wupperstädte“. Sofern die Einwohner von Elberfeld und Barmen den „Sturm“ überhaupt lesen, dürften sie wenig Gefallen an folgenden Zeilen finden: „Die hier gezwungen den Tag vertun, / röhren den Blutschrei entflammter Brünste / und träumen von Lesbos und Averlun.“ Mit weiteren Versen beleidigt der Verfasser indirekt Helene: „Mancher hat hier sein Herz verludert, verloren; / Kinder gezeugt mit schwachen Fraun …“273 Lasker-Schüler sieht das nicht so und lobt den Verfasser für seine Lyrik: „herrlich geschrieben“.274
Im Novemberheft der „Weißen Blätter“ veröffentlicht Schwabach „Die Abendstunden“ von Verhaeren in Zechs Übertragung275 und Wilhelm Schäfer erklärt sich bereit, Gedichte von ihm in seine Monatsschrift „Die Rheinlande“ aufzunehmen.276 Die in Paris erscheinende „Revue Germanique“ lobt: „Dans ‚Das schwarze Revier‘ […] Paul Zech se révèle artiste de premier ordre […] quelle science dans le choix des mots et des rimes, quelle force d’expression, quelle intensité d’évocation, quelle monumentale grandeur dans ces vers“.277 („In ‚Das schwarze Revier‘ erweist sich Paul Zech als Künstler ersten Ranges […] welches Wissen um die Wahl der Worte und der Reime, welche Ausdruckskraft, welch intensives Heraufbeschwören von Bildern, welch eindrucksvolle Größe in diesen Versen“.)
Anfang November liefert das Ehepaar Tieffenbach den Privatdruck „Der blassen Blonden in der Ferne“ in einer Auflage von sechzig Exemplaren aus. Es handelt sich um Zechs Liebeserklärung an Emmy Schattke vom Sommer 1912. Die Verse sind zuvor in den „Weißen Blättern“ erschienen.278 Für das Buch hat der Autor auf einen Titel zurückgegriffen, der ihm vor einem Jahr bei der Niederschrift des Textes durch den Kopf gegangen ist: „Die Sonette aus dem Exil“.279
Pfemfert hakt in der „Aktion“ nach: „Herr Paul Zech??? Sie stecken wie der Strauß den Kopf in den Sand. Aber man erkennt den Dr. Paul Robert am Steiß.“280 Der Angegriffene reagiert weiterhin überhaupt nicht und hofft, die Angelegenheit werde in Vergessenheit geraten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Einige Kollegen halten trotzdem weiter zu ihm, wie etwa Max Herrmann, als er im November als Gast bei Meyer logiert. Er besucht den viel Gescholtenen, ungeachtet der Streitigkeiten zwischen diesem und dem Verleger. Seiner Lebensgefährtin Leni Gebek schreibt er: „ich aß mit Meyer senior und junior zu Mittag (Kotelett mit Gemüse). Dann war ich bei Zech.“281
Dehmel erreichen zum 50. Geburtstag von seinem Berliner Kollegen folgende Zeilen: „es wird mir schwer, nun alles, was sich in Deutschland zur Literatur zählt, zu Ihnen kommt in Liebe, Verehrung und Dank, ein paar glückwünschende Worte zu Ihrem Fünfzigsten zu finden“. Der Gratulant fährt fort: „Was ich Ihnen äußerlich sichtbar bieten kann, ist ein in den letzten Tagen vollendetes Gedicht.“282 Es trägt den Titel „Vorposten“. Diese Verse hat er nicht eigens für Dehmel zu Papier gebracht. Sie sind vor Wochen erstmals im „Saturn“ erschienen.283
Über Zechs Nachdichtung von Verhaerens „Abendstunden“ schreibt Zweig an deren Verfasser: „Ich […] lese mit freudigem Erstaunen von Ihnen die wundervollen Gedichte in den ‚Weißen Blättern‘. Ich kann mich eigentlich nicht fassen, einen wie ungeheuren Weg Sie in diesen zwei Jahren gemacht haben.“ Beeindruckt vom Können des Kollegen will er ihm einen weiteren Auftrag verschaffen: „Ich habe eben dem Insel-Verlag geschrieben, der das neue Buch Verhaerens [‚Les Blés mouvants‘] übertragen haben möchte, Sie an erster und einziger Stelle vorgeschlagen und hoffe da bald, Ihnen Erfreuliches melden zu können.“284
Zu den Schriftstellern, die beim „Neuen Pathos“ mitmachen wollen, gehört auch der in Elberfeld geborene Armin T. Wegner. Bei einem Treffen mit Zech im Oktober hat er sein Ziel erreicht, denn er schreibt ihm: „Ich bin stolz auf die Annahme im Pathos, sehr stolz. Ich komme mal wieder – nach meinem Abend“.285 Damit meint er eine Lesung aus eigenen Werken am 28. November bei „Reuß & Pollack“, über die später im „Berliner Tageblatt“ steht: „In dem engen Raum saßen eng gedrängt ein paar hundert Menschen und hörten mit einigermaßen erstaunten Mienen die kraftvollen Verse des jungen Dichters.“286 Zur selben Zeit veranstaltet Meyer im „Papierhaus“ einen Autorenabend, bei dem unter anderen Ernst Wilhelm Lotz, Anselm Ruest und Max Herrmann auftreten. Dieser lässt in einem Brief an Leni Gebek kein gutes Haar am Vortrag seiner Kollegen.287
Im Advent kommt eine neue Nummer des „Literarischen Echos“ heraus. Sie enthält zwei Gedichte aus dem „Schwarzen Revier“.288 In der gleichen Ausgabe stänkert Lissauer: „Die lyrische Gestaltung Zechs ist […] oft durchsetzt von einem lediglich beschreibenden Element. Zech sieht viele Bilder, aber seine Vergleiche entbehren oft aller assoziativen Werte“. Der Kritiker empfiehlt dem Kollegen, ein Sachbuch zu schreiben: „Ich glaube, dass eine umfängliche Darstellung des rheinisch-westfälischen Kohlebeckens von Zech eine bedeutende Arbeit würde und vielleicht gelänge ihm auch ein Roman aus dieser Umwelt.“289
Léon Deubels Leben und Schaffen sind derzeit ein bevorzugtes Thema bei französischen und deutschen Intellektuellen. In Bachmairs Zeitschrift „Die Neue Kunst“ stehen im Dezember unter dem Titel „Leidenschaft“ fünf Gedichte des Franzosen. Angeblich hat Zech sie ins Deutsche übertragen.290 Das trifft nicht zu, denn die Verse haben keine französischen Vorlagen.291 Im gleichen Heft findet sich von ihm auch eine Würdigung des Blass‘schen Lyrikbandes „Die Straßen komme ich entlang geweht“.
Auf Einladung der „Literarischen Abteilung der Berliner freien Studentenschaft“ trägt Zech im Kreuzberger „Papierhaus“ aus eigenen Werken vor. Rudolf Börsch hat er persönlich einbestellt: „kommen Sie bitte zu diesem Vortrag, damit Sie einen anderen Begriff von mir bekommen.“292 Die Veranstaltung wird ein Misserfolg. In der „Vossischen“ steht: „Zech, der selbst vorlas, war stimmlich nicht besonders disponiert. Auch ist sein Vortrag nicht nuancenreich, so dass der halbstündige Vortrag des ersten Teils, anscheinend das erste Kapitel eines Entwicklungsromans, unter Längen litt.“ Zum Inhalt des Romans teilt der Kritiker mit: „Er behandelt die seelischen Erlebnisse eines jungen Studenten in der kleinen Universitätsstadt und enthält viele feine und treffende Bemerkungen.“
Zech beginnt demnach schon vor dem Ersten Weltkrieg mit der Niederschrift eines Werkes, das er als eines seiner wichtigsten betrachtet, „Peregrins Heimkehr“. Der zweite Teil der Lesung ist Versen aus „Die eiserne Brücke“ vorbehalten, doch auch sie kommen nicht an: „Nach der schönen und abgeklärten Prosa des Romanfragments wirkte die allzu große Bilderfülle der Gedichte oft erdrückend, namentlich bei der Gleichmäßigkeit des fast sachlichen Vortrags.“293 Über die Veranstaltung berichtet nur die „Vossische Zeitung“. Die anderen Blätter der Hauptstadt verschweigen sie.
Der Misserfolg des Abends ist auf Zechs labile psychische Verfassung zurückzuführen. Er trägt schlecht vor, weil er sich nicht konzentrieren kann. Im Anschluss an die Lesung hat er auch keine Lust auf Gespräche mit den Studenten, sondern bittet Börsch, ihn am übernächsten Tag zu besuchen. Deprimiert fährt er nach Hause. Die Gedanken an den Konflikt mit Pfemfert lassen ihn nicht los. Vergebens hofft er, der Skandal sei mittlerweile vergessen. Dem ist nicht so, was auch aus einem Brief Zweigs an ihn hervorgeht: „Ich […] sehe aber mit Bedauern, dass Sie Ihr Vortragsreferat im Berliner Tageblatt niedergelegt haben, doch hoffentlich kommen alle diese Dinge bald wieder in Ordnung.“ Während eines Deutschlandbesuchs will sich der Schreiber bei dieser Zeitung für seinen Freund einsetzen: „Wenn ich mit [Fritz] Engel spreche, werde ich selbstverständlich alles tun, um für Sie zu sprechen.“294 Seine Mitarbeit hat Zech nicht freiwillig beendet, vielmehr ist ihm seitens der Redaktion wegen der Eigenrezensionen gekündigt worden, was ihn mit Frau und Kindern in noch größere finanzielle Bedrängnis bringt. Erstmals bittet er die „Deutsche Schillerstiftung“ in Weimar um Unterstützung und erhält 100 Mark.295
Den Abend des 10. Dezember verbringt Zech im Restaurant des „Architektenhauses“ in Gesellschaft von Loerke. Ihn hat er um einen Beitrag für seine Zeitschrift gebeten, bisher aber nur die hinhaltende Antwort zu lesen bekommen „Bitte rechnen Sie nicht auf die Novelle für ‚Das Neue Pathos‘. Ich kann in deren Dingen leider nicht mehr als den guten Willen versprechen – und schreibe Lyrik.“296 Im persönlichen Gespräch lässt sich der Kollege umstimmen. Zech erhält das Gedicht „Inbrunst“ und die Novelle „Der Sandberg“. Tieffenbach schafft es, die Texte ins Dezemberheft aufzunehmen, dessen erste Exemplare 72 Stunden später fertig vorliegen.
Kaum ist das eine Problem gelöst, taucht das nächste auf. Schickele schreibt: „da passiert noch etwas unangenehmes […]. Unverständlicher Weise besteht mein Verleger der Weißen Bücher darauf, meinen Gedichtband noch vor Weihnachten herauszubringen. Ich hoffe, dass Sie die [Ihnen vorliegenden] Gedichte noch nicht in Satz gegeben haben und kein Schaden entsteht.“297 Zech kann diese Besorgnis verstehen, denn er befindet sich in ähnlicher Lage. Beide Autoren stehen beim „Verlag der Weißen Bücher“ unter Vertrag. Dessen Leiter dringt darauf, „Die Leibwache“ von Schickele sowie „Die eiserne Brücke“ von Zech, jeweils vordatiert auf 1914, noch ins vorweihnachtliche Buchgeschäft zu bringen. Damit sind die Beiträge des Kollegen keine Erstveröffentlichungen mehr und entfallen im „Neuen Pathos.“ Nicht anders als Schwabach verfährt Wolff mit dem „Kinobuch“ von Pinthus, das auch im Dezember erscheint. Die Zeichnung auf dem Titel stammt von Ludwig Kainer.298
Als sich der Schriftsteller Max Dauthendey für kurze Zeit in Berlin aufhält, möchte er mit Zech sprechen und schlägt ihm dafür genau den Nachmittag vor, an dem dieser schon mit Börsch verabredet ist. Der junge Mann wird wieder kurzfristig versetzt und erhält ein Briefchen: „verzeihen Sie bitte, dass ich Sie nutzlos bemüht habe. […] Kommen Sie doch bitte am Montag um drei Uhr zu mir. Und wenn Sie können, schreiben Sie bitte ein Referat über meinen mißlungenen Studentenabend.“299
Im letzten Heft vom ersten Jahrgang des „Neuen Pathos“ sind Zech, Robert R. Schmidt, Ehrenbaum-Degele, Loerke, Lissauer, Blass, Albert Ehrenstein, Pinthus, Engelke, Meurer, Zweig, Hasenclever und Holz vertreten. Für die grafische Gestaltung hat der Herausgeber erneut Steinhardt, Heckel, Rösler und Bötticher gewonnen. Von Letzterem existiert ein Brief an die Redaktion, in dem es heißt: „ich bin ganz aus dem Häuschen vor Freude über das ‚neue Pathos‘. Mal endlich eine Zeitschrift, die man sich freut in den Bücherschrank zu stellen, die nicht zunächst erzählt, dass der Herr Herausgeber kein Geld hat.“300
Kurz vor Weihnachten kommt Börschs Besuch bei Zech endlich zustande. Beide besprechen einen Artikel, der in Meurers „Neuer Theaterzeitschrift“ erscheinen soll: „Die drei Lyrikbücher aus dem Verlag der Weißen Bücher“. Das sind: „Die eiserne Brücke“ von Zech, „Der Aufbruch“ von Ernst Stadler und „Die Leibwache“ von René Schickele.301
Stefan Zweig hat seinen nächsten Besuch in Berlin angekündigt und ein Gedicht übersandt, das, wie er mitteilt, „allerdings noch an anderer Stelle erscheinen wird, aber an einer solchen freilich, die in Deutschland nicht gelesen wird“.302 Damit ist Zech nicht einverstanden. Er will im „Neuen Pathos“ keinen Beitrag veröffentlichen, der zu gleicher Zeit irgendwo anders erscheint, antwortet jedoch: „das Gedicht soll im zweiten Heft des neuen Jahres kommen. […] Mit gleicher Post lasse ich Ihnen ein paar Prospekte zukommen. Vielleicht können Sie jemand ausfindig machen, der subskribiert.“303
Zech wendet sich an Alfred Vallette, den Leiter des Verlags „Mercure de France“ und behauptet, er allein habe das Recht, die Werke Léon Deubels ins Deutsche zu übertragen.304 Ohne eine Antwort aus Paris abzuwarten, macht er sich daran, weitere Texte des Franzosen nachzudichten, die für das „Neue Pathos“ bestimmt sind. Der Empfänger schickt den Brief an Louis Pergaud, einen Schriftsteller, der Deubels Gedichtband „Régner“ auf eigene Kosten in Vallettes Verlag herausgebracht hat.
Während der Weihnachtsfeiertage verbringt Zech Zeit mit Frau und Kindern, wie er es in einem Gedicht formuliert: „Stunden, die sich lieben lassen, / Stunden, die verhaltne Wut und helles Hassen / abtun unter dem entflammten Tannenreis.“305 Zum Jahreswechsel schickt er Dehmel gute Wünsche.306 Schon im Advent hat er ihm geschrieben: „das neue Pathos rüstet sich für den zweiten Jahrgang. […] Ich möchte nun den Jahrgang ohne einen Beitrag von Ihnen nicht eröffnen. Würden Sie die Güte haben und mir etwas zu Verfügung stellen? Sie werden in guter Gesellschaft sein.“307
An Silvester meldet sich der Schriftsteller Kasimir Edschmid, dessen Texte, die er im November für „Das Neue Pathos“ eingesandt hat, im jüngsten Heft der Zeitschrift nicht berücksichtigt worden sind. Deswegen bringt er sich in Erinnerung, aber auch das nützt nichts. In den folgenden Nummern fehlen sie ebenfalls. Auch der Kollege Alfred Wolfenstein hat schon einen Beitrag für das nächste Heft eingereicht und angemerkt: „Sehr dankbar wäre ich, wenn der Bescheid freundlichst nicht allzu spät gegeben werden könnte.“308 Seinem Text ergeht es nicht anders als denen von Edschmid. Wolfenstein bleibt ungedruckt, obwohl der Verfasser nachhakt: „wenn Sie es ermöglichen würden, meinen Essai – für dessen Annahme ich bestens danke – in Ihrem Ersten Heft zu bringen, so wäre mir dies besonders lieb“.309
Benn will nicht mehr
Der „Verlag der Weißen Bücher“ schaltet in der „Aktion“ fünf bezahlte Anzeigen für „Die eiserne Brücke“. Das hält Herausgeber Pfemfert nicht davon ab, weiter gegen deren Autor vorzugehen. Der Konflikt hat auch mittelbare Auswirkungen. Da das „Berliner Tageblatt“ weiterhin keine Beiträge von Zech annimmt, fehlt diesem Geld. Die hundert Mark der Deutschen Schillerstiftung sind über die Feiertage aufgebraucht worden. Erneut schreibt er nach Weimar: „Ich bitte nun um die Gewährung einer erweiternden Unterstützung, da ich mich aus meiner schweren Lage nur mit einer Summe von 3 bis 400 Mark befreien kann.“310 Der Bittsteller wird aufgefordert, seine Verhältnisse zu schildern und die bisher von ihm veröffentlichten Schriften beizufügen: „Wenn dies bald geschieht, kann Ihre Angelegenheit noch dem in etwa acht Tagen an unseren Verwaltungsrat von hier abgehenden Aktenumlauf beigegeben werden.“311
Zech gibt das Gesuch umgehend zur Post: „Es sei mir gestattet, vorerst über mein persönliches sowie künstlerisches Vorleben ein paar knappe Angaben zu machen.“ In diesem „Lebenslauf“ wechseln sich Wahrheit und Erfindung ab. Zur Tätigkeit des Vaters schreibt er wahrheitsgemäß: „Geboren bin ich […] als ältester Sohn des Seilermeisters Adolf Zech“, doch bei seinen beruflichen Anfängen macht er aus dem Hilfsarbeiter im Bergbau einen „bergbautechnischen Beamten“, der „in Deutschland, Belgien und England“ tätig gewesen sei. Die Mitarbeit an Zeitungen im Wuppertal stilisiert er zu einer „zweijährigen Tätigkeit als Redakteur“ bei der Barmer „Allgemeinen Zeitung“ und seine Anstellung als Theater-und Buchreferent beim „General-Anzeiger“ will er wegen künstlerischer Meinungsverschiedenheiten mit der Verlagsleitung aufgegeben haben.
Eigenen Angaben zufolge verdient Zech zur Zeit 50 bis 80 Mark im Monat, hat mehrere Darlehen aufgenommen und infolgedessen 1800 Mark Schulden. Weiter erklärt er: „An der Einnahme aus den Büchern bin ich prozentual beteiligt, jedoch ist der Verkauf der Schriften trotz außerordentlich günstiger Rezensionen, ein sehr geringer.“ Dann heißt es: „Eine bösartige Krankheit, die mir zehn Wochen hindurch jede geistige Arbeit unmöglich machte, brachte mich noch tiefer in Not, so dass ich mit der Wohnungsmiete und der Verzinsung im Rückstand blieb.“ Als Referenzen für sein Schaffen gibt er Zweig und Dehmel an, ferner den Germanisten Richard Moritz Meyer, Paul Friedrich, den er vom Verlag „Neues Leben“ kennt, und Paul Block vom „Berliner Tageblatt“, obwohl von diesem derzeit keine positive Rückäußerung zu erwarten ist.312
Zum jüngsten Heft des „Neuen Pathos“ erreichen den Herausgeber mehrere Zuschriften. Wie Hohn müssen ihm Oskar Loerkes Sätze klingen: „Konnten Sie von Blass nichts Besseres erlangen? Auch Lissauers Gedicht ist mir eigentlich keins: spielerisch und nicht zwingend in der Idee und trocken und unpraktisch in der Ausführung. Was sagen Sie?“313 Beide Fragen kann der Herausgeber nicht beantworten, ohne in Erklärungsnot zu geraten. Da er Gerrit Engelke Belegexemplare vorenthalten hat, fragt dieser: „Ist das neue Pathos-Heft schon erschienen?“314 Zweigs Reaktion auf die Nummer fällt kühler aus als sonst: „Vielen Dank auch für das Neue Pathos, das wie immer sehr stattlich aussieht und von dem ich bisher nur die Bilder betrachtet habe.“315 Möglicherweise reagiert der Freund deshalb so kühl, weil sein Name lediglich als Übersetzer des Gedichts „Die Briefe“ von Jules Romains in der Ausgabe steht und nicht unter einem Text, der ausschließlich von ihm selbst stammt.
Zweig ist einer der Wenigen, dem Zech ein Exemplar seiner neuen Lyrikanthologie „Die eiserne Brücke“ schenkt. Freunde und Bekannte hat er wissen lassen, der „Verlag der Weißen Bücher“ werde ihnen das Werk zusenden. Das zieht sich jedoch hin oder erfolgt überhaupt nicht. Loerke beanstandet: „Ihr Buch habe ich vom Verlag nicht bekommen, sonst hätte ich Ihnen schon geschrieben. […] In Schaufenstern habe ich es noch nicht gesehen.“ Der Kollege schlägt vor, Zech solle ihm den Band persönlich in der Joachim-Friedrich-Straße vorbeibringen, wo er zu Hause ist: „Falls Sie aber ganz in meiner Nähe zu tun hätten, seien Sie doch so liebenswürdig an meiner Tür zu klingeln und zu entschuldigen, falls ich wirklich nicht da wäre. Ich sehe Sie so selten, dass ich nicht mutwillig eine Gelegenheit miteinander zu sprechen versäumen möchte.“316
Erich Heckel wohnt etwas weiter entfernt von Zech als Loerke. Sein Atelier befindet sich in der Steglitzer Markelstraße. Trotzdem werden redaktionelle Angelegenheiten des „Neuen Pathos“ mit ihm auch im persönlichen Gespräch geregelt. Der Künstler schickt eine Notiz: „es war natürlich schad, dass wir uns nicht trafen. Ich habe Herrn Schmidt-Rottluff gebeten, Sonnabend zu Herrn Tieffenbach zu gehen. Ich selbst kann leider nicht. Hoffe aber in acht Tagen da zu sein.“317
In zwei Zeitschriften stellt Zech das lyrische Schaffen von Kollegen vor. „Über Franz Werfel“ steht im „März“, der Kollege sei „durchaus reiner Tor. Ein Parsifal des letzten großen Mitgefühls. […] Anstoß und Grundstein einer neuen Lyrik, die endlich einmal wieder Tempel und Wallfahrtsort der Mühseligen sein kann“.318 Das „Deutsche Literaturblatt“ veröffentlicht eine Besprechung Hasencleverscher Texte, die unter dem Titel „Der Jüngling. Das unendliche Gespräch“ bei Kurt Wolff erschienen sind. Diese Rezension ist wieder ein expressionistisches Wortkunstwerk: „Hetärentum in Lustschatullen stürzt zurück in schrankenloser Hingabe, und Leib paart sich zu Leib, vom ausschließlichen Medium der Sinne beflügelt.“319
Hasenclever kündigt Zech an, sich für diesen Artikel zu revanchieren: „Heute kommt Ihre ‚Eiserne Brücke‘ und ich werde sie gleich für die ‚Leipziger Neuesten Nachrichten‘ besprechen. Ich bin wieder im Lande und fahre am 1. Februar nach Leipzig.“ Wie er weiter wissen lässt, ermöglicht ihm Hiller einen Auftritt in Berlin: „Am 26. Februar lese ich im ‚Gnu‘ als Einziger an diesem Abend mein Stück. Und ich lade Sie herzlich dazu ein.“320
Eineinhalb Jahre nach dem Wechsel in die deutsche Hauptstadt hat sich Zech einen Platz im literarischen Leben Berlins erkämpft. Aus dem Villenviertel Grunewald erreicht ihn eine Karte: „Sehr geehrter Herr Zech! Wir bitten Sie morgen Sonntag halb drei Uhr zu uns zu Tisch zu kommen und hoffen auf freundliches Wetter. Herzlichen Gruß Hans Ehrenbaum.“321 Im Haus seiner Eltern, Douglasstraße 22, macht ihn der Gastgeber mit seinem Lebensgefährten bekannt. Er heißt Friedrich Wilhelm Murnau. Zech will sich für die Einladung revanchieren und schreibt an Zweig: „Mein Freund Ehrenbaum ist gern bereit an der Verlaine-Ausgabe mitzuarbeiten. Falls Sie ihm also etwa anvertrauen würden, wären Sie einer guten Aufnahme sicher.“322
Aus Leipzig hat Zech die Nachricht erhalten, der „Insel Verlag“ werde ihn mit der deutschen Übertragung der „Blés mouvants“ von Verhaeren betrauen.323 Das von Zweig genannte Honorar ist um hundert Mark gekürzt worden, trotzdem schreibt er nach Wien: „ich gehe mit besonderer Freude an diese ehrenvolle Arbeit und Sie können sich denken, dass ich Ihnen, dem ich das zu verdanken habe, keine Schande machen werde.“ Das Geld benötigt er dringend, denn das „Berliner Tageblatt“ nimmt, wie er weiter mitteilt, noch immer keine Beiträge von ihm an: „Engel schrieb mir ziemlich schroff, dass er meinen Aufsatz noch nicht bringen kann. Überhaupt muss ich mich über das B. T. sehr beklagen.“324 Auf den Gedanken, den Boykott selbst verursacht zu haben, kommt er nicht.
Zechs Vorschlag, Ehrenbaum-Degele in die Übersetzer-Tätigkeit einzubinden, weicht Zweig aus: „Ihren Freund Ehrenbaum werde ich ganz bestimmt um Beiträge bitten, ich kann es nur jetzt nicht tun, weil ich an einem Tage an alle zugleich herantreten will, um niemand zu verstimmen. Es wird eine schöne Sache werden, das spür ich im Handgelenk.“ Die vom Verleger genannte Vergütung für die Verhaeren-Übertragung hält er für angemessen: „und dann ist eben ein Buch beim Insel-Verlag eine Sache, die nicht nach einem Jahr in die literarische Senkgrube hinabgeht. Ich freue mich sehr darauf und wünsche Ihnen frohes Schaffen.“325
Emmy Schattke hat die „Der blassen Blonden in der Ferne“ gewidmeten Verse in den „Weißen Blättern“ gelesen und sofort erkannt, wer damit gemeint ist.326 Auf eine entsprechende Nachricht von ihr jubelt Zech: „Seele und Temperament stehen in lichterlohen Flammen. Heissa! Was sind da Kopfschmerzen?! Was Kilometer?! Und ich höre Sie wiederum murren: Bist Du schon fertig? Hast Du Dein Leben schon gelebt? Bist Du schon satt?“ Zum Geburtstag erhält die Freundin ein Exemplar der „Sonette aus dem Exil“ als Geschenk: „Das kleine Buch, das ich Ihnen anbei sende (Sie kennen Teile daraus) ist doch nur der symbolisierte große Krampf, der mir geblieben ist, seit ich Ihre Hand küssen durfte. Nichts anderes.“ Er berichtet: „Dieser Brief ist ein wenig gehetzt, liebe Blonde. Ich bin aber ruhig und grüße Sie mit der ganzen Ruhe meiner Seele.“ Das entspricht nicht den Tatsachen, denn den Schreiber beunruhigt der Gedanke, Schattkes Antwort auf seine Liebeserklärung könne der Gattin in die Hände fallen. Deshalb weist er darauf hin: „Correspondenzen sind zu senden an: „Paul Zech, Redaktion der Zeitschrift ‚Das neue Pathos‘ Berlin-Steglitz, Martinstraße 9/10“. Das ist die Adresse der Tieffenbachs. Neben diese Order klebt er eine Stiefmütterchenblüte aus der Trockenpresse.327
Hasenclever möchte sich mit Zech treffen und schlägt dafür ein Lokal am Kurfürstendamm vor. Der Termin platzt, denn der Eingeladene erscheint nicht. Die Reaktion des Versetzten ist moderat: „Im Café Prinzeß habe ich heute (nach Verabredung) von fünf Uhr bis Viertel vor sechs auf Sie gewartet; doch traf ich Sie nicht an. Schade. Ich fahre gleich (halb sieben) wieder nach Leipzig, sehr krank und müde. Auf Wiedersehn bald wieder in Berlin (hoffentlich)“.328 Zech bleibt auch der Lesung des Kollegen im „Gnu“ fern. Wieder sucht ihn Hasenclever vergeblich und schreibt ihm dann: „Bis heute habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Ich möchte nur noch einmal sagen, dass ich an dem verpassten Rendez-Vous unschuldig bin, denn ich war da.“329 Eine Antwort bleibt ihm Zech schuldig. Er reagiert auch nicht, als Lasker-Schüler ihm mitteilt: „ich sprech in Frankfurt Main 24. März. Wollen Sie Frankfurter Zeitung etwas über mich senden. […] Geht mir schlecht in jeder Beziehung.“330
Anfang März besucht Zech Zweigs Vortrag über Dostojewski an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Möglicherweise stellt er dem Auditorium den Referenten vor, denn dieser wendet sich später mit den Worten an ihn: „Es muss mein Erstes sein, jetzt, da ich nach Wien komme, Ihnen auf das Innigste zu danken für die herzlichen heißen Worte, die Sie mir gewidmet haben.“ Der Kollege fährt fort: „Wir sind auch diesmal viel zu wenig beisammen gewesen“. Für Zech möchte er in Wien einen Leseabend arrangieren: „dann sind wir besser beisammen als im Berliner Getümmel und wie an jenem Abend, wo ich für die hübschen Lippen der Moissi Schülerinnen alle Freunde vergaß.“331 Das „Berliner Tageblatt“ urteilt über Zweigs Vortrag, der Veranstalter dürfe ihn „zu den besuchtesten des Semesters zählen.“332 Ähnlich äußern sich auch die Berichterstatter anderer Blätter, während der Referent in der „Aktion“ als „Literatör“ verunglimpft wird.333
Loerke hat doch noch ein Exemplar der „Eisernen Brücke“ bekommen, enthält sich aber im Dankesbrief an den Autor jeglicher Wertung: „Ich habe dieses mit großem Eindruck gelesen und […] von Anfang bis zu Ende fleissig Ihren Willen und Ihre Kunst studiert. Es liegt noch auf dem Schreibtisch.“334 Der Elberfelder Kollege Rudolf Hartig ist dagegen immer noch nicht im Besitz des Buches, trotz einer entsprechenden Bitte per Post. Verleger Ernst Meister hat auch nicht reagiert. Zech lässt Hartig wissen: „Meister kenn ich aus meiner seligen Heidelberger Zeit […], dass er Ihnen nicht geantwortet hat, wird daran liegen, dass er seit langem krank ist und mit Arbeit überbürdet.“ Hier erzählt Zech erstmals das Märchen von seinem Studium in Heidelberg, das er in Bonn und anderswo fortgesetzt haben will. „Die eiserne Brücke“ bekommt der Adressat nicht geschenkt und erhält stattdessen den Hinweis: „Anbei empfangen Sie einen Prospekt der Zeitschrift, die ich herausgebe. Ich kann Ihnen eine Subskription empfehlen, da der erste Jahrgang völlig vergriffen ist und heute schon in den Antiquariaten 50 bis 60 Mark kostet.“335
Zech hat auf seine Bitte an Benn, ihm einen weiteren Beitrag für das „Neue Pathos“ zu schicken, keine Antwort erhalten und deshalb in einem folgenden Schreiben die Vermutung geäußert, der Kollege sei von Meyer und seinem Kreis „beschwatzt“ worden, die Zusammenarbeit aufzukündigen. Er bekommt zu lesen: „Die Meyer-Gruppe hat mich nicht beschwatzt. Beschwatzen lasse ich mich nicht. Andere Gründe halten mich vom ‚Neuen Pathos‘ zurück.“336 Diese Gründe sind unter anderem im Ende seiner Beziehung zu Else Lasker-Schüler sowie in den Auseinandersetzungen des „Dr. Paul Robert“ mit A. R. Meyer und Pfemfert zu suchen. Zech muss noch einen weiteren Tiefschlag einstecken. Seine Bemühungen, Rilke als Mitarbeiter für die Zeitschrift zu gewinnen, scheitern. Er hat Anton Kippenberg vom „Insel Verlag“ gebeten, dem Dichter eine entsprechende Anfrage vorzulegen, doch die wird nicht weitergeleitet, weil der Verleger derartige Beiträge seines Starautors in Zeitschriften und Zeitungen zu verhindern sucht.337
Eine gute Nachricht trifft in der Babelsberger Straße von der Schiller-Stiftung ein. Ihr Berliner Stipendiat erhält einmalig 300 Mark als Beitrag zur Behebung seiner finanziellen Notlage.338 Trotzdem will er die Verhaeren-Übertragung so rasch wie möglich abschließen, damit Honorar fließt.
Nicht nur finanziell, auch als Herausgeber steht Zech unter Druck. Deshalb schreibt er an Zweig: „verzeihen Sie, aber als Mahner für das neue Pathos muss ich unerbittlich sein. Senden Sie mir doch bitte umgehend etwa vier bis fünf Schreibmaschinen-Seiten von Ihrem Dostojewski. […] Und dann muss ich wieder um die Gedichte bitten.“ Er kündigt an: „In acht Tagen erhalten Sie die Numero eins des zweiten Jahrgangs.“339 Der Wiener Kollege schickt zwar Auszüge aus seinem Referat, geht aber auf die Forderung nach Gedichten nicht ein und begibt sich für sechs Wochen auf eine Reise durch Frankreich und Belgien.340
Eine zweite gute Nachricht erreicht Zech aus Leipzig. Vom „Verlag der Weißen Bücher“ werden ihm Verträge für den längst erschienenen Gedichtband „Die eiserne Brücke“ sowie für eine Novellensammlung vorgelegt. Als Titel für diese Neuerscheinung trägt er handschriftlich ein: „Der schwarze Baal“. Das Buch soll in einer Auflage von tausend Stück in den Handel kommen. Der Verfasser erhält pro verkauftem Exemplar zwanzig Prozent vom Ladenpreis. Den setzt ausschließlich der Verlag fest. Ferner werden bei Vorabdrucken der Texte in Zeitungen und Zeitschriften fünfzehn Prozent des jeweiligen Honorars einbehalten. Schriftlich geregelt sind auch Übersetzungen, weitere Auflagen, eine spätere Aufhebung des Ladenpreises und die Zahl der Freiexemplare. Ein Passus ist Zech besonders wichtig: „Der Verfasser erhält àKonto dieses Honorars für jedes der beiden oben genannten Werke einen Vorschuss von 300 Mark (also im Ganzen 600 Mark)“.341
Lasker-Schüler schickt Zech ein Exemplar ihres Buches „Abigail II“ und erläutert in Elberfelder Platt: „Ek han öhmm eengepackt em Gedanke! Also secher. Größ Ding Weib on die Kingers“.342 Sie rechnet mit einem Teilabdruck oder zumindest mit einer Besprechung des Werkes im „Neuen Pathos“. Es soll dem Empfänger zugleich über eine Enttäuschung hinweghelfen. Zwei Tage zuvor hat sie ihm mitteilen müssen, die „Frankfurter Zeitung“ werde den von ihr angeforderten Beitrag des Freundes über sie nicht veröffentlichen.
Für Zech scheint sich ein Wunsch zu erfüllen, den er seit langem hegt. An Emmy Schattke schreibt er: „Am 1. April wird es sich entscheiden, ob ich vor oder nach Ostern nach Elberfeld komme. Jedenfalls aber sehen wir uns bald […]. Einstweilen reiche ich Ihnen beide Hände, diese meine weißen Wandertauben.“ Dem poetischen Gruß folgt der nüchterne Satz: „Mein Verleger sagte mir, dass das erste Heft des Neuen Pathos am Mittwoch unter Nachnahme der ersten Subskriptionsgelder im Betrage von 10 Mark 80 an Ihre Adresse abgeht. Ich habe Ihnen den Buchhändlerpreis durchdrücken können.“343
Tieffenbach liefert im April die neue Nummer der Zeitschrift aus. Sie enthält Beiträge von Werfel, Schickele, Dehmel, Loerke, Holz sowie Lautensack. Ehrenbaum-Degele hat ein Gedicht, Schmidt einen Prosatext beigetragen. Der Herausgeber ist mit einem Artikel über „Die Grundbedingung der modernen Lyrik“ sowie den Versen „Die neue Bergpredigt“ und drei Nachdichtungen vertreten. Fünf Bildbeigaben machen das Heft in späterer Zeit zu einem begehrten Objekt für Kunstsammler: Mesecks „Betrunkene“, Röslers „Im Caféhaus“, Heckels „Kopf eines Geigers“, Steinhardts „Dorfstraße“ und „Kniender Bogenschütze“ von E. R. Weiß.
Da Jakob Steinhardt den Kulturhistoriker Eduard Fuchs als Subskribenten für „Das Neue Pathos“ gewonnen hat, fordert er Zech dringend auf: „Bitte ihm Numero eins sofort zuzusenden“.344 Lasker-Schüler ist verärgert, weil ein Beitrag von ihr in der jüngsten Ausgabe fehlt und verlangt vom Herausgeber: „Bitte senden Sie mir das Honorar für Abigail II […]. Sende ihn sonst Meyer oder Blass, die bezahlen. Ich muss verdienen.“345 Als Schattke das Heft lobt, lässt ihr Freund sie wissen, wie es weitergehen soll: „Mombert und Else Lasker-Schüler werden ständig zu Gast sein, damit auch die gute Tradition weitergepflegt wird.“ „Abigail II“ veröffentlicht er dennoch nicht. Schattke erfährt weiter: „meine Reise nach dem Rheinland musste aufgeschoben werden bis Ende Mai. Ich muss dann gleich zur Werkbundausstellung. […] Momentan bin ich stark in Anspruch genommen durch die Nachdichtung des neuen Verhaeren-Buches für den Insel-Verlag.“ Er bestellt Grüße an das Ehepaar Pohl und verwendet im Absender wie gewohnt die Adresse der „Officina Serpentis“, da Helene nichts von der Fortdauer seiner Korrespondenz mit „der blassen Blonden“ erfahren soll. Den Brief beendet er mit der abgehobenen Formulierung: „Und Ihnen einstweilen herzlich beide Hände und Grüße von den besseren Sternen.“346
Das „Berliner Tageblatt“ hat den Boykott der Beiträge Zechs aufgegeben und von ihm eine Besprechung der Gedichte Christian Wagners veröffentlicht.347 Auf die Verbesserung seiner finanziellen Lage darf er auch deshalb hoffen, weil vom „Insel Verlag“ eine Einladung zur Mitarbeit an der deutschen Verlaine-Ausgabe eintrifft. Als ihn ein Exemplar der Wiener „Neuen Freien Presse“ mit Zweigs Besprechung der „Eisernen Brücke“ erreicht, dankt er dem Freund überschwänglich: „Ich bin tief gerührt über soviel Lob, das Sie meinem Buch auf den Weg gaben“. Seine Lage beschreibt er an dieser Stelle erneut bilderreich: „Sie wissen auch, dass ich, nachdem ich dem Berliner Caféhaussumpf entronnen bin, wieder dort stehe, wo reiner Atem weht und warmes Menschentum wachsen“.
Diese Aussage deckt sich nicht mit Zechs abendlichen Gepflogenheiten, während folgende Schilderung zutrifft: „die Arbeitswut hatte mich wieder gepackt und ließ keine anderen Götter aufkommen. […] Die ‚wogende Saat‘ ist bis zur Hälfte gediehen […]. Die Nachdichtung ist doch schwieriger als ich glaubte, aber gerade diese Schwierigkeiten reizen mich ungemein.“ Eine Pause hat er sich dennoch gegönnt: „Nun ist über Berlin Frühlingsbläue und Baumgrün. Ich lag die Ostertage zwischen Seen und märkischen Sandhügeln und habe drei Tage Ferien ganz allein genossen.“348 Frau und Kinder sind demnach vom Familienvater während der Feiertage sich selbst überlassen worden.
Bei der „Officina Serpentis“ erscheinen unter dem Titel „Die rot durchrasten Nächte“ acht Sonette von Léon Deubel mit dem Vermerk „Deutsche Nachdichtung von Paul Zech“. Der Handpressendruck wird in einigen wenigen Stücken auf Pergament und in hundert Exemplaren auf Zanders Handbütten ausgegeben. Acht erotische Lithographien von Waldemar Rösler schmücken das Werk. Den deutschen Übertragungen liegen größtenteils keine französischen Originale zugrunde. Weder von Alfred Vallette noch von Louis Pergaud ist eine Intervention gegen diese Ausgabe bekannt.
Pfemfert wirft Zech öffentlich vor: „Sie gehen in Berliner Redaktionen und lügen, die ‚Aktion‘ greife Sie an, weil Sie ihr keine Manuskripte gegeben haben. Dass Sie mir Gedichte aufdrängten, die noch heute (abgelehnt) in meinem Schreibtisch liegen, verschweigen Sie.“ Der Kontrahent scheut auch vor einer handfesten Beleidigung nicht zurück: „Ein seidner Charakter sind Sie.“ Zusätzlich ärgert er sich über Paul Schlenther, weil dieser Redakteur des „Berliner Tageblattes“ wieder Beiträge von Zech annimmt. Er schreibt ihm: „Gibt es in Ihrem journalistischen Denken nicht eine Ecke, die sich dagegen auflehnt, Leute als kritische Richter zu beschäftigen, die, wie Herr Zech, Sie arglistig getäuscht haben?“ Dem Journalisten ruft er in Erinnerung: „Dieser Zech hat, als Dr. Paul Robert, über sich im Berliner Tageblatt Lobgesänge gegröhlt. Sie selbst, Hofrat, waren darüber sittlich entrüstet. Trotz alledem: Wieder darf Zech unter Ihrer Verantwortung faseln.“349
In der Tat nutzt Zech die zurückgewonnene Position als freier Mitarbeiter dieser Zeitung, um sich als Literaturkritiker zu betätigen. Sein Artikel über ein „Jahrbuch für Dichtkunst“, das bei Kurt Wolff erschienen ist, zeigt, wen er schätzt und von wem er nichts hält. Den Herausgeber Max Brod lobt er für die Auswahl der Autoren, schränkt jedoch ein: „nur ist die Äußerung jedes einzelnen nicht einander gleichwertig. […] Wert und Unwert stehen schroff nebeneinander. Talent neben bloßer Begabung.“ Die Ausgabe enthält drei Dramentexte von Robert Walser, Franz Blei und Franz Werfel. Zech findet nur die Arbeit des Letzteren gut. Bei den Gedichten gefällt ihm besonders „Die Beichte“ von Heinrich Lautensack: „es dürfte in Deutschland kaum einen Lyriker geben, der das Wesen des hysterisierten Katholizismus so erfasst hat, ganz im Gegensatz zur mystischen Inbrunst Rilkes.“ Auch über die Lyrik von Max Brod und Otto Pick äußert er sich anerkennend. Zwei Gedichte von Robert Walser und Franz Blei erwähnt er ebenso wenig wie deren dramatische Beiträge.
In der Abteilung „Episches“ lobt Zech erneut Brod. Anerkennung finden Moritz Heimann und Martin Beradt. Über Kurt Tucholsky heißt es: „Er ist ein heller Kopf und hat für die Schwächen der lieben Mitbürger ein durchdringendes Auge. Dazu hat er Stilgefühl und Ironie zum Bersten.“ Weniger freundlich springt er mit Alfred Wolfenstein um: „Der Autor scheint mir noch zu sehr unter der Lehre Freuds zu stehen, denn er handhabt die Psychoanalyse fanatisch, nicht immer zum Nutzen der klaren Herausgestaltung des Problems.“ Ein Abschnitt des Artikels verdient besondere Aufmerksamkeit: „Zwei Talente aus dem jüngeren Jahrgang sind Franz Kafka und Heinrich Eduard Jacob. Beide gegeneinander auszuspielen, ist ein Unding. Größere Gegensätze in der Formulierung des Ethischen gibt es kaum.“350 Den Weltrang Kafkas erkennt der Rezensent nicht.
Dehmel lobt Zechs neuestes Buch „Die eiserne Brücke“ und schickt ihm eine Übertragung von Verhaerens Gedicht „Aufruhr“.351 Der Empfänger bedankt sich und verspricht, die Verse in das zweite Heft des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift aufzunehmen. Über seine Tätigkeit als Herausgeber teilt er nach Blankenese mit: „Ideell hat Das neue Pathos sich gehoben. Die Finanzfrage ist jedoch noch immer dunkel. Wir mussten den Malern zuliebe das Folio-Format nehmen, da nach ihrer Meinung auf kleinen Flächen keine Wirkungen möglich sind.“ Das ist der Grund, weshalb die Zeitschrift ein Jahr nach der Gründung ihr Aussehen stark verändert hat: „Unseren Versen gibt das neue Satzbild allerdings auch eine bessere Wirkungskraft. Schlechtsehende werden wohl nicht mehr klagen.“352
Betonung des Erotischen
Aus Schlesien meldet sich Armin T. Wegner bei Zech: „ich bin schon im Februar aus Berlin geflohen und war über zwei Monate in Schreiberhau. Ganz abgeschlossen und ganz in Arbeit versunken.“ Er berichtet: „Carl Hauptmann habe ich […] viel von Ihnen erzählt, und er liebt Sie nun auch. Er hat mich aufgefordert, Sie einmal nach Schreiberhau mitzubringen. Hoffentlich findet sich einmal eine Gelegenheit.“ Der Kollege kündigt seine Rückkehr nach Berlin an und fragt: „Die von Ihnen seiner Zeit für das ‚Neue Pathos‘ akzeptierten Gedichte von mir sind gewiss längst erschienen. Hoffentlich bekomme ich einmal etwas davon zu sehen.“353 Diese Beiträge erscheinen jedoch nie.
Dehmel teilt Zech mit, er sei bereit, ein weiteres Gedicht für die Zeitschrift zur Verfügung zu stellen, jedoch nur gegen Bezahlung: „Ich muss auf hohe Honorare ausgehn […]! Auf das Haus, das man mir zum Geburtstag geschenkt hat, musste ich 30.000 Mark Hypotheken aufnehmen, um meine Schulden auszugleichen. Von meinen Büchern kann ich noch heute nicht meinen Haushalt bestreiten“.354 Freunde haben ihm im vergangenen November eine Villa übereignet, damit er nicht mehr zur Miete wohnen muss.355
Lasker-Schüler klagt ebenfalls: „Ich liege krank zu Bett. Vielleicht besuchen Sie mich mal.“ Den Vorstand des Künstlerkabaretts „Gnu“ will sie bitten, im Herbst für Zech eine Lesung anzusetzen, obwohl sie sich jüngst wieder über ihn geärgert hat. Fälschlicherweise nimmt sie an, er sei der Verfasser eines Artikels, der nicht nur Lob für ihre Lyrik enthält: „Ich bitte Sie aber in den Kritiken, die Sie […] schreiben mich nur nicht zu erwähnen“.356
Zech muss zudem Pfemferts Vorwurf verkraften, er veröffentliche aus Geldgier Beiträge in niveaulosen Massenblättern, wofür der Herausgeber als Beleg in der „Aktion“ das Gedicht „Osterahnung 1914“ abdruckt, das erstmals im „Allgemeinen Wegweiser“, einer Zeitschrift des Berliner Scherl-Konzerns, erschienen ist.357 Die Verse konfrontiert er mit einem Beitrag von Albert Ehrenstein in der „Literarischen Rundschau“, wo es heißt: „Paul Zech ist […] ein vulkanischer Schmied wie der Notflieger Wieland. Man wird von Paul Zech viel erwarten. Starkes, Starkes. Er hat das Wort.“358 Pfemferts Kommentar: „Alles sehr schön und gut, nur dass sich der vulkanische Schmied beständig in den ‚Allgemeinen Wegweiser‘ verirrt. Dass er Zwischenlandungen macht, die sich nicht über das Niveau des Drecks erheben.“ Ehrenstein wird als Verfasser der Hymne ebenfalls attackiert: „Da wälzt man ostentativ Tonnen des Lobes für einen [Autor,] der heimlich die ödeste Familienblattpoesie verzapft. Hier ist einer, der sich nicht nur selbst die Steigbügel hält, sondern sich auch in allen Sätteln in der Weise gerecht zeigt, die die Peitsche verdient.“359 Das kann Zech zwar einigermaßen gelassen hinnehmen, denn im „Allgemeinen Wegweiser“ befindet er sich als Autor in guter Gesellschaft. Diese Zeitschrift hat während der letzten Jahre auch Beiträge von Kollegen wie Loerke und Silbergleit veröffentlicht. Doch die Polemik insgesamt bleibt nicht ohne Wirkung. Dem Angegriffenen macht wieder sein „Nervenleiden“ zu schaffen.
Engelke berichtet Zech von der Möglichkeit, seine lyrischen Arbeiten, die dem „Neuen Pathos“ vorliegen, bei der „Insel“ in Buchform herausbringen zu können. Der Adressat gratuliert säuerlich: „mit gleicher Post erhalten Sie das Manuscript zurück. Ich wünsche Ihnen viel Glück zum neuen Verleger“, und fügt hinzu: „Von den neuen Gedichten, die Sie dem Pathos sandten, kann ich nichts gebrauchen, ich finde sie sehr schwach, doch aus dem Manuscript will ich noch den ‚rasenden Psalm‘ und ‚Ich will hinaus aus der Stadt‘ bringen.“360 Das Versprechen löst er nicht ein. Engelkes Gedichte erscheinen ohne Verfasserangabe in der Zeitschrift „Quadriga“, die von den „Werkleuten auf Haus Nyland“, einem Künstlerbund aus dem rheinisch-westfälischen Raum, herausgegeben wird.361
Zweig möchte von seinem Berliner Kollegen wissen, welche Texte Verlaines er für die deutsche Ausgabe der Werke des Dichters zu übertragen beabsichtigt: „Bitte, schlagen Sie mir ein paar, besonders aus den späteren, Gedichte vor, deren Übersetzung Ihnen lieb wäre, damit ich sie Ihnen reservieren kann. Ich mache Ihnen dann sofort meine Gegenvorschläge und zweifle nicht, dass wir […] zu einer freundschaftlichen Einigung gelangen.“362 Ein wenig aufgeheitert wird Zech durch eine Karte von Otto Pick, der in Berlin zu Besuch ist und ein Treffen vorschlägt: „Wir sind Mittwoch im Café des Westens.“ Mit unterschrieben hat Lasker-Schüler in Wuppertaler Platt. Sie verwendet dabei den Namen einer Figur aus ihrem Schauspiel „Die Wupper“: „Ook eck! Aujust Puderbach.“363 Am gleichen Tag fragt Wolfenstein ungeduldig an: „dürfte ich Sie um Nachricht bitten, wann mein Aufsatz im Neuen Pathos erscheint?“364 Kurz darauf beklagt sich Hasenclever: „Die letzte Nummer […] erhielt ich nicht und bin darüber sehr traurig! Was wird mit meinem Gedicht und wann erscheint es? Krieg ich Korrektur?“365 Er erhält sie, während Wolfenstein vergeblich nach seinem Aufsatz in der Zeitschrift suchen wird.
Zech schickt Zweig mehrere Vorschläge, welche Stücke er übertragen will, und als Arbeitsprobe die Nachdichtung eines Gedichts von Verlaine. Der Empfänger ist begeistert: „Ich danke Ihnen vor allem für Ihre wundervolle Übersetzung von ‚Charleroi‘, die selbstverständlich erscheint.“ Über den schlechten Gesundheitszustand des Absenders ist er anscheinend informiert: „Ich würde mich herzlich freuen, könnte ich Ihnen jetzt irgendwie in der Zeit Ihrer Depression behilflich sein.“ Er ermutigt Zech, einige der Verhaeren-Übertragungen vor deren Erscheinen im Buch Zeitungen und Zeitschriften zur Veröffentlichung anzubieten. Ebenso soll er mit der Lyrik Verlaines verfahren: „Wenn es Ihnen recht ist, so schicke ich Ihnen sofort nachdem Sie die vorgeschlagenen Gedichte […] übertragen haben, einige aus den religiösen Bänden.“ Beim „Insel Verlag“ will er sich für eine rasche Auszahlung des fälligen Honorars einsetzen. Der Brief schließt: „bleiben Sie meiner sicher und empfangen Sie viele herzliche Grüße Ihres aufrichtig getreuen Stefan Zweig“.366
Für den Zuspruch des Freundes bedankt sich Zech mit den Worten: „Es gibt in den dunkelsten Stunden noch lichte Augenblicke, die tröstlich sind und anspornen.“367 Von Hasenclever und Werfel erhält er ebenfalls Beistand: „wir sind beide empört über die Hetze gegen Sie! Könnte man was für Sie tun? Auch Hiller, soviel ich weiß, steht jetzt sehr auf Ihrer Seite.“ Hasenclever erklärt: „Dass ich in Berlin nicht zu Ihnen kam, liegt darin, dass ich, bei Rowohlt logierend, die Nacht durch bis sechs Uhr früh bummelte und tot vor Müdigkeit an diesem Tage noch um sieben Uhr […] nach Leipzig zurückfuhr.“ Er beteuert: „Hätte ich aber gewusst, dass es Ihnen schlecht geht, so wäre ich sicher zu Ihnen gekommen, das, lieber Zech, hoffentlich glauben Sie mir doch!!!“ Weiter schreibt er: „Da ich auch gerade eben Werfel hier am Kragen habe, ruhe ich nicht, bis er Ihnen was für die nächste Nummer des ‚Neuen Pathos‘ schickt […]. Jedenfalls soll dadurch öffentlich dokumentiert sein, dass wir zu Ihnen stehn.“ Hasenclever wiederholt: „ich brauche nicht noch zu sagen, dass ich sehr mit Ihrer Lage fühle“, und fragt: „wollen Sie nicht fort von Berlin?“ Unter seinem Namenszug fügt Werfel hinzu: „ich fühle sehr mit Ihnen und will mich immer allen kleinen Handlangern entgegen an Ihre Seite stellen. Verfügen Sie und sagen Sie, ob ich Ihnen dienlich sein kann.“368
Zweig erläutert in zwei Briefen, wie bei den Übertragungen von Verlaines Gedichten einheitlich vorzugehen sei.369 Die tröstlichen Worte des Freundes und der Kollegen helfen Zech, diese Arbeit trotz der Auseinandersetzungen um seine Person abzuschließen. Mut macht ihm auch eine Besprechung der „Eisernen Brücke“ in der „Neuen Rundschau“, wo Robert Musil über die Lyrik des „Landschafters Paul Zech“ schreibt: „Gegenständlichkeit ist der häufigste Reiz dieser Gedichte. Sicher gewählter Bildausschnitt, die Gefühlsträger unter den Eindrücken an beherrschender Stelle.“ Der folgende Halbsatz liest sich so, als habe Benn ihn geschrieben: „manchmal wohl auch Arrangement, meist aber das Ganze mit rundlich scharfen Versskalpellen von den Seh-, Riech- und sonstigen Hautstellen glatt abgelöst und ohne Verluste oder Verschiebungen präpariert.“370
Zech denkt trotz seiner schlechten nervlichen Verfassung nicht daran, Berlin zu verlassen und rechnet fest damit, in Kürze weitere Texte veröffentlichen zu können. In eine Bibliographie seiner Werke, die der Lexikograph Ernst Brümmer von ihm erbeten hat, nimmt er die Übertragung der „Blés mouvants“ sowie den Novellenband „Der schwarze Baal“ auf, deren Erscheinen noch aussteht.371 In dieser Liste ist „Das schwarze Revier“ zutreffend auf 1913 datiert. Eine private Ausgabe von 1909 wird nicht erwähnt.372
Nachdem Zweig „Die wogende Saat“ gelesen hat, lobt er Zech ein weiteres Mal. Besonders gut gefällt ihm das Kapitel „Ländliche Gespräche“. Weiter schreibt er: „In den anderen Gedichten scheint es mir, dass Sie Verhaeren etwas kompliziert haben, seine Sprache satter und vehementer gestaltet als das Original, an dem ja (unter uns) ein gewisses Nachlassen der bildlichen Leuchtkraft unverkennbar ist.“ Was viele Kritiker als Schwäche der Zech‘schen Übertragungen betrachten, ihre weitreichende Freiheit gegenüber den jeweiligen Vorlagen, betrachtet er als deren Stärke: „Sie haben sich für mein Empfinden – so wie George – sehr stark selbst durchgesetzt durch das Original, und ich bin der letzte, der darin einen Vorwurf sieht, im Gegenteil, ich finde, dass Sie die ganze Intensität Ihrer dichterischen Art kaum je stärker bekundet haben“.373
Diese Meinung vertritt Zweig auch gegenüber Verhaeren, an den er über Zechs Arbeit schreibt: „sie dämpft nicht die Farben. sondern trägt noch mehr auf, sie koloriert mit kräftigen, manchmal schreienden Farben. Aber sie ist tausendmal mehr wert als die Rehwolds‘, Schlafs und der anderen, sie ist ein persönliches poetisches Kunstwerk.“374 Darüber hinaus ist er bestrebt, dem Freund Geld zu verschaffen, indem er ihn Kippenberg für die Übertragung von Verlaines Essay „Mes hôpitaux“ („Meine Krankenhäuser und meine Gefängnisse“) empfiehlt.
Anscheinend geht es Zech wieder besser. Er will nach Würzburg fahren. Diese Absicht hat er Hermann Meister mitgeteilt. Der lädt ihn ein: „Versäumen Sie ja nicht einen Besuch Heidelbergs, das von Würzburg nur drei Stunden entfernt ist“.375 Zwischenstation der Reise soll Leipzig sein, da dort die „Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Grafik“ stattfindet. Eines der zigtausend Exponate stammt von Zech, „Die eiserne Brücke“. Das betreffende Exemplar enthält ein Exlibris des Verfassers und den Vermerk: „Erstausgabe, aufwendig ausgestattet für die ‚Bugra‘ Leipzig 1914“.376 Zech kündigt auch Hasenclever seinen Besuch an und entschuldigt sich dafür, im Februar nicht zum verabredeten Treffen gekommen zu sein. Der Adressat antwortet: „Ich hoffe es bestimmt ermöglichen zu können, noch hier zu sein am Donnerstag: wir wohnen alle hier an einer Ecke, ganz in der Nähe vom Gewandhaus, vom Bahnhof mit der Linie A zu erreichen. […] Auf Wiedersehen“.377 Die Fürsorge ist vergeblich. Zechs Reise findet nicht statt und Hasenclever erhält keine Nachricht davon.
René Schickele hat vorgeschlagen, die einzelnen Ausgaben des „Neuen Pathos“ jeweils unter ein bestimmtes Thema zu stellen. Zech bestätigt: „Ich bin ganz Ihrer Meinung und habe mich von Anfang an bemüht, wenig, aber geschlossene Beiträge zu bringen.“ Das ist ihm nicht gelungen. Als Grund dafür nennt er: „Widerstand bei den Mitherausgebern!“ Für die dritte Ausgabe des laufenden Jahrgangs hat er nun etwas Besonderes vor: „Ich schrieb Ihnen doch, dass dieses Heft das Erotische betonen soll; das heißt nicht so, dass uns der Staatsanwalt gleich auf die Bude rückt, aber doch wild und feurig.“ Den Plan will er sich von seinen Geldgebern genehmigen lassen: „Im nächsten Monat komme ich mit den Herausgebern und meinem Gönner zusammen und werde noch einmal versuchen, mit der Flickarbeit aufzuräumen.“ Er erinnert Schickele: „Für die Nummer, zu der ich Sie einlud, ist es noch nicht zu spät.“378 Kurz darauf liegt ihm der gewünschte Text samt Begleitbrief vor: „mögen Sie diesen Beitrag drucken?“ Es handelt sich um eine „Trilogie der Eifersucht“. Der Verfasser regt an: „darüber können wir an einem der nächsten Tage reden; ich fahre morgen auf kurze Zeit nach Berlin hinüber.“379 Er schlägt vor: „wenn es Ihnen recht ist: Sonntagmittag, zwölf Uhr, Café Josty, Kaiserallee. Sollten Sie verhindert sein, so bitte ich um Verständigung“.380 Das Treffen findet statt und beide Herren einigen sich, dass der Beitrag in der nächsten Nummer des „Neuen Pathos“ erscheinen soll.
Hasenclever wartet vergeblich auf den angekündigten Besuch Zechs und hakt bei ihm nach: „Zunächst hier oben meine Adresse, die Sie, wie Sie damals schrieben, verloren hatten. Wie ists, kommen Sie bei uns mal einen Tag vorbei und wann? Oder sind Sie in Berlin? Wann kommt die neue Nummer des ‚Neuen Pathos‘ heraus? Bitte hierher senden.“381 Seine Bemühungen sind vergeblich, der Adressat antwortet nicht. Es geht ihm wieder schlechter. Darüber berichtet Max Herrmann Leni Gebek: „[ich] fuhr in die Stadt, traf zufällig Paul Zech, der klagte auch sehr über die Literaturcliquen hier, über Geldlosigkeit, über die Fron des für Zeitungen Schreibenmüssens, Anfang Juli fährt er nach Holland.“382 Damit ist möglicherweise ein Klinikaufenthalt in Berlin gemeint, den Zech als Auslandreise kaschiert.
Zehn Tage später schreibt Herrmann seiner Lebensgefährtin erneut: „Zu Zech hinauf, der […] klagt über Verdrängen der Älteren und Verhätscheltwerden der Ganz-Jungen, und dass die Dreißigjährigen heute schon zum alten Eisen geworfen würden.“383 Zu schaffen macht dem Gastgeber auch der ständige Druck, dem er ausgesetzt ist. Von Wegner erreicht ihn eine weitere Anfrage: „Sind meine Gedichte nun im ‚Neuen Pathos‘ erschienen? Sie sollten doch wohl schon längst kommen.“384 Auch hierauf erfolgt keine Antwort.
Am 28. Juni 1914 werden in Bosnien, das von der kaiserlich-königlichen Monarchie annektiert worden ist, der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau erschossen. Beim Attentäter handelt es sich um einen Anhänger großserbisch-nationalistischer Bestrebungen. Der Mord von Sarajevo verschärft die seit langem schwelenden Konflikte zwischen den europäischen Großmächten. Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg mehren sich. Nichts davon findet sich in Zechs Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Ihn beschäftigen vornehmlich Ereignisse, die mit seiner persönlichen Erlebniswelt zu tun haben.
Die neueste Ausgabe der Kulturzeitschrift „Der Türmer“ enthält eine Glosse „Zurück zu Wodan!“ Ihr Verfasser zeichnet lediglich mit dem Buchstaben „Z.“: „Im Harz versammelten sich in den Pfingsttagen eine ganze Reihe von deutsch-völkischen Sekten“. Die werden einzeln aufgezählt. An erster Stelle steht die „Germanische Glaubensgemeinschaft“ Fahrenkrogs. „Z.“, niemand anderes als Paul Zech, kommentiert: „Das sind gewiss tüchtige Idealisten. […] Dabei wohnen den meisten dieser neugermanischen Sekten kirchenfeindliche Bestrebungen inne. Das Christentum […] ist ihnen als ‚semitisch‘ verdächtig.“ Sein bissiger Kommentar lautet: „So springen sie denn über zweitausendjährige Eindeutschung und Luthers Werk einfach hinweg und kehren frisch-froh zurück zu Wodan.“385 Damit sagt sich Zech endgültig von seinem früheren Idol los. Die Glosse erscheint in einer Zeitschrift des Verlages „Greiner & Pfeiffer“, der Fahrenkrogs „Baldur“ herausgebracht hat. Den „Königlichen Hofbuchdruckern“ ist inzwischen klar geworden: Ihr langjähriger Autor möchte das Christentum abschaffen, auf dessen Grundlage sie gut gehende Geschäfte machen.
In der gleichen Ausgabe des „Türmers“ wird Zechs Gedicht „Wir müssten so wie Kinder sein!“ abgedruckt, die Verse also, mit denen er sich vor zwei Jahren vergeblich um eine Einigung zwischen Fahrenkrog und Kramer bemüht hat.386 Zusätzlich würdigt der österreichische Autor Hermann Kienzl das lyrische Schaffen des Verfassers: „In seiner Art der Naturbeseelung gemahnt Zech nicht selten an Verhaeren, der überhaupt auf die junge Dichter-Generation stärksten Einfluss übt. Zech ist Expressionist. Er hebt nur hervor, was bedeutsam ist, und verschmäht Staffagen.“387
Eine Lobeshymne aus Wien übertrifft all das, was Zweig seinem Freund bisher geschrieben hat: „Sie sind in drei Jahren aus einem begabten Lyriker einer der stärksten Sprachkünstler geworden, die wir haben, und die Farbigkeit Ihrer Übersetzungen ist wirklich ohnegleichen.“ Der Kollege fährt fort: „Ich hätte sehr das Bedürfnis, mit Ihnen wieder einmal ausführlich beisammen zu sein, wie schade, dass es jetzt nicht möglich ist, ich gehe zu Verhaeren nach Belgien und komme erst wieder im Herbst zurück.“388 Ganz anders liest sich eine Zuschrift von Franz Blei an die „Aktion“: „In Deutschland ist es alltäglich, dass Freundschaftskritiken erscheinen. Ein belangloser K. E. Meurer feiert seinen Busenfreund ‚Dr.‘ Paul Robert Zech als Genie im Xer Kreisblatt; im Xer Generalanzeiger revanchiert sich Herr Zech und lässt Meurer ein Genie sein.“389 Blei kritisiert damit Veröffentlichungen in der Elberfelder sowie Barmer Lokalpresse und revanchiert sich dafür, dass der Kollege im „Jahrbuch für Dichtkunst“ wenig freundlich mit ihm umgegangen ist.
Leonhard Frank wendet sich mit einer Bitte an den Herausgeber des „Neuen Pathos“: „Unter Berufung auf Herrn Doktor Albert Ehrenstein hat Ihnen Georg Müller meinen Roman ‚Die Räuberbande‘ geschickt. Haben Sie ihn bekommen? Ich bitte Sie sehr, möglichst gleich eine ausführliche Besprechung […] zu bringen“.390 Diesem Wunsch kann der Adressat nicht nachkommen, weil das lange angekündigte neue Heft Anfang Juli endlich erscheint. Die Ausgabe enthält zwei Übertragungen Zechs aus dem Französischen, „Der Hafen“ nach Verhaeren und „Das trunkene Schiff“ nach Rimbaud. Acht lyrische Beiträge stammen von Dehmel, Loerke, Werfel, Max Herrmann, Ehrenbaum-Degele, R. R. Schmidt, Hasenclever und Meurer. Ein Auszug aus Zweigs Vortrag an der Friedrich-Wilhelms-Universität erscheint unter dem Titel „Die Liebe bei Dostojewski“. Ehrenstein und Edschmid sind ebenfalls mit Prosatexten vertreten. Drei grafische Beiträge haben Künstler geliefert, die schon in früheren Heften dabei waren: Rösler, Heckel und Meseck. Darüber hinaus ist es Zech gelungen, für die Zeitschrift drei neue Mitarbeiter zu gewinnen, die ebenfalls bekannte Namen tragen: Wilhelm Gerstel, Walter Klemm und Karl Schmidt-Rottluff. Mit einer Kreidezeichnung des Letzteren ist die Künstlergruppe „Die Brücke“ im „Neuen Pathos“ vertreten. Die für diese Ausgabe angekündigte „Betonung des Erotischen“ hält sich in Grenzen.
Zech bestellt Börsch ein weiteres Mal ein: „da ich Sie gerne sprechen möchte, wäre es mir lieb, wenn Sie das Heft selber abholen kämen. […] Vielleicht kommen Sie am Freitag nachmittag gegen vier Uhr.“391 Zum genannten Termin erscheint der Besucher in der Babelsberger Straße, doch der Hausherr ist wieder nicht da. Später begründet der seine Abwesenheit so: „Das Heft, das für Sie bestimmt war, musste ich, da die Sache sehr eilte, einem neuen Subskribenten bringen.“ Statt sich zu entschuldigen, schreibt er dem jungen Mann: „ich habe mich geärgert, dass ich Sie verfehlt habe“, und schlägt ein neues Treffen vor: „Ich hole heute Nachmittag das Ersatzheft und wenn Sie am Dienstag oder Mittwoch zwischen vier und fünf zu mir kämen, wäre es sehr schön.“ Jetzt mag Börsch nicht mehr. Er bricht die Verbindung ab. Sein Artikel „Die drei Lyrikbücher aus dem Verlag der Weißen Bücher“ erscheint mit einem halben Jahr Verspätung in Meurers „Neuer Theater-Zeitschrift“.392
Hasenclever dagegen gibt noch nicht auf. Er fragt Zech: „Weshalb höre ich nichts mehr von Ihnen? Wo bleibt das ‚Neue Pathos‘ mit meinem langen Gedicht? Und wie wird es mit den Beiträgen für das nächste? Schreiben Sie mir bitte!“393 Antwort bekommt er wieder nicht. Schickele hat etwas mehr Erfolg. Er überarbeitet den Beitrag, dessen Veröffentlichung ihm vor vier Wochen versprochen worden ist, nach den Wünschen des Herausgebers und gibt ihn zur Post. Im Begleitschreiben heißt es: „so nehmen Sie bitte in der ‚Trilogie der Eifersucht‘ die ‚Ballade‘ heraus und stellen Sie an deren Stelle die beiden Strophen, die ich Ihnen beilege. Schicken Sie dann bitte sobald wie möglich das Manuskript zurück.“394 Der zweiten Bitte entspricht der Herausgeber, die Texte veröffentlicht er nicht.
Inmitten des hektischen Arbeitsalltags hat Zech das Verlangen, sich einem Menschen anzuvertrauen, dem er nahesteht. Deshalb nimmt er seine Korrespondenz mit Schattke wieder auf: „Die Spannkraft muss höchste Belastungen auf Kosten der Nerven aushalten. Und doch treibt es einen immer wieder hinauf auf den höchsten Gipfel der schöpferischen Wachheit.“ Erinnerungen helfen ihm, Phasen körperlicher und seelischer Erschöpfung zu überwinden: „Liebste, ich denke oft an unsere wütend jugendlichen Entwürfe in den Dämmerwäldchen, ich fühle oft Ihre Hand, die ich einmal nur flüchtig streifen durfte. Ich denke an unsere Hoffnungen, die jeder freilich ungesagt für sich trug. Warum war jetzt nicht früher.“ Er unterstellt: „Vielleicht hätten wir dann den Kampf überwunden und uns in eine Geselligkeit hinaufgerettet, die schön und ein Erlösendes gewesen wäre.“395