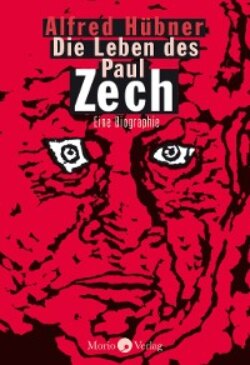Читать книгу Die Leben des Paul Zech - Alfred Hübner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel
ОглавлениеEine halbe Spreewaldgurke
Paul Zech, nach eigenen Worten ein „Dickschädel aus bäurisch-westfälischem Kornsaft“1, ist – um bei seiner landwirtschaftlichen Bildsprache zu bleiben – der Herkunft nach zur Hälfte eine „Spreewaldgurke“: Der Ur-Ur-Großvater mütterlicherseits, Schuhmachermeister Johann Gottfried Leberecht, heiratet 1782 in der Spreewaldstadt Lübben die 1749 als Tochter eines Leinewebers zu Lieberose geborene Johanna Christiane Golzen.2 Beider Sohn Johann Leberecht, Zechs Urgroßvater mütterlicherseits, kommt 1785 zur Welt.3 Er wird Lehrer und ist zu Anfang seiner Laufbahn an mehreren Orten im Spreewald tätig, später einige Zeit im heutigen Ostbrandenburg, zunächst in Mittweide und schließlich in Lindenberg bei Beeskow. Außer schulischen Aufgaben muss er am jeweiligen Wirkungsort das Amt des Küsters versehen.
Johann Leberecht heiratet 1806 in Fürstenberg an der Oder Regina Karoline Jordan.4 Zwei Jahre nach der Hochzeit bekommt das Paar erstmals Nachwuchs, eine Tochter Caroline.5 Dem Mädchen folgen nacheinander vier Söhne: Traugott, Theodor, Albert und Franz. Im Dezember 1827 wird Ehefrau Regina in Lindenberg von einer weiteren Tochter entbunden, die den Namen Auguste Henriette Emilie erhält; sie ist Zechs Großmutter mütterlicherseits. Für ihre Taufe können die Eltern den Verwalter des Gutes Lindenberg, einen Gerichtsherrn namens Schliebener, als Paten gewinnen.6 Auf Auguste folgt schließlich noch ein Mädchen namens Berta.7
1832 stirbt Johann Leberecht und hinterlässt eine erwachsene Tochter sowie sechs minderjährige Kinder.8 Seine Witwe zieht mit den Halbwaisen nach Beeskow, wo ein Bruder des Verstorbenen lebt. Als ihre älteren Söhne über eigenes Einkommen verfügen, helfen sie der Mutter, indem sie jüngere Geschwister in ihren Hausstand aufnehmen. Dazu sind sie in der Lage, weil die in Straupitz und Lübben ansässige herrschaftliche Familie Houwald drei von ihnen zu Lehrern ausbilden lässt.
Theodor, der zweite Sohn, unterrichtet in Laasow, einem kleinen Dorf nahe Straupitz. 1838 heiratet er Elisabeth Kossatz, zwei Jahre später wird er Vater einer Tochter namens Marie.9 1856 verlässt Theodor Laasow und bestreitet den Lebensunterhalt für sich und die Familie einige Zeit lang als Windmüller. Der Grund für den Weggang sind, wie es heißt, Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung, weil ihm die gräfliche Herrschaft vier Morgen Ackerland sowie drei Morgen Wiese zur Nutzung überlassen hat. Das Geschehen ist in der Ortsgeschichte von Laasow festgehalten.10
Albert Leberecht, dritter Sohn von Johann und Regine Leberecht, 1820 in Mittweide zur Welt gekommen, arbeitet während der Vierzigerjahre als Lehrer und Küster in dem kleinen Ort Butzen, einem Nachbarort von Laasow.11 Urkundlich belegt ist seine Versetzung im Jahre 1854 von Butzen nach Bomsdorf bei Neuzelle an der Oder.12
Franz Leberecht, der vierte Sohn von Gottfried und Regina Leberecht, durchläuft als „Seminarist in Neuzelle“ eine Ausbildung zum Lehrer. Förderer der dortigen pädagogischen Anstalt ist Graf Houwald.13 Nach Abschluss seines Studiums arbeitet er als Lehrer in Straupitz. 1848 heiratet er Friederike Hinze, die 23 Jahre alte Tochter des Schuhmachermeisters Carl Ludwig Hinze aus Müncheberg, Kreis Lebus, im preußischen Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder.14 Das Paar hat durch Caroline Leberecht, die älteste Schwester des Bräutigams, zueinander gefunden. Sie wohnt seit vielen Jahren in Dahmsdorf, einem Dorf bei Müncheberg in der Mark, und ist mit dem Mühlenbesitzer Carl Grohmann verheiratet. Franz und Friederike Leberecht bekommen 1849 Nachwuchs, einen Sohn.
Von Paul Zechs Großmutter, der 1827 geborenen Auguste, erfahren wir hauptsächlich durch Einträge in Kirchenbüchern. Bei der Taufe von Theodors Tochter Marie 1840 werden die „Jungfer Auguste Leberecht“ sowie ihr Bruder Albert als Paten angeführt. Auguste lebt zu der Zeit bei der Mutter in Beeskow.15 Dem jungen Mädchen bleibt Mitte des 19. Jahrhunderts ein Studium verwehrt. Nach seiner Konfirmation wird es von Bruder Albert aufgenommen und erscheint 1842 bei der Taufe von Theodors Sohn Wilhelm im Kirchenbuch von Straupitz erneut als Patin, wohnhaft „in Butzen“, ein weiterer Pate ist ihr Bruder Franz Leberecht. Möglicherweise arbeitet Auguste in Butzen als Magd auf einem Houwaldschen Gut, das sich in direkter Nachbarschaft von Kirche und Schulhaus des Dorfes befindet, um etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen. Vielleicht kümmert sich die Herrschaft schließlich doch um die Tochter des verstorbenen Johann Leberecht, weil sie ihren Brüdern an Begabung und Lerneifer in nichts nachsteht. Ein Jahrhundert später verrät ihr Enkel Paul Zech den Nachnamen der Vorfahrin: „meine Großmutter [war] eine geborene Leberecht“, fügt aber hinzu: „aus Krossen an der Oder“.16 Das ist falsch. Er verwechselt die Stadt mit einem in der Nähe von Butzen gelegenen Dorf gleichen Namens, auf dessen Gemarkung sich ein Herrschaftssitz befindet, der bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts den Houwalds gehört.
Eine denkbare Version von Augustes Werdegang ist folgende: das Mädchen wird nach 1840 als Kammerzofe auf dem Houwaldschen Familiensitz Schloss Neuhaus in Dienst genommen, der sich nur zwanzig Kilometer von Butzen entfernt befindet. Dort sind während der ersten Hälfte des Jahrhunderts viele Dichter der Romantik, unter ihnen Achim von Arnim, Geibel, Chamisso, de la Motte Fouqué, Tieck und Grillparzer zu Gast. Über eine derartige Tätigkeit und deren mögliche Folgen existieren keinerlei Dokumente, aber Paul Zechs Begabung als Schriftsteller könnte vererbt sein wie eine Nervenkrankheit, unter der er lebenslang leidet.
1849 findet sich Augustes Namen wieder in den Kirchenbüchern. Unter den Taufpaten des Sohns ihres Bruders Franz wird die „Jungfrau Auguste Leberecht“ aufgeführt.17 Darüber, wo die junge Frau während der nächsten sechs Jahre lebt, gibt es keine Aufzeichnungen. Erst aus einem Taufeintrag im Müncheberger Kirchenbuch von 1855 geht hervor, was Auguste weiter widerfährt. Sie bringt am 5. November 1855 in dieser Stadt ein uneheliches Kind zur Welt, das den Namen Emilie erhält. Bei diesem Mädchen handelt sich um Paul Zechs Mutter. Wo Auguste schwanger geworden ist, ob in Butzen, Laasow, Crossen, Straupitz, auf Schloss Neuhaus oder in Müncheberg, weiß nur sie selbst, verrät es aber niemandem.
Fünf Monate nach dem für ledige Mütter in jener Zeit alles andere als „freudigen Ereignis“ heiratet Auguste den Landwirt August Heinrich Liebenow aus Müncheberg. Die Verbindung kommt durch Augustes Schwester Caroline Grohmann zustande. Diese hat an ihrem Wohnort nach einem passenden Mann für die Schwester gesucht. Der 1820 geborene Bräutigam ist Angehöriger einer der vielen Familien, die in Müncheberg den Namen Liebenow tragen. Er wird in amtlichen Unterlagen als „Eisenbahnbeamter“ und „Eigenthümer“ geführt, das heißt, er besitzt Land und Vermögen.18 Die zeitliche Nähe der Geburt Emilies zur Hochzeit ihrer Mutter mit August Liebenow könnte vermuten lassen, bei diesem Mann handle es sich um den leiblichen Vater von Paul Zechs Mutter. Das trifft nicht zu. Der Großvater mütterlicherseits des Autors findet nirgends Erwähnung. Er bleibt ein Unbekannter. Auf die Beziehung der Eheleute Liebenow scheint die ungeklärte Vaterschaft des Mädchens keine Auswirkung zu haben. In der Ehe bringt die Gattin noch drei Söhne zur Welt. Zusammen mit den Stiefbrüdern wächst Emilie, die bis zu ihrer Heirat im Jahre 1878 den Namen Leberecht beibehält, im Haus der Liebenows an der Müncheberger Hinterstraße auf. Das landwirtschaftliche Anwesen liegt unweit der Knabenschule und der Pfarrkirche St. Marien, dem Wahrzeichen der Stadt Müncheberg.
Die Ahnenreihe von Pauls Vater ist weniger weit zurückzuverfolgen als die der Mutter. Zech selbst behauptet etliche Male, seine Familie habe zu jenen Protestanten gehört, die vom Salzburger Erzbischof außer Landes getrieben worden sind.19 Dokumente darüber gibt es keine. Auch die von Zech reklamierte „bäurisch-westfälische“ Herkunft ist von der väterlichen Seite her ebenso wenig nachweisbar wie von der mütterlichen.
Pauls Großvater Wilhelm und sein Vater Adolf stammen aus Briesen in Westpreußen, dem einstigen slawischen Wambrez und heutigen Wąbrzeźno in Polen. Wilhelm Zech wird im Jahre 1820 in Briesen geboren, ist von Beruf Seilermeister und zeitlebens dort ansässig. Dieses Städtchen, das in der Weichselniederung im sogenannten „Culmer Land“ zwischen Graudenz und Thorn an drei Seen liegt, hat Johannes Bobrowski zum Schauplatz seines Romans „Levins Mühle“ gemacht, der Personen, Zeit und Milieu der Gegend am Flüsschen Drewenz vor 1900 widerspiegelt. Im Roman, dessen Untertitel „34 Sätze über meinen Großvater“ lautet, heißt es: „Alle Wege führen nach Briesen“.20 Ahnen, die aus diesem Culmer Land stammen, besitzt Zech tatsächlich, doch die Herkunft der Vorfahren väterlicherseits aus Westpreußen will er zeitlebens meist verschleiern.
Zechs Vater Adolf kommt am 5. September 1850 in Briesen zur Welt. Er stammt aus der ersten Ehe von Wilhelm Zech mit Elisabeth Spinch, die 1861 verstorben ist. Nur wenige Monate nach ihrem Tod hat der Witwer damals Emilie Tiedke zur zweiten Frau genommen. In den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts lernt Adolf im väterlichen Betrieb das Seilerhandwerk und begibt sich anschließend auf Wanderschaft nach Westen. In Küstrin findet er Arbeit und verliebt sich Mitte des Jahrzehnts in Emilie Leberecht aus Müncheberg. Ein modernes Verkehrsmittel erleichtert ihm die Besuche bei ihr. Das dreieinhalbtausend Einwohner zählende Städtchen Müncheberg, rund vierzig Kilometer von Küstrin entfernt, besitzt einen eigenen Bahnhof an der Linie der Preußischen Staatsbahnen, die von Berlin nach Küstrin führt. Am 28. September 1878 gehen die jungen Leute in Emilies Geburtsstadt den Bund fürs Leben ein.
Schwere Kindheit
Kaum ist im Herbst 1878 in Müncheberg die Hochzeitsfeier beendet, kehrt der achtundzwanzigjährige Seiler zusammen mit seiner Frau nach Westpreußen zurück. Für Emilie bedeutet der Ortswechsel nicht nur die Trennung von der Mutter, sondern zugleich eine Verschlechterung ihrer bisherigen Lebensverhältnisse auf dem Hof der Liebenows. In Bobrowskis Roman entrüstet sich der Großvater: „Was redet der Kerl da von Provinz. Briesen – und Provinz!“, doch legt der Autor diese Worte ihrem Sprecher augenzwinkernd in den Mund. Die Gegend in der Weichselniederung zwischen Thorn und Graudenz ist für ihn der Inbegriff von Provinz.21
Im westpreußischen Landkreis Briesen, dem die gleichnamige Stadt sowie Gollub, Schönsee und 63 weitere Gemeinden angehören, leben um 1880 knapp 40 000 Menschen, davon sind rund 24 000 katholischen Glaubens, etwas weniger als 15 000 Protestanten und rund 1000 Juden. Zech erwähnt in seinem Buch „Die Reise um den Kummerberg“ zwei Gotteshäuser seines Geburtsorts, die evangelische Kirche am Markt und eine auf dem Berg gelegene katholische Kirche.22 Die jüdische Gemeinde verfügt an der Schulstraße über eine Synagoge. Angeblich verkehren der Vater und die Mutter mit jüdischen Familien: „Da ich diese Art von Menschen in meiner frühen Jugend schon erfahren habe, nachbarlich nahe und den Eltern befreundet, […] komme ich mir vor wie einer der Ihrigen.“23
Gespalten ist die Bevölkerung des Landkreises, wie die Westpreußens insgesamt, nicht nur durch drei Konfessionen, sondern zusätzlich durch zwei Nationalitäten: „Man spricht polnisch und ein Deutsch mit hässlichem Dialekt.“24 Nur wenige Hundert Bürger beherrschen beide Idiome. Etwa 23 000 Menschen sprechen polnisch, ungefähr 17 000 deutsch. Insbesondere bei Wahlen befehden sich „der schwarze und der weiße Adler“ Preußens und Polens.25 Die Stadt Briesen zählt 1880 rund 4500 Einwohner. Nach Aussage von Waldemar Heym, dem Sohn des Ortschronisten Benno Heym, liegt die Kommune bis Ende des 19. Jahrhunderts in einem Dämmerschlaf. Daran ändert sich erst etwas, als sie 1887 zur Kreisstadt erhoben wird.26
Zur Zeit des Umzugs von Adolf und Emilie nach Briesen sind die örtlichen hygienischen Verhältnisse teilweise mittelalterlich. Es gibt keine Kanalisation. Nach großen Regenfällen herrscht Wassernot, denn die Niederschläge fließen auf den Straßen und Gassen mit Fäkalien aus den Häusern und Stallungen zusammen und ergießen sich in die drei Seen nahe der Stadt, aus denen die Bevölkerung Trinkwasser schöpft. Krankheiten und eine hohe Kindersterblichkeit sind die Folgen. Das Übel dauert bis zur Jahrhundertwende. Fortschritte gibt es nur allmählich. In den Neunzigerjahren erhält Briesen Anschluss an die Linie der Preußischen Staatsbahnen von Thorn nach Allenstein. Später geht eine innerstädtische Straßenbahnlinie in Betrieb. Im Industriegebiet stehen eine dampfbetriebene Mühle, eine Brauerei, eine Molkerei und eine Zuckerfabrik. Dreizehn Windmühlen ringsum verschwinden zu dieser Zeit ebenso wie der seit dem Mittelalter amtierende Nachtwächter.
Da am Briesener Markt ausschließlich Privathäuser und die evangelische Pfarrkirche Platz gefunden haben, wird ab den Achtzigerjahren die Schönseer Straße zur Behördenmeile der Stadt. An ihr entlang lässt die Obrigkeit Gebäude errichten, in die Ämter und öffentliche Einrichtungen einziehen. Seit Beginn des Jahrzehnts steht hier das Amtsgericht, 1883 ist unweit davon eine Volksschule eröffnet worden. Nacheinander folgen nun Landratsamt, Rathaus und Krankenhaus. Die einstige Nebenstraße entwickelt sich zu einer Art Boulevard, der freilich an Regentagen vom Zentrum, dem Markt und beiden Kirchen durch einen wilden Wasserlauf getrennt ist, aus dem üble Gerüche aufsteigen.
Adolf Zech bringt 1878 seine junge Frau weder in eine einladende noch saubere, geschweige denn „blühende“ Stadt. Insbesondere das Gesundheitswesen weist erhebliche Mängel auf. Die Eheleute finden im rückwärtigen Teil des Hauses Schönseer Straße 14 eine Wohnung. Das Gebäude liegt zwischen Volksschule und Friedhof und gehört Schreinermeister Christian Günther. Der stattlich wirkende Hauptbau besitzt einen unansehnlichen Seitenflügel. In dessen Erdgeschoss bekommt Emilie Zech Mitte Februar 1879 ihr erstes Kind, das den Namen Adolf Richard und zwei Monate später in der Stadtkirche am Markt die christliche Taufe erhält, aber schon fünf Wochen danach stirbt.
Ein ähnliches Schicksal ereilt auch den im Februar 1880 geborenen Knaben Erhard Robert. Er fällt im Mai einer Säuglingskrankheit zum Opfer. Schon im Juni 1880 ist Emilie erneut schwanger. Das dritte Kind der Familie, wieder ein Junge, kommt am Samstag, dem 19. Februar 1881, zur Welt und wird einen Monat später von Pfarrer August Weckwarth auf die Vornamen Paul Robert getauft. Patinnen sind Caroline Günther, eine Verwandte des Hausbesitzers, sowie Minna Werner und Auguste Tarnig aus Briesen. Die amtliche Geburtsurkunde unterzeichnet der seit 1873 im Rathaus amtierende Bürgermeister Gostomski in seiner Funktion als örtlicher Standesbeamter.27 Erneut dauert das familiäre Glück nur kurze Zeit, denn im Verlauf der folgenden Jahre bringt der Tod weiterer Kinder ununterbrochen Leid über die Eltern. Hinzu kommt schwere materielle Not. Das Seilerhandwerk wirft kein Geld mehr ab, weil die bisher manuell hergestellten Waren nun in Fabriken produziert werden und deshalb billiger sind. Viele von Adolf Zechs Berufsgenossen müssen schon als Hausierer über Land ziehen, um Städtern und Bauern ihre Waren anzubieten.
Evangelische Kirche am Marktplatz
Zechs Geburtshaus, Schönseer Straße 14 in Briesen, heute Wąbrzeźno
Trauer und Armut bestimmen das Leben der Familie Zech. Dennoch beschäftigt sich Emilie nicht ausschließlich mit den eigenen Sorgen. Während ihrer Schwangerschaft hat sie eine neunzehnjährige Frau kennengelernt, die ebenfalls ein Kind erwartet. Sie heißt Hulda Zanner. Deren Ehemann Friedrich, von Beruf Schneider, ist unheilbar an Tuberkulose erkrankt und stirbt, nur 28 Jahre alt, im März 1881. Vier Monate später bringt die Witwe ein Mädchen zur Welt, das Pfarrer Weckwarth auf die Vornamen Martha Ida tauft.28 Eingedenk ihres Schicksals als Kind, von dem in amtlichen Dokumenten verzeichnet steht, eine ledige Mutter habe es zur Welt gebracht, versucht Emilie, Hulda zu helfen. Sie schreibt an ihre Familie nach Müncheberg und bittet den jüngsten der drei Stiefbrüder, sich als Taufpate für das Neugeborene zur Verfügung zu stellen. Wilhelm Liebenow, von Beruf „Bedienter“, kommt dieser Bitte nach und eine stille Hoffnung seiner Schwester erfüllt sich. Der Zwanzigjährige findet Gefallen an Hulda und holt sie kurze Zeit später mit seinem Patenkind Martha Ida zu sich nach Müncheberg.
Weniger Glück ist den Zechs in Briesen beschieden. 1882 kommt ein weiteres Kind zur Welt, ein Mädchen, das bei einer Nottaufe den Namen Margareta erhält und zwei Tage darauf stirbt. Aus diesem Trauerjahr stammt eine erste Aufnahme von Paul Zech. Emilie fährt mit ihrem Sohn ins nah gelegene Städtchen Gollub und lässt sich dort zusammen mit ihm von einem polnischen Fotografen namens Daniel Dobrycz ablichten.29 Da Paul die kritischen Monate als Säugling ohne Erkrankung übersteht, scheint für die Eltern manches besser zu werden und sie wünschen sich weitere Kinder. In der Stadt gehören sie zwar nicht zum Bürgertum, trotz ihrer Wohnung am Briesener „Boulevard“, sind aber immerhin deutlich bessergestellt als viele polnische Familien. Eine im Jahr darauf geborene Tochter namens Elisabeth bleibt am Leben, doch zwei weitere Mädchen, von denen die Mutter 1884 und 1885 entbunden wird, sterben kurz nach der Taufe. Tränen und Hunger bestimmen weiter den Alltag im Hinterhaus der Schönsee Straße 14.
Wegen der beengten Wohnverhältnisse wird Paul des Öfteren Ohrenzeuge des Liebeslebens der Eltern. Er belauscht: „Der Mutter Scham und zärtliches Verschwenden / in Jugendfrische und erwachter Lust, / des Vaters Seufzer aus gespannter Brust / in der Umarmung hellem Aufruhr und Vollenden“. Da Emilie ihre Kinder in der Wohnung zur Welt bringt, ist er auch bei den Niederkünften der Mutter im Nebenzimmer zugegen: „und dann die bangen Abende beim Lampenschimmer / in Zuspruch und verhaltner Wartenot, / bis sich aus dem geborstnen Wundenrot / sanft löste eines Kinderstimmchens klar Gewimmer.“ Diese Eindrücke vergisst er lebenslang nicht: „alles ruht, verhundertfachte Saat, / tief in mir“.30
Emilie Zech mit ihrem Sohn Paul im Jahre 1882
Von Pauls frühen Jahren ist wenig bekannt. Freude bereitet dem Buben ein blauer Handwagen, auf dem er im Städtchen eine abschüssige Straße hinabsaust.31 Seine Schwester Elisabeth und er durchleben eine armselige Kindheit. Vermutlich können ihre Eltern die Trauerkleidung – sofern sie derartigen Luxus überhaupt besitzen – jahrelang nicht ablegen. 1885 erkrankt Paul schwer. Die Eltern befürchten seinen Tod. Um das Leben des Sohnes zu retten und die materielle Not der Familie zu lindern, wird der noch nicht schulpflichtige Knabe zur Familie der Mutter nach Müncheberg in Pflege gegeben.32 Vater Adolf bringt ihn dort hin.
Bei der Großmutter
Paul versteht die Handlungsweise der Eltern nicht und fühlt sich verstoßen. Ihm fehlt die Mutter: „Sie war in den entscheidenden Jahren leiblich nicht dagewesen. Ich litt schwer darunter“, beklagt er sich.33 Das Kind bleibt mehrere Jahre in Müncheberg und kommt dort zur Schule. Die Stadt liegt, ähnlich wie Briesen, an einem See und besitzt einige Sehenswürdigkeiten, darunter den mittelalterlichen „Küstriner Torturm“, von der Bevölkerung „Storchenturm“ genannt. An seiner Außenseite ist eine martialisch wirkende Holzkeule angebracht und darunter eine Tafel ins Gemäuer eingelassen, deren Inschrift lautet: „Wer seinen Kindern gibt das Brot und leidet selber Not, den soll man schlagen mit dieser Keule tot.“ Paul sieht beides auf Streifzügen durch die Stadt und kann nach der Einschulung auch den Text lesen. Die Worte bleiben ihm lebenslang im Gedächtnis.34 Das trifft auch auf eine andere seiner kindlichen Wahrnehmungen zu: er beobachtet Bäuerinnen bei der Arbeit. Nahe dem Haus, in dem er wohnt, führt eine „Butterstraße“ entlang, die diesen Namen trägt, weil es dort Butter zu kaufen gibt: „wie gebuttert wird, das wußte ich schon, als ich noch nicht wußte, wie man mit einem Griffel ein kleines deutsches ,i‘ auf die Schiefertafel kratzt“, hält er fest.35
Ein Kindheitserlebnis bestimmt Zechs Leben und Schaffen in besonderem Maß: der Bergbau. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es rund um Müncheberg mehr als ein Dutzend Gruben. Im Untertagebau wird aus siebzig Metern Tiefe Braunkohle gefördert. Die Industrie verschafft vielen Einwohnern von Stadt und Umgebung Arbeit, doch hat sie auch ihre Schattenseiten. Es kommt unter sowie über Tage zu Unfällen und Katastrophen.36 Zur Verwandtschaft von Auguste Liebenow gehören zwei Grubenarbeiter. Einer von ihnen wohnt in der Nähe und hat zwei Söhne. Während des Zusammenseins mit diesen Spielkameraden erfährt Paul von den Gefahren der Kohleförderung und lernt die Sorgen der Bergleute kennen. Als Erwachsener behauptet er: „Auch mein Vater war, ehe er das väterliche Bauerngut übernahm, Volksschullehrer in einem ausgesprochenen Grubendorf, wo es nur Bergarbeiter und Kleinbauern gab.“37 Ein solches Gehöft besitzt August Liebenow, der Ehemann seiner Großmutter mütterlicherseits, Auguste, bei dem es sich aber nicht um seinen Großvater handelt.
Paul Zech und Karl Liebenow besuchen die Knabenschule in der Hinterstraße, obwohl das Gebäude laut Inschrift an der Fassade eigentlich den Mädchen vorbehalten ist. Im Herbst 1886 trifft die Familie des Klassenkameraden ein großes Unglück. Zuerst stirbt der vierjährige Bruder Richard, und am Tag der Geburt einer Schwester namens Martha muss der Vater auf dem Rathaus den Tod seiner Ehefrau anzeigen. Ein Jahr später verliert er auch die Tochter. Pauls Eltern in Briesen geht es nicht anders. Mitte März 1886 beerdigt das Ehepaar Zech einen tot geborenen Knaben, der keine Taufe und keinen Namen erhalten hat. Den Eltern bleibt Tochter Elisabeth und die Hoffnung, Pauls Gesundheit werde sich durch den Aufenthalt in Müncheberg festigen.
Von den Jahren bei der Großmutter berichtet Zech in seiner Erzählung „Die unterbrochene Brücke“: „Nach einer heftigen Krankheit […] brachte mich mein Vater zu seinem Bruder in die sauerländischen Berge.“38 Ersetzt man die „sauerländischen Berge“ durch „Müncheberg“ und den Hinweis „zu seinem Bruder“ durch „zur Familie der Großmutter“, so entsprechen Personen und Schauplatz der Handlung dem Lebenslauf des Verfassers. Zwar beruht der Text nicht durchgängig auf seinen eigenen Erlebnissen, doch die Darstellung des Umfeldes weist Übereinstimmungen mit dem Stadtbild von Müncheberg auf, wie es Paul ab Mitte der Achtzigerjahre vor Augen hat. Auch der Spielkamerad Karl taucht im Text auf.
Nicht erwähnt wird Martha Ida Zanner, die ebenfalls in Müncheberg lebt. Ihr Taufpate, Pauls Onkel Wilhelm Liebenow, heiratet 1886 Idas Mutter Hulda, die Freundin von Pauls Mutter aus Briesen. Den Lebensunterhalt verdient der Familienvater nicht mehr als Bedienter, sondern bei der Post im nahen Trebnitz. Dort befindet sich eine Eisenbahn-Verladestation für den Kohlebergbau der Region. Zur Hochzeit von Wilhelm und Hulda kommen Gäste aus Westpreußen, und der knapp sechsjährige Paul sieht für kurze Zeit seine Eltern wieder. Desto schwerer fällt ihm beim Abschied die Trennung von der Mutter. Anders als von Zech später behauptet, besucht er am Wohnort der Großeltern weder eine Rektoratsschule, noch lernt er an einer solchen Einrichtung „die lateinische Verskunst Ovids“ kennen. Um die Jahreswende 1889/1890 holt Adolf Zech seinen Sohn zurück nach Westpreußen.39
Müncheberg mit Waschbanksee
Müncheberg, Schule in der Hinterstraße
Frust im Elternhaus
Ab den Neunzigerjahren lebt Paul wieder bei den Eltern. Waldemar Heym, der Sohn des Briesener Ortschronisten Benno Heym, beobachtet, wie er dem Vater auf der Seilerbahn bei seiner Arbeit hilft.40 Während der Abwesenheit ihres Ältesten haben sich die familiären Verhältnisse bei den Zechs nicht gebessert. Mutter Emilie ist mit weiteren vier Kindern niedergekommen, von denen lediglich eines überlebt hat. Ein Knabe, Fritz Hermann41, sowie zwei Mädchen, Olga Anna42 und Anna Hedwig43, sind gestorben. Über Rudolf, das Brüderchen, geboren im März 1889, freut sich der Rückkehrer nicht. Zwar nimmt er sich der „kleinen, um den Puppenwagen besorgten“ Schwester an, die eine „Schlaf- und Lachpuppe“ besitzt, aber zwischen den Buben kommt es häufig zu Streitereien.44 Paul glaubt, Rudolf werde bevorzugt. Das „Trotzköpfchen“, so beobachtet er, wirft sich auf den Boden und strampelt mit den Beinen, um seinen Willen durchzusetzen. Neidisch muss er zusehen, wie die Mutter den Kleinen mit Süßigkeiten verwöhnt, während er selbst keine bekommt. Auch bleibt der Bruder, anders als er selbst, von Bestrafungen mit dem Stock verschont.45
In der Schule hat Paul Angst, wenn er ein Gedicht aufsagen muss, obwohl er die Verse zu Hause gründlich lernt und die Mutter von seinem flüssigen Vortrag sowie der guten Betonung überrascht ist. Dagegen bringt er im Unterricht vor den Mitschülern kein Wort heraus, worauf der Lehrer zum Stock greift und es Hiebe setzt. Im Elternhaus geschieht das bei kindlichen Vergehen ebenfalls. Wenn der Älteste heimlich Zucker genascht hat, sperrt die Mutter den „ertappten Sünder“ in den Keller.46 Auch sie schlägt ihn zuweilen.47 Emilie Zech selbst hat ein schweres Schicksal. 1891 sterben wenige Tage nach der Geburt ihre Zwillinge Anna Martha und Martha Anna.48 Erst ein Junge namens Robert, den sie 1892 zur Welt bringt, überlebt und wächst in Briesen heran.
Paul fühlt sich in der kleinen Stadt nicht wohl, denn hier gibt es für ihn wenig Abwechslung. Während der Sommermonate geht er in seiner Freizeit an einen der drei Seen zum Baden und besucht die Vorstellungen eines gastierenden Zirkusses, wenn sein Geld für den Eintritt reicht. Das Gleiche gilt für ein besonderes Ereignis im Ablauf des Jahres, den Markt vor der evangelischen Kirche mit Händlern und Schaustellern, der Besucher von weither anlockt. Jedem Kind in der Stadt fällt es schwer, dort „seine paar Groschen […] in der Tasche zu behalten“, vermerkt Waldemar Heym.49 Ob der Heranwachsende deutsche Freunde hat, geht weder aus Briefen noch Büchern des Autors hervor. Ein Weggefährte späterer Tage behauptet: „Aufgewachsen unter polnischen Jungen, mit denen er sich am Briesener Schlossberg prügelte, liebt er diese Rasse nicht.“50
Nach eigenem Bekunden ist Zech ein schlechter Schüler. Andererseits behauptet er, Griechisch gelernt zu haben.51 Er erinnert sich sogar, wer ihn unterrichtet hat: „Dr. Thomas Siebenseit, der von der Quinta bis zur Untertertia mein Klassenlehrer war.“52 Auf das Gymnasium will er in Graudenz gegangen sein.53 Das ist Fiktion, wie die im Archiv der Stadt Grudziądz erhaltenen Schülerlisten der örtlichen Lehranstalten belegen. Paul besucht bis zu seiner Konfirmation in Briesen die Volksschule. Zwar gibt es am Ort auch eine private „Höhere Schule“, aber die führt nur bis zur Klasse II B.54 Abgesehen davon kann der Vater das Geld für eine solche Ausbildung seines Ältesten nicht aufbringen, denn die häusliche Not wird immer größer. 1894 bringt die Mutter einen weiteren Jungen zur Welt. Er erhält den Namen Gustav. Ein Jahr zuvor ist ein anderer Bub, Hermann Adolph, kurz nach der Taufe verstorben.
Paul erweist sich in Briesen wie schon zuvor in Müncheberg als schwieriges Kind, das jede Form von Autorität ablehnt. Der Lehrer führt beim Großvater Klage über dieses Verhalten, und der Opa prophezeit dem Enkel „ein schlimmes Ende“, falls er sich auch künftig so unbotmäßig verhalte.55 Am Ostersonntag 1895 wird der Vierzehnjährige konfirmiert, nachdem er am vorbereitenden Unterricht teilgenommen und Teile des Lutherischen Katechismus auswendig gelernt hat.56 Der Festgottesdienst findet in der evangelischen Kirche am Marktplatz statt, wo Pfarrer Weckwarth, der Paul schon getauft hat, noch immer Dienst tut. Vom Großvater bekommt der Enkel eine Taschenuhr: „… es ist eine richtige silberne Konfirmandenuhr“.57 Sorgfältig verwahrt er das Geschenk sein Leben lang, denn es trägt „die bemerkenswerte Jahreszahl meiner Konfirmation“.58
Nach dem Besuch der Volksschule muss Paul auf Wunsch der Eltern eine Lehre als Bäcker beginnen, bricht sie jedoch ab und plant, möglichst bald von zu Hause wegzulaufen.59 Ursache dafür ist vor allem sein gestörtes Verhältnis zum Vater: „Immer sprecht ihr von der Vaterstadt, vom Vaterhaus und der Vaterhand. Und das Bild dessen, den ihr eigentlich mehr gefürchtet habt als geliebt, steht vor eueren Augen“.60 Mehr Verständnis für den Heranwachsenden zeigt die Mutter, der er sich zuweilen anvertraut, die aber zu schwach ist, um sich für ihn gegen den Ehemann durchzusetzen.
Der Junge lebt häufig im Streit mit den Erwachsenen seiner Umgebung, unter ihnen der Großvater sowie der Lehrer. Ihn bedrücken die dumpfe Atmosphäre im Haus an der Schönseer Straße sowie die Zustände in Briesen allgemein: „mein brodelnder Nervensaft / wieherte auf wie hengstwitternde Stuten. / Da ward ich ein Sturm / der wütend durch Gitter pfiff / und Vaters Jähzorn schürte. / Und wurde doch immer geschwächt wie ein Wurm / unter Tritten und Griff, als ich mein Bündel schnürte.“61 Aus dem Gefühl der eigenen Ohnmacht heraus fasst er endgültig den Entschluss, fortzulaufen. Er will ins Ausland, damit ihn kein deutscher Gendarm festnehmen und zurück zu den Eltern befördern kann. Das Ziel für die geplante Flucht ist rasch gefunden.
Flucht in die Fremde
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts heuern in- und ausländische Firmen im Osten des Deutschen Reiches junge kräftige Männer an, die willens sind, im Bergbau gefährliche, kräftezehrende, ungesunde und schlecht bezahlte Arbeiten zu verrichten. Bevorzugtes Ziel für solche Werbefeldzüge ist das zwischen Russland, Österreich und Deutschland aufgeteilte Gebiet des ehemaligen Königreichs Polen. Einige Unternehmen zahlen an ostpreußische Gastwirte drei Mark Provision pro vermittelten Arbeiter.62 In Westpreußen geschieht Ähnliches. Hier lebt eine große Zahl junger Polen, die arbeitslos sind. Es bedarf keiner großen Überredungskünste, sie für eine Tätigkeit im Westen des Deutschen Reichs, in Belgien oder Frankreich zu gewinnen.
Paul sieht diese Angebote und erinnert sich seiner Kindertage in Müncheberg, wo er den Bergbau kennengelernt hat. Nun will er selbst als Kohlenhauer arbeiten. Ohne Abschied zu nehmen verlässt er um 1897 Eltern und Geschwister. Das Geld für eine Fahrkarte mit der Eisenbahn hat er längst zusammen: „Dann sind wir in den Zug gestiegen / und sahn die Heimat vorüberfliegen; / Felder und Scheuer, Dächer und Kirchturm, / Alle Wälder zerbrachen dem qualmenden Ansturm“.63 Dem Lauf der Weichsel folgend geht die Fahrt hundert Kilometer nach Norden: „Schon donnern Brücken eines fremden Stroms mit Schiff und Damm.“64 Der Germanist Josef Nadler schreibt in seiner völkischen Literaturgeschichte: „Paul Zech […], der als Jüngling im Eisenbahnzug dem Bürgertum in das Abenteuer entfloh“.65
In Danzig angekommen, möchte der Ausreißer am liebsten umkehren: „Da wir den Zug verließen / und auf dem Bahnhofsvorplatz / mitten in Auto- und Droschkenhatz / fremd auf wildfremde Menschen stießen, / o wie klein ward unser Abenteuern, / o wie groß das Verlassensein!“66 Er irrt durch die Straßen der Stadt, hin zu einem riesigen Industriegebiet mit Werften und Docks: „Da liegt der Hafen sinnlos grau und weit gestreckt. / Schlepper und Barken, Fähren, Segelschiffe / rauchmähnig und mit Flaggen bunt besteckt. / Und siebenstöckiger Speicher gleichgetünchte Front“.67 In einem anderen Gedicht, „Schiffswerft“, heißt es: „Wanderst Du stromaufwärts den Hafen entlang, / o, wie das dröhnt und stöhnt: Walzwerk und Werften, / Schornsteine und Schienen, Schuppen mit verschärften / Maschinen mitten in dem mörderischen Chorgesang.“68 Der Minderjährige heuert auf einem Frachter als Schiffsheizer an. Wie in vielen Häfen der Welt sind auch in Danzig fehlende Personalpapiere für manchen Kapitän kein Hinderungsgrund, einen jungen Mann an Bord zu nehmen, der bereit ist, Schwerstarbeit zu leisten. Zech muss in der Tiefe des Schiffes bei glühender Hitze Koks in die riesigen Feuerungslöcher der Öfen schaufeln. Das bedeutet für den nur einen Meter sechzig großen Heranwachsenden eine Überforderung, die ihm lebenslang gesundheitlich zu schaffen macht. Der Frondienst wird in seinen späteren Werken mehrfach erwähnt. Im Roman „Kinder vom Paraná“ findet sich der Vergleich: „… wie der Glutatem aus dem riesigen Feuerloch eines Dampfkessels“.69 Über die Ostsee, den Kaiser-Wilhelm-Kanal und die Nordsee gelangt Zech nach Holland und geht in Rotterdam von Bord: „Ein Franzose (breitschultriger Bretone) spricht mich an. Ist Steuermann und will Ersatz für den entlaufenen Schiffskoch heuern. Einen Monat früher: ich hätte zugepackt!“70 Er bleibt jedoch an Land und besucht die Kneipen im Hafen, wo er mit den dort verkehrenden Damen Bekanntschaft schließt: „Da presst sich lüstern der Javaner an die kleine / geschminkte Esther aus der Judenkolonie. / Mynheer van Delft küßt frech die dänische Marie / und Jack, das Negerlein, beäugt Luisens Beine.“71
Zech genießt die neue Freiheit, bis ihm das Geld ausgeht. Dann ist er gezwungen, als Lastenträger zu arbeiten. Stefan Zweig vertraut er später an, er habe „in Rotterdam Kulidienste“ geleistet.72 Das ist ihm schnell lästig. Zudem muss er sich hüten, in eine Polizeikontrolle zu geraten, denn ihm fehlen gültige Papiere. Weiterhin hält er an seinem Plan fest, im Bergbau Geld zu verdienen und heuert auf einem Schiff an, das ihn nach Belgien bringt. In Antwerpen treibt er sich erneut in der Hafengegend herum und lässt sich mit Huren ein. In „Sackträgerin“ schildert er seine nächtlichen Erlebnisse: „ein Blutjunger schlich in das Haus /der Trägerin, auf dass sie nicht entrönne / und auch kein anderer sie zuerst gewönne. / Er blieb darin bis ein Strauß / Purpurner Rosen alle Giebel krönte /und trug ein Glück mit fort, das seinen Tag verschönte.“73
Auch in dieser Stadt hält es den Abenteurer nicht lange. Er schlägt sich zum Kohlerevier südlich von Brüssel durch. Als Hilfskraft findet er in Charleroi unter Tage eine Arbeit, die ihn wieder überfordert. Da die Stollen im Bergwerk zu niedrig sind, um sich aufrecht fortzubewegen, muss er kniend oder in gebückter Haltung Körbe mit Kohle bis zu den Stellen ziehen, an denen Gleise für Loren verlegt sind. Diesen Lebensabschnitt schildert er in „Rue St. Jacques“. Das ist eine Straße im industriell geprägten Stadtteil Mont-sur-Marchienne.74 Hier haust er für „acht Franken die Woche“ bei einer „Madame Romain“, von der er außer einer Bettstatt täglich eine warme Mahlzeit erhält. In der Nähe seiner Unterkunft befindet sich auch der Schacht, in den er einfährt.
Zu Anfang der Novelle findet sich eine Zeitangabe: „Sieben Monate diese Straße, diese Stadt –: abzuschildern Grund genug“. Beschrieben wird die düster-rußige Montanregion von Mont-sur-Marchienne mit ihren Gruben, Fördertürmen, Hochöfen, Kupferschmelzen und Eisenwalzwerken. Dabei geht Zech auch auf die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen ein, unter denen der Kohletransport sowie die Produktion von Stahl und Kupferblech erfolgen. Die fragwürdigen Vergnügungen, denen sich die Arbeiter nach Feierabend hingeben, finden ebenfalls Erwähnung. Dem Text liegt eine gründliche Ortskenntnis von Charleroi zugrunde. Der Verlauf einer Bahnlinie, die unweit von Zechs Behausung in der Industriezone eine lange Kurve macht, wird exakt beschrieben und die Kreuzung der Rue St. Jacques, an der er sich täglich aufhält, skizziert er mit den Worten: „Eine Zentrale […] mit Gassenausläufern nach vier Seiten“. Das Straßenbild bleibt unverändert bis ins 21. Jahrhundert erhalten, drei Verkehrsampeln ausgenommen.
Den Arbeitsalltag unter Tage schildert Zech auch in der Erzählung „Das Bergwerk“, deren Untertitel lautet: „Erlebnisse eines armen Grubenarbeiters namens Falkenberge“.75 Darin werde „die düstere Welt eines Bergwerks aufgezeigt. Und zwar in einer Grube, wie sie vor zwanzig Jahren in Belgien so und nicht anders aussah“.76 Auch in diesem Text erfährt der Leser von den unwürdigen und unhygienischen Zuständen in einer Unterkunft für Arbeiter. Mit Worten werden die vielfältigen akustischen Eindrücke im Schacht dargestellt: das Dröhnen der Koksbrecher, das Sausen der Förderkörbe, das Poltern der Kippwagen und die nicht zu überhörende Stille. Zech zeigt sich vertraut mit Fachausdrücken der Kohleförderung wie „Seilschläger“, „Schießmeister“, „Förderschale“ und „Sprengherd“. Viele seiner Gedichte enthalten Begriffe, die auf Erlebnisse in Charleroi zurückgehen. „Förderschächte und Schlot an Schlot“ heißt es in „Der Stahlgott Vulkan“. Zwei weitere Produktionsstätten der Stadt werden in „Kanalfahrt“ benannt: Walzwerke und Zinnschmelzen.77
Das Industriegebiet von Charleroi
Rue St. Jaques in Mont-sur-Marchienne bei Charleroi
Trotz täglicher Schwerarbeit unter Tage bringt Zech den Willen zur Lektüre von Büchern auf. Eine Glückwunschadresse an Thomas Mann aus dem Jahr 1945 enthält den Satz: „Als Sie Ihren dreißigsten Geburtstag begingen […] las ich, unter der flackernden Gasflamme eines Proletarierquartiers im Borinage, den Band ‚Tristan‘.“78 Um 1900 liest Zech weder den „Tristan“ noch ein anderes Werk von Thomas Mann, aber das Bild von der nächtlichen Lektüre bei Gasbeleuchtung spiegelt die Wirklichkeit seiner Erlebnisse in Belgien.
Stefan Zweig nennt er eine weitere Stadt, in der er unter Tage gewesen sein will: „Ich glaube, dass ich Ihnen schon einmal schrieb, wie ich in Charleroi und in Mons in den Bergwerken gearbeitet habe.“79 Auf die Frage nach der Dauer gibt er voneinander abweichende Hinweise. Der Wahrheit am nächsten kommt eine Bemerkung Zechs aus dem Exil: „Ein Jahr. Bloß [= Nur] herumgekrochen. Aber das hat ausgereicht …“80 Legt man der Berechnung seiner Tätigkeit als Bergarbeiter dieses eine Jahr zugrunde und bezieht die von ihm selbst genannten „sieben Monate“ der Arbeit in Mont-sur-Marchienne ein, verbleiben fünf Monate, die er anderwärts unter Tage gearbeitet hat.
Ab 1898 durchstreift Zech das Borinage, ein Industriegebiet rund um Mons, und kommt auch nach Frankreich, nach Charleville. Es wird ihm „dorniges Idyll eines Sommermonats“. Der Bericht darüber zeugt gleichfalls von guter Ortskenntnis: „Öfen sind da. Mit breiten Feuerbäuchen. Auf der Seite nach Mézieres zu lungern die Kostgeber. Sie borgen drei Wochen Matratze und dünnen Rotwein.“ Mehrfach schildert der Verfasser die ortsansässige Schwerindustrie: ein Eisenwerk, das seine Erzeugnisse bis nach Afrika liefert, und ein Walzwerk. Er erwähnt eine Ziegelei und das in der Umgebung gelegene Kloster Signy. Ferner beschreibt er den städtischen Alltag, den Betrieb in den Kneipen, in der Singspielhalle sowie in den Kaufhäusern. Auch etliche Aufenthalte im Bordell findet er der Erwähnung wert.81
Eines der Gedichte, die Zech rückblickend auf Charleville verfasst, trägt den Titel „Unter den Hochöfen“.82 Er arbeitet nochmals als Kesselheizer, jedoch nicht „um 1909“, wie es in diesem Text heißt, sondern vor der Jahrhundertwende. Noch im Exil macht er die Arbeit in Belgien und Frankreich zum Thema einer Kurzgeschichte. Sie handelt von einem jungen Mann, der vor den Hochöfen glühende Schlacke in Loren verladen muss, „die Kehle voller Ärger über so eine gottverfluchte Sklaverei“. Er heißt Tamm Boom. Der Name ähnelt nicht zufällig „Timm Borah“, einem der vielen Pseudonyme Zechs. Boom, ein Hilfsarbeiter, erinnert sich einer freudlosen Jugend auf dem Land, der Arbeit auf den Feldern, kindlicher Sünden wie dem Rauchen von Kartoffelkraut, alles Begebenheiten, die vor 1898 im Leben des Erzählers stattgefunden haben. Wörtlich beklagt er, „dass der Mensch sich vor den Hochöfen grauenhaft bücken muss: zehn Stunden in einer Tour scharwerken“.83
Zech kann diese Schwerstarbeit nicht länger aushalten. Wahrheitsgemäß bekennt er später, sein Versuch, als „Kohlenhauer unter Kohlenhauern“ zu arbeiten, sei gescheitert.84 Erschöpft verlässt er Frankreich und schlägt sich über Belgien nach Holland durch. Da ihm das Geld für ein „Billet“ fehlt, reist er als „blinder Passagier“ mit der Eisenbahn. Aufschluss darüber gibt sein Theaterstück „Windjacke“. Es trägt den doppeldeutigen Untertitel „Tragödie einer Jugend von Paul Zech“, und zeigt das kurze Leben eines Vagabunden, der in die bürgerliche Gesellschaft zurückfinden will.85 Klaus, ein junger Arbeitsloser, wird wegen Landstreicherei festgenommen, kommt zwei Jahre in Fürsorgeerziehung, findet anschließend Arbeit, verliert diese aber wieder, als seine Vergangenheit bekannt wird. Schließlich versucht er erfolglos, nach Amerika auszuwandern. Aus Geldmangel fährt er auf den Dächern der Waggons von Güterzügen.
Eine Stadt, in der Zech auf seiner Reise Station macht, ist Utrecht. Hier will er Ohm Krüger sehen, den im Exil lebenden Präsidenten der Republik Transvaal. Dazu harrt er drei Tage vergeblich vor dessen Palast aus. Beim Warten beobachtet er: „Auf dem Schieferdach hing schlapp die Fahne von Transvaal“.86 Das ist eine Angabe, anhand derer sich dieser Aufenthalt zeitlich fixieren lässt. Die Fahne wird im Juni 1902 letztmals gehisst. Da sich der Rückkehrer ab 1901 wieder in Deutschland befindet, kann er sie nur in der Zeit davor gesehen haben. Von Holland aus gelangt er schließlich nach Deutschland in die Gegend von Köln.
Heim nach Deutschland!
In einer biographischen Notiz behauptet Zech: „Im Jahre 1899 siedelten wir nach Elberfeld über und hier bin ich nun ununterbrochen wohnhaft.“87 Mit „wir“ sind seine Eltern gemeint, die angeblich mit ihm zusammen von Lüneburg ins Bergische Land umziehen. Das ist frei erfunden, aber die Zeitspanne der Jahre 1899 und 1900, in deren Verlauf sich der Rückkehrer aus Frankreich, Belgien und Holland im Tal der Wupper niederlässt, passt zu den gesicherten Fakten seines Lebenslaufs. Bestätigung erfährt die Datierung durch den Schriftsteller Kurt Erich Meurer, in dessen Aufzeichnungen es heißt: „Notiert sei nur, dass Paul Zech […] in frühen Jahren in die Rheingegend kam [und] Elberfeld als seine zweite Heimat für sich entdeckte“.88
Einige Zeit lebt Zech in Köln. Das geht aus Passagen hervor, die in der Erzählung „Die Mutterstadt“ enthalten sind. Diesen Text veröffentlicht er erstmals unter dem Pseudonym „Werner Pütt“, einem sprechenden Namen, denn Bergwerke heißen in rheinischer Mundart „Pütt“. Geschildert wird, wie ein Heranwachsender namens Andreas Wülfing nach dem Tod der Mutter in Köln sein Erbe für Schnaps und im Bordell ausgibt, bis er ein Mädchen namens Lena kennenlernt. Sie verliebt sich in ihn und ist um seine Rettung bemüht. Deshalb will sie ihn aus der Großstadt weglocken: „Hier am Rhein ist‘s nicht so schön wie bei uns im Bergischen.“89 Lena spricht aus, was Zech empfindet. Der erfährt um 1900 die Großstadt und das Bergische Land als gegensätzliche Lebenswelten. Die eine stößt ihn ab, in der anderen fühlt er sich geborgen. Diesen Gegensatz gestaltet er später auch im Roman „Peregrins Heimkehr“. Dessen Titelfigur lebt eine Zeit lang in Köln, wird aber dort nicht heimisch.90
Zech zieht weiter ins Wuppertal. Da ihm die Gegend gefällt, entschließt er sich, zu bleiben. Eigenen Angaben zufolge steht er 1901 in Barmen „bei Molinäus sechs Wochen vor den Kesselfeuern“.91 Mehrere Texte enthalten jedoch Hinweise auf einen anderen Arbeitgeber. Im Gedicht „Heimat“ heißt es: „Als ich in Farbfabriken schuf, in Kohleschächten, / war ich ein Fremder, eine aufnotierte Zahl“.92 Rudolf Hartig vertraut er später an: „Ursprünglich Schreiber, dann Arbeiter in Gruben, Hafenstädten und Farbfabriken.“93 Der Theologe Gustav Würtenberg erfährt von ihm: „Ich […] stand am Rührwerk in den Giftbuden der Farbenfabriken“.94 Zechs Beschreibung des Elberfelder Originals August Kallenbach enthält den Satz: „Die Mutter war in den Sielen geblieben; als Packerin in der Chemischen Fabrik.“95 Der knapp zwanzigjährige Rückkehrer arbeitet bei „Friedrich Bayers Farbenfabriken“ als Packer und Lagerist. Diese Berufsangabe findet sich 1904 in seiner Heiratsurkunde. Das Chemie-Unternehmen ist 1863 in Barmen gegründet und drei Jahre später nach Elberfeld verlegt worden. Im Wuppertal herrscht dank „Bayer“ um die Jahrhundertwende Vollbeschäftigung.
Der vormalige Bergwerksgehilfe und Kesselheizer übt nun eine Tätigkeit aus, die weniger an seinen Kräften zehrt als die Plackerei unter Tage oder an den Feueröfen, doch auch bei Bayer gibt es gesundheitsschädliche Arbeitsplätze. Ungeschönte Bilder von solchen Zuständen zeichnet Zech später mit Worten im Gedicht „Männer in der Farbenfabrik“: „Es dampft der Chlor, es spritzt die Säure aus den Kannen. / Sie hocken mit dem Rührwerk auf den engen Dämmen / und sind von dem Gebrodel in den Kupferpfannen / schon so benommen, wie die Fliegen an den Wänden.“ Was Zech beschreibt, kennt er aus unmittelbarer Anschauung: „Von ihren Schädeln hängen die verfilzten Strähnen / so grün herab, wie Zweige von den Trauerweiden. / Sie haben kaum noch eine helle Stelle an den Zähnen / und lassen sich auch die Geschwüre nicht mehr schneiden, / die auf dem Nacken wuchern“.96 Zech ist klug genug, bei Bayer keine Tätigkeit in der Produktion anzunehmen. Er gibt sich mit einer weniger gut bezahlten Stelle zufrieden, ruiniert deshalb nicht weiter seine Gesundheit und muss die ihm verbleibende kärgliche Freizeit nicht mehr ausschließlich dazu nutzen, neue Kräfte zu sammeln.
Das Wuppertal bietet dem Neuankömmling vieles, was ihn beeindruckt. In Elberfeld, um die Jahrhundertwende eine Großstadt von knapp 160 000 Einwohnern, ist vor kurzem eine prunkvolle Stadthalle im Stil der Neorenaissance fertiggestellt worden. Staunend steht er auch vor riesigen Stahlträgern, die entlang der Wupper Fluss und Straßen überspannen. Es sind Teile der im Entstehen begriffenen, weltweit einzigartigen Schwebebahn. Schon im Oktober 1900 hat Kaiser Wilhelm II. eine Probefahrt mit diesem Wunderwerk der Technik unternommen und in Elberfeld ein neues Rathaus sowie in Barmen die „Ruhmeshalle“ eingeweiht. Schriftliche Zeugnisse Zechs aus dieser Zeit gibt es nur zu seinem Privatleben. Da ihn schon von Kindheit an Jahrmärkte faszinieren, fährt er in die Nachbarstadt Schwelm, als dort ein „Rummel“ stattfindet. Zwischen Kirmesbuden, Karussells und einem Kasperletheater schließt er Bekanntschaft mit einem Mädchen, das sich auf dem Nachhauseweg von ihm küssen lässt: „Wir waren noch so kinderjung. Ihr Mund schmeckte wie eine Haselnuß. […] Ich fuhr noch ein dutzendmal herüber, um Haselnüsse zu pflücken“, schwärmt er erinnerungsselig noch im Exil von diesem Erlebnis.97
Einige Zeit später lernt Zech ein Mädchen aus Barmen kennen. Im Feuilleton „Zwei Rosen“ liest sich das so: Ein Schriftsteller mittleren Alters kommt nach Jahren wieder mit einem Freund aus Studienzeiten zusammen. Dieser ist inzwischen Arzt und verheiratet. Seine Ehefrau heißt Else. Als der Autor ihr gegenübersteht, wird beiden klar: sie haben sich vor langer Zeit einmal geliebt und danach nie mehr wieder gesehen.98 In welcher Stadt das geschehen ist und wer das Vorbild für die junge Dame abgibt, geht aus einem Brief von Dr. Aloys Buschmann hervor, der zu Anfang des Jahrhunderts im Wuppertal lebt. Bei ihm handelt es sich nicht um einen Mediziner, sondern um einen Journalisten. Nachmals berichtet er einem Bekannten: „Paul Zech […] hatte meiner Paula in Barmen sehr nahe gestanden.“99 Zwischen der späteren Gattin Buschmanns und dem bei Bayer tätigen Lageristen entwickelt sich zu Anfang des Jahrhunderts eine intensive Liebesbeziehung. Als Zech 1912 sein Feuilleton „Zwei Rosen“ veröffentlicht, verlegt er den Schauplatz des Geschehens nach Niedersachsen, denn bei „Else“ handelt es sich um Paula Rehse, die Tochter von Karl Friedrich und Berta Rehse, einem Ehepaar, das in Barmen einen Kolonialwarenladen betreibt, und auch Buschmann wohnt zu dieser Zeit noch immer in dieser Stadt.
Nach 1900 erregen im Wuppertal zwei Skandale die Gemüter der Bevölkerung. Den ersten verursacht Ludwig Fahrenkrog, ein bildender Künstler, der an der Kunstgewerbeschule Barmen Malerei lehrt und als Verkünder einer deutsch-völkischen Bewegung Aufsehen erregt.100 Seine Anschauungen sind vom Lebenskult und von einer Rassenideologie geprägt, die das Christentum ablehnt. In der neuen „Ruhmeshalle“ zeigt er Gemälde und Grafiken, mit denen aller Welt der germanische Götterglaube nahegebracht werden soll. Unter den Bildern erschreckt das eines bartlosen, völkisch-heldenhaften „Jesus von Nazareth“ mit Gesichtszügen des Lichtgottes Baldur die Besucher, was in der Öffentlichkeit heftige Proteststürme auslöst. Da Zech als Kind von Mutter und Großmutter im christlichen Glauben erzogen worden ist, interessiert er sich für religiöse Themen, während er die Kirche als Institution ablehnt. Er besucht die Ausstellung. Was er dort sieht, gefällt ihm, und er hat den Wunsch, den Künstler persönlich kennenzulernen. Das gelingt ihm nach kurzer Zeit, denn dieser schart Jünger um sich. In den folgenden Jahren macht sich Zech einen Großteil von Fahrenkrogs Anschauungen zu eigen.
Wichtige Elemente des Lebenskultes bilden die Begriffe „Erde“ und „Blut“. Bei der Gestaltung menschlichen Daseins soll gemäß dieser Lehre dem „Gefühl“ Vorrang vor dem „Verstand“ gegeben werden. Autoritäten sind Nietzsche, Bergson und Simmel. Zech vertieft sich in die Werke dieser Philosophen und übernimmt aus ihnen Schlagworte wie „Stein“, „Krankheit“ oder „Tier“ in seine Vorstellungswelt. Der Lebenskult bewahrt ihn allerdings nicht vor Enttäuschungen im Alltag. Als Vater Rehse, der gleichfalls zu den Anhängern Fahrenkrogs gehört und inzwischen zum Fabrikanten avanciert ist, vom Verhältnis seiner Tochter mit einem dahergelaufenen Habenichts erfährt, verbietet er Paula den Umgang mit dem Lageristen. Die frühe Barmer Version der „Legende von Paul und Paula“ nimmt aufgrund des Machtwortes von Vater Rehse ein jähes Ende.
Der zweite aufsehenerregende Skandal ereignet sich anlässlich der festlichen Übergabe eines Kunstwerks an die Elberfelder Bevölkerung im September 1901. Die Affäre hat folgenden Hintergrund: Auf der Spitze eines vor dem Rathaus neu errichteten Brunnens steht überlebensgroß das steinerne Abbild des römischen Gottes Neptun. Zu seinen Füßen räkeln sich Putten und Tritonen. Der Unternehmer August Freiherr von der Heydt hat die Auftragsarbeit bezahlt. Das Werk soll im Rahmen eines Festaktes enthüllt werden. Zur Vorbereitung der Zeremonie entfernen Bauarbeiter wenige Tage zuvor Planen, die die Statue bis dahin den Blicken der Vorübergehenden entzogen haben.
Als Neptun und weitere Gestalteten aus Stein ohne das übliche Feigenblatt sichtbar sind, überschlagen sich die Ereignisse. Kirchliche Würdenträger und weltliche Moralapostel geben lautstark ihrer sittlichen Empörung über die Verletzung des guten Geschmacks Ausdruck, Protestversammlungen werden abgehalten, polemische Verlautbarungen gegen Künstler und Mäzen kommen in Umlauf und anonyme Briefe werden verschickt. Ein radikaler Gegner der anstößigen Blößen belässt es nicht bei Worten, sondern geht nachts mit Hammer und Meißel gegen die Nackten auf dem Neumarkt vor. Zwei der Figuren werden „entmannt“. Das empört den Elberfelder Schriftsteller Walter Bloem. Ad hoc verurteilt er in der Presse den Kunstfrevel und Jahre später schreibt er das Stück „Der Jubiläumsbrunnen“, in dem die Kunstbanausen seiner Vaterstadt der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Zech verkehrt diesen Protest schriftlich ins Gegenteil, indem er den Kollegen in die Schar derer einreiht, die das Kunstwerk ablehnen: „Von Walter Bloem, dem geschmeidigen Schriftsteller, wussten die Buchhändler um den Neumarkt herum, dass er den Jubiläumsbrunnen angestunken hatte.“101
In Belgien hat Zech seine Liebe zur schönen Literatur entdeckt. Jetzt beginnt er, selbst Verse zu schreiben. Einige davon sind erhalten. Der junge Mann preist die Schönheit der Natur und beschreibt sein Liebesleben. Auch dem jungen Mädchen von der Schwelmer Kirmes und Paula aus Barmen widmet er Gedichte. Allerdings fehlt jeweils eine genaue Zuschreibung oder Widmung. Anders verhält es sich mit den Versen für seine neue Liebe. Sie heißt Helene Siemon, ist 16 Jahre alt und die Tochter eines schon vor Jahren verstorbenen Schuhmachers aus Rotenburg an der Fulda. Die Heranwachsende wohnt zusammen mit ihrer Mutter Dorothea und einer vier Jahre jüngeren Schwester Julia im zweiten Stock eines Elberfelder Mietshauses in der Hatzenbecker Straße 26.
Lebenslang verwahrt Helene Erinnerungsstücke aus den Jahren, als sie ihren Paul kennengelernt hat, darunter ein „Poesiealbum“ mit dem Titel “Gedenke mein“, das ausschließlich Eintragungen von der Hand Zechs aufweist. Das Büchlein zeigt, wie schwer sich der angehende Schriftsteller anfänglich mit der deutschen Sprache tut und welche literarischen Vorlieben er besitzt, ungeachtet deren Qualität. Es enthält Liebesschwüre, Gelegenheitsgedichte, Lobpreisungen der Natur, handwerkliche Anfänge des künftigen Autors. Die Texte belegen, wie ein junger Mensch, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, weder einen Schulabschluss noch eine berufliche Ausbildung besitzt, nach Bildung, Bestätigung und Anerkennung trachtet. Enthalten sind in diesem Album Verse, die er selbst verfasst hat und eine Anzahl von Gedichten anderer Autoren. Seine eigenen Gedichte erweisen sich als Versuche, menschliche Gefühle in Poesie zu kleiden und lassen noch nichts vom späteren Können des Verfassers ahnen. Was die Einträge unabhängig von ihrer literarischen Qualität wertvoll macht, sind Datierungen und Ortsangaben, aus denen hervorgeht, wie Zechs Leben nun verläuft.102
Das „Briesener Kreisblatt“ veröffentlicht im Januar 1901 eine von Bürgermeister Gostomski unterzeichnete Bekanntmachung der örtlichen Polizeibehörde, in der Wehrpflichtige des Jahrganges 1881 aufgefordert werden, sich persönlich oder schriftlich auf dem Rathaus zu melden.103 Der Appell gilt auch für alle Betroffenen, die sich außerhalb der Stadt aufhalten. Emilie Zech leitet diese Bekanntmachung an ihren Sohn weiter, denn Pauls Verbindung zu ihr ist nie völlig abgebrochen. Das zeigt die Wahl des Vornamens, den die Mutter ihrem letzten Kind gibt. Sie nennt das Mädchen nicht zufällig Helene, doch ist es ihr ein weiteres Mal nicht vergönnt, das Neugeborene behalten zu dürfen. Der Säugling stirbt im ersten Halbjahr 1901. Kurz nach der Geburt verschieden sind schon 1899 die Zwillinge Hans und Grete. Überlebt hat die 1897 zur Welt gekommene jüngste Schwester Ida. In Briesen sind die Lebensbedingungen nicht viel besser geworden. Gleiches gilt für die soziale Lage der Familie Zech. Die Seilerbahn auf städtischem Grund hat einem „Luxuspferdemarkt“ weichen müssen. Das Gelände ist den Betreibern von der Kommune kostenlos überlassen worden, um das Wirtschaftsleben anzukurbeln.
Über eine Musterung Zechs liegt in deutschen Militärarchiven kein Dokument vor. Möglicherweise wird er wegen der nervösen Störungen, unter denen er bisweilen leidet, als „nicht tauglich“ befunden, oder ihm bleibt eine militärische Ausbildung deshalb erspart, weil er auf Befragen Fälle von Geisteskrankheit in seiner Familie einräumt. Da ihm keine Einberufung zugeht, lebt er unbekümmert seiner Liebe und verleiht ihr in Gedichten Ausdruck. Zehn über das Jahr 1901 verteilte Einträge in Helenes Album zeigen, wie sich die Beziehung der beiden entwickelt. Im März zitiert Paul ein Gedicht „Junge Liebe!“: „Es muss ein wundersames Leben / Ums lieben zweier Seelen sein […]“, wobei ihm die Groß- und Kleinschreibung erkennbar Schwierigkeiten bereitet. Im Mai geht es ums Küssen. Allerdings belässt er es in der Überschrift bei drei Gedankenstrichen: „An – – –“, wenn er die Frage aufwirft, mit wem geküsst werden soll. Zum Wonnemonat wird für das Paar der September. Paul schreibt ein dreistrophiges Gedicht, dessen Überschrift für ihn Programm ist: „Dein Herz soll meine Heimat sein!“ Daraufhin gibt die Geliebte seinem Werben nach. Was folgt, hält Paul „Zur Erinnerung an den unvergeßlichen 6. September 1901“ in Versen fest: „Wir gingen beide nach Hause allein […]. Da hast Du mir schluchzend Dein Lieben bekannt.“ Drei Tage später verfasst er nach einem Spaziergang mit Helene auf der Elberfelder „Königshöhe“ ein Gedicht von sieben Strophen, das „Dem Heideblümchen gewidmet“ ist.
Die Beziehung der beiden wird in den nächsten Monaten noch enger. Mit den Versen „Vergebens“ schildert er seine nächtliche Rückkehr am 9. Februar 1902 von Helenes Wohnung zur eigenen Unterkunft: „Ich wandle wie im Traum nach Haus, / Der Regen peitscht mir ins Gesicht. […] / Der Schlüssel knarrt, es kreischt die Thür / […] Das ganze Haus ist so kalt und stumm, / Am liebsten kehrt ich wieder um!“104 Einen Tag vor Vollendung seines 21. Lebensjahres entwickelt er literarischen Ehrgeiz und verfasst zwei Strophen einer Liebeserklärung, bei denen die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Worte am Zeilenbeginn von oben nach unten gelesen die Vornamen der Geliebten ergeben: „Helene“ und „Maria“.
Anfang März 1902 zieht Zech von Elberfeld nach Barmen um in die Oberdörner Straße 103. Das Anwesen grenzt an eine Straße, die „Schafbrücke“ heißt und zum gleichnamigen Bauwerk über die Wupper führt. Der Fluss fasziniert den jungen Mann. Noch im Exil beschreibt er ihn: „Wenn man von der rheinischwestfälischen Stadt Elberfeld spricht, wird man wohl selten vergessen, die Wupper zu erwähnen.“105 Mit Worten malt er den Anblick aus, der sich bietet, wenn Bleichereien, Färbereien, Kattundruckereien und die Farbenfabriken Bayer ihre Abwässer in den Fluss leiten. Auch kritisiert er die rückständige Art, wie Gülle auf diese Weise entsorgt wird. Das hat er schon in Briesen so gesehen.
Im April befindet sich Helene mit ihrer Schwester zu Besuch bei Verwandten in Cusel und teilt Paul scherzend mit, nie mehr nach Elberfeld zurückkommen zu wollen. Der Geneckte eilt zur künftigen Schwiegermutter, fragt, wie sich die Sache verhalte und erfährt die Wahrheit. Nachdrücklich fordert er die Liebste auf: „befleißige Dich, bald in unser bergisch Land einzuziehen […]. Die Hauptsache ist, wir sehen uns bald wieder, dann ist für mich auch ein froher Sonnenschein und Frühlingstag.“ Seiner Unterschrift folgen die Verse „Wenn Du die goldnen Sterne / Am Himmelsdome siehst, / Dann denk, dass in der Ferne / Ein liebend Herz Dich grüßt.“106
Heroin und Studium
Ende August teilt Paul Helene mit: „Konnte leider heute Abend nicht kommen. Hatten zuviel in Bestellung und wurden erst um halb neun fertig. Ehe ich rüber kam, wäre es dann zehn Uhr geworden“.107 Ein Blick in die Firmengeschichte seines Arbeitgebers gibt Aufschluss, weshalb er Überstunden machen muss. Auf der Düsseldorfer Gewerbe- und Industrieausstellung von 1902 zeigen die Farbenfabriken Bayer eine Dokumentation ihrer Wohlfahrtseinrichtungen. Im zugehörigen Katalog heißt es: „Die Firma betreibt die Fabrikation und den Verkauf aller Arten von Theerfarbstoffen, von pharmazeutischen Produkten und chemisch photografischen Artikeln“.108 Unter diesen Produkten befindet sich auch „Heroin“. Bayer hat den Namen und ein „Verfahren zur Synthese von Diacetylmorphin“ patentrechtlich schützen lassen. Es sei als Mittel gegen Schmerzen ein „nicht süchtig machendes Medikament“, das bei Husten, Bluthochdruck, Lungen- und Herzerkrankungen helfe sowie bei der Geburts- und Narkoseeinleitung gute Dienste leiste. Das Produkt wird mit hohem finanziellen Aufwand beworben, weshalb sich das Elberfelder Werk vor Bestellungen kaum retten kann und die Mitarbeiter des Zentrallagers, unter ihnen Zech, bis in die Nachtstunden arbeiten müssen.
Pauls Einträge in Helenes Poesiealbum erwecken auf den ersten Blick den Eindruck einer zwei Jahre lang harmonisch wachsenden Beziehung. Der ist falsch, wie einige Verse verraten. Es mangelt in der Verbindung nicht an Krisen. Die Siebzehnjährige hat Grund, an der Liebe ihres Partners zu zweifeln, denn ihr ist hinterbracht worden, er habe sich mit anderen Mädchen in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie lässt ihn wissen: „Ich traue Dir nicht mehr!“, was der Beschuldigte zum Thema eines Gedichtes macht. In seiner Rechtfertigung fordert er Helene auf: „Glaube nicht den fremden Leuten“ und „Siehst Du mich mit andern gehen […] Sieh mein Aug, ich liebe Dich!“ Mittels gereimter Liebesschwüre gelingt es ihm, Helene zu versöhnen. Erleichtert seufzt er: „Nun hab ich Ruhe wieder […] / Die Zweifel sind vorüber / ich wüßt auch nicht, woran es lag“.109 Der Konflikt scheint überwunden, doch ungeachtet aller Liebesbekundungen ist es mit Pauls Zuneigung nicht sonderlich gut bestellt. In einer Ankündigung, die Freundin am Sonntag zum Spaziergang abzuholen, schreibt er barsch: „[…] hoffe dass Du dann fertig bist“. Er will sie einem Bekannten vorstellen: „Jedenfalls machst Du mir keinen Strich durch die Rechnung!“ Das Paar hat offenbar nur wenige gemeinsame Themen, über die es sich austauschen kann: „Sonst wüßte ich nichts wissenswertes an Dich zu schreiben, da meine Briefe Dir in der Regel nicht besonders willkommen sind.“110
Bei einigen Gedichten ist im Album vermerkt, von wem sie stammen: Goethe, Heine, Chamisso und weitere Dichter von Rang. Daneben tauchen längst vergessene Autoren auf, beispielsweise Emil Rittershaus, der zu Zechs frühen Vorbildern zählt. Jahre später urteilt er über ihn: „die Wuppertaler Dichter von Rittershaus bis Werner Jansen haben die Deutsche Literatur verspießbürgerlicht“.111 Ähnlich ergeht es Carl Siebel, der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Lyrikanthologie herausgegeben hat.112 Darüber hinaus liest der Lagerist eine Vielzahl schöngeistiger Bücher und versucht, sich allgemein weiterzubilden. Das geschieht hauptsächlich nachts, denn am Tage muss er Geld verdienen. Weil er so viele Bücher von seinem kargen Lohn nicht kaufen kann, leiht er sie in Bibliotheken und von Bekannten aus. Zuweilen vergisst er mehr oder minder absichtlich die Rückgabe.
Mit den datierten Einträgen führt Helenes Poesie-Album eine Jahrzehnte später verbreitete Legende ad absurdum, Zech habe sich 1902 im belgischen Braine-le-Comte aufgehalten, um dort mit einer Dissertation über das Thema „Wege und Umwege der deutschen Schriftsprache“ zu promovieren.113
Ein Studium besonderer Art absolviert Zech bei Ludwig Fahrenkrog, den er als seinen Lehrer betrachtet. Der Künstler „gehört zu einer der ersten Generationen derjenigen Intellektuellen, in deren Denken sich die ideengeschichtlichen Grundlagen des Nationalsozialismus […] vorbereiten und ausformen“.114 Er will seine Mitmenschen von der Bürde eines Christentums erlösen, das auf dem Judentum gründet, und ihnen durch völkisches Gedankengut zu einer neuen religiösen Freiheit verhelfen. Im Bereich der Bildenden Kunst lehnt er sowohl die Malerei des Kaiserreichs als auch die der Moderne ab. Sein Ziel ist die Wiederbelebung des Germanentums. Vorrangig beschäftigt er sich mit der Gestalt des von Gott abgefallenen Engels Luzifer. Wie ein Menetekel muten Fahrenkrogs Verse an: „Ich mag euere dunkle Kirche nicht! […] Ich liebe das Leben, die Freude, das Licht / Und das Blut, wenn es sprudelt und rot ist.“ Diesem Gedicht gibt er den Titel „Jedem das Seine“, eine demagogische Inanspruchnahme der klassischen Rechtsformel „suum cuique“, die später auch als Inschrift des Eingangstores am Lager Buchenwald missbraucht wird.115 Derartige Anschauungen teilt der Schüler zumindest teilweise. In seinem Gedicht „Mondnacht im Tal“ feiert Frau Holle als germanische Mythenfigur „Frau Holde“ fröhliche Urständ‘: „Der Fluss rauscht fern und dunkel / Frau Holde tanzt wunderbar. / Die Winde stehn still vor Staunen / Und duften wie Frauenhaar.“116
An Wochenenden nutzt Zech jede Minute seiner freien Zeit, um alleine oder in Helenes Begleitung die Umgebung von Elberfeld und Barmen zu erwandern. Bevorzugte Ziele sind das Müngstener Tal und die dortige Kaiser-Wilhelm-Brücke. Ihr widmet Paul ein Gedicht: „Herbstabend“.117 Es beginnt: „Die Wupper unterm Riesenbrückenbogen / Glänzt wie ein violettes Sammetband / und kommt im müden Zickzack-Kurs gezogen.“ Viele Spaziergänger, die in der Nähe des Bauwerks Erholung suchen, genießen nicht nur die Schönheit der Natur, sondern bewundern zugleich den Fortschritt der Technik. Über den 170 Meter hohen stählernen Koloss, bis ins 21. Jahrhundert hinein Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke, schreibt anlässlich des hundertjährigen Bestehens Andreas Rossmann in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Zech bewegt sich literarisch nicht annähernd auf dem Niveau, welches die Müngstener Brücke […] ingenieurtechnisch darstellt.“118 Das Bauwerk steht in der Nähe von Wermelskirchen. Dort lebt der Lehrer Wilhelm Idel, ein Mittfünfziger, der seit einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt unterrichtet. Seine Freizeit widmet er der Heimatforschung und der Literatur. Zech lernt ihn kennen und vertraut ihm Einzelheiten aus seiner Kindheit bei der Großmutter in Müncheberg an.119
Ein beliebtes Ausflugsziel für Paul und Helene ist auch der „Clemenshammer“, eine Ansiedlung mit wenigen Häusern im Morsbachtal nördlich von Remscheid. Hier sind nach der Jahrhundertwende noch Hammerschmieden in Betrieb. Zech beschreibt die Idylle mehrfach, unter anderem in der Titelgeschichte des Novellenbandes „Das törichte Herz“.120 Darin entwirft er ein wirklichkeitsgetreues Abbild der Ortschaft an der heutigen Stadtgrenze von Wuppertal, ohne ihren Namen zu nennen.
Anders verfährt er im Feuilleton „Die Türkischrot-Färberei“ von 1931. Auch darin beschreibt er den „Clemenshammer“, nennt ihn aber „Cleverhammer“, obwohl er seinen richtigen Namen kennt. Erlebtes schmückt er mit Erdachtem aus.121 So will er an diesem Ort als Kind fünf Sommer hintereinander seine Ferien verbracht haben. Aus den Hammerschmieden macht er Färbereien und bei einem der dortigen Handwerker lässt er Franz Marc einen zweiwöchigen Malaufenthalt verbringen. Marc zeigt zwar 1911 beim Barmer Kunstverein in der Ruhmeshalle seine Arbeiten, kommt aber nie zum Clemenshammer.
Umstandshalber Hochzeit
Aus dem Jahr 1903 gibt es keine Zeugnisse, die Zechs Leben betreffen. Lediglich zur Geschichte seiner Familie ist ein Datum überliefert: Am 24. September stirbt in Müncheberg Pauls Großmutter Auguste Liebenow. Einträge in der Todesurkunde belegen, wie wenig die Nachkommen über ihr Leben wissen. Wilhelm, der jüngste Sohn, nennt gegenüber dem Standesbeamten ein falsches Alter der Verstorbenen sowie einen falschen Geburtsort. Sie hat die eigenen Kinder über ihre Herkunft aus dem Spreewald und den leiblichen Vater der Emilie Leberecht stets im Unklaren gelassen. Enkel Paul nimmt an der Beerdigung nicht teil.
Im Frühjahr 1904 bemerkt Helene Siemon, dass sie schwanger ist. Wie lange sie das für sich behält, und was die Mutter sowie ihr Freund dazu sagen, steht weder im Poesiealbum der Achtzehnjährigen noch in irgendwelchen Briefen. Es herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Erst Mitte des Jahres entschließt sich das Paar, Hochzeit zu halten, auch wenn einige Anzeichen gegen eine solche Verbindung sprechen. Paul heiratet wahrscheinlich nur deshalb, um seinem „Lenchen“ und ihrer Familie die „Schande“ eines unehelichen Kindes zu ersparen. Am 29. Juli wird das Paar im Rathaus von Elberfeld standesamtlich getraut. Laut Heiratsurkunde ist der Bräutigam „evangelisch“, seine Braut „reformiert“. Unterlagen über eine kirchliche Feier sind keine mehr vorhanden, da die Kirchenbücher im Zweiten Weltkrieg während eines Bombenangriffs auf Wuppertal verbrennen. Pauls Eltern können an der Feier nicht teilnehmen. Ihnen fehlt das Geld für eine Bahnreise nach Elberfeld. Adolf Zech ist in Briesen als Seiler längst ohne Arbeit.
Dorothea Siemon nimmt den Schwiegersohn in ihre Wohnung mit auf, wo außer Helene noch deren fünfzehnjährige Schwester Julia lebt. Damit will sie der schwangeren Tochter helfen, denn mit seinem spärlichen Einkommen als Lagerist kann Paul weder die Miete für eine geeignete Unterkunft bezahlen noch eine Familie ernähren. Dessen ungeachtet versucht er, den ungeliebten „Broterwerb“ loszuwerden und aus dem Schreiben einen Beruf zu machen. Der angehende Vater verarbeitet die Situation im Gedicht „Blick in ein Kindesauge“. Mit diesen Versen gelingt es ihm drei Wochen nach seiner Hochzeit erstmals, als Autor im „Täglichen Anzeiger für Berg und Mark“ zu stehen.122
Der Chefredakteur des Blattes, Ludwig Salomon, hat selbst literarische Neigungen. Er gehört zu den Honoratioren der Stadt und leitet den „Bezirksverein Niederrhein und Westfalen“ des Deutschen Schriftsteller-Verbandes. Zech erscheint die neue Verbindung von Vorteil, doch für seine Entwicklung als Schriftsteller erweist sie sich als problematisch, weil Salomon moderne Literatur wenig schätzt und lieber Gedichte des in Elberfeld ansässigen Kaufmanns Friedrich Wiegershaus druckt. Dieser deutschvölkische Politiker erlangt nach dem Ersten Weltkrieg traurige Berühmtheit als wüster Antisemit und Herausgeber des zeitweilig von Goebbels redigierten Naziblattes „Völkische Freiheit“.123
Am 2. Oktober 1904 bringt Helene einen Jungen zur Welt, der nach Pauls jüngerem Bruder Rudolf genannt wird. In seiner Freizeit verfasst der Familienvater weiterhin Gedichte, die nun nicht mehr ausschließlich für Helene, sondern für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Zielstrebig bemüht er sich, seine Bildung zu verbessern. Nachts liest er alles, was ihm an Büchern zur Verfügung steht. Aus eigenem Antrieb beginnt er fernab jeder Universität ein Literaturstudium, bei dem er anfänglich wahllos historische und zeitgenössische Werke, Wertvolles und Triviales verschlingt. Als Autodidakt sitzt er viel länger über Büchern als viele Altersgenossen, die an Universitäten immatrikuliert sind und ihr Studium mit Staatsexamen oder Promotion abschließen. Das Nebeneinander von Beruf, Fortbildung und Familie erweist sich für ihn als ähnlich anstrengend wie die Arbeit im Schacht.
Zech bietet seine Verse in den Zeitungsredaktionen von Elberfeld und Barmen persönlich an. Ende Oktober hat Salomon erneut ein Einsehen und druckt im „Täglichen Anzeiger“ ein weiteres Gedicht von ihm ab. Passend zur Jahreszeit zwölf Zeilen „Herbststimmung“, in denen „der Nebel schleicht“ und sich „das Bächlein durch die welken Blätter drängt“. Aufhorchen lässt der Schluss: „So mancher Traum, so manches Hoffen /
Helene Zech mit ihrem Sohn Rudolf („Rudi“)
Entfloh, – ach so unendlich weit!“124 Der Verfasser deutet einen Frust an, den er sich einige Monate später mit „drei Gedichten aus der Ehe“ von der Seele schreibt. Das erste, „Wandlung“, hat er während Helenes Schwangerschaft zu Papier gebracht. Im letzten Vers beklagt sich der angehende Vater: „Nun in Deinem gesegneten Schoß / mein Herz ganz leise / Sich wandelt zu ewiger Speise / Sind Deine Nächte wunschlos und kühl.“ Was besagt: Helene hat zu der Zeit Pauls Versuche, mit ihr zu schlafen, abgelehnt. In „Psalm“, dem „zweiten Gedicht aus der Ehe“, heißt es: „Sieben Kerzen hab ich angezündet, / Und mein Herzblut stieg und stieg – / Aber Dein Verwundern schwieg / Wie ein siebenmal versiegelt Buch.“ Im dritten Gedicht wünscht sich der junge Ehemann in seines „Weibes hinseufzende Mädchenzeit“ zurück.125 Diese Bekenntnisse hält Zech zunächst alle unter Verschluss. Für die Öffentlichkeit bestimmt ist lediglich ein weiterer jahreszeitlicher Kommentar, „Der Frühling kommt“.126
Konditor und Poet
Findet sich im Trauschein Zechs noch „Lagerist“ als Berufsangabe, so vermerken die Elberfelder Adressbücher ab dem Jahr 1905 hinter seinem Namen, er sei „Konditor“. Fahrenkrogs Sohn Rolf notiert Jahre später: „Seiner Zeit im Wuppertal war Zechs erlernter Beruf: Bäcker“.127 Der Schriftsteller Börries von Münchhausen bezeichnet den jungen Kollegen in einem Brief an Levin Ludwig Schücking als „Elberfelder Konditorlehrling“.128 Zechs Tochter Elisabeth bestätigt ebenfalls, dass ihr Vater Konditor gewesen sei. Manchmal habe er zu Hause Pralinen hergestellt.129
Zur Zeit des Berufswechsels beschäftigt sich Zech eingehend mit seinen Vorfahren. In einem Text aus dem Jahr 1919 heißt es: „Die Zwanziger-Mitte hatte ich noch nicht überschritten, als mich das Unglück heimsuchte, aus den Gebirgen der Seele herab auf den Schauplatz Bewußtsein [zu fallen].“ Er erörtert darin körperliche Krankheiten und fährt fort: „Doch zermalmender […] sind geistige Beklemmungen, die der Sold jener Sünden sind, die unserer Geburt vorangingen“.130 Beklommenheit, Kopfschmerz, Erregungs- und Angstzustände, unter denen er leidet, führt er auf negative Erbanlagen zurück, denn er weiß von der Krankheit seines Großvaters Wilhelm, der sich als Patient zeitweilig in einer Nervenheilanstalt befunden hat.131
Anlässlich von Schillers 100. Todestag im Jahre 1905 kommt es in den Schwesterstädten Barmen und Elberfeld an der Wupper zur Gründung von zwei „Literarischen Gesellschaften“. Erster Vorsitzender wird in Barmen Ernst August Saatweber. Der erinnert sich: „Detlef von Liliencron hob sie aus der Taufe“.132 Diesem Autor hat Otto Julius Bierbaum eine „Epistel von meinem Glücke“ gewidmet. Sie ist in einer 1901 erschienenen populären Lyriksammlung „Irrgarten der Liebe“ enthalten. Die ersten beiden Zeilen der achten Strophe lauten: „Wer murrt da in der Ecke? Schweige, Tropf; / Ich kenne dich, du liebst das Eckenstehn“.133 Von Zech ist aus der Zeit um 1905 ein undatiertes Manuskript überliefert, das die Überschrift „Prolog“ trägt. Der Text beginnt mit den Worten: „Wer murrt da in der Ecke? Schweige blöder Tropf! / Ich kenne dich, du liebst den Wasserkopf“.134 Ein frühes Zeugnis für den freizügigen Umgang des Verfassers mit fremdem geistigem Eigentum.
Treibende Kräfte für die Etablierung der „Literarischen Gesellschaft“ in Elberfeld sind drei stadtbekannte Persönlichkeiten. Chefredakteur Salomon wirbt in seinem Blatt Mitglieder. Das Amt des Vorsitzenden übernimmt Friedrich Kerst, ein Lehrer, der sich von seiner Tätigkeit an der Städtischen Mittelschule für Mädchen nicht ausgelastet glaubt und zahlreiche Ehrenämter bekleidet. Der Dritte im Bunde ist der im Wuppertal als Künstler allgegenwärtige Ludwig Fahrenkrog. Er schmückt Schulen und Kirchen aus, portraitiert die Prominenz, illustriert Bücher und verbessert sein Gehalt als Dozent durch Reklame-Entwürfe für die Firmen Henkel und Stollwerck. Zielgerichtet vermarktet er das eigene Schaffen auch mittels Kunstdrucken und Postkarten. Vieles davon dient dem Zweck, den germanischen Götterglauben zu verbreiten.135 Zech schätzt sich glücklich, Aufnahme in diese Gesellschaft zu finden. Sorgsam verheimlicht er bei deren Zusammenkünften die eigenen Lebensumstände, Frau und Kind, die Erlebnisse der Jugend und den Arbeitsplatz.
Beim „Täglichen Anzeiger“ ist Zech von Salomon auf die Rolle eines literarischen Wetterwartes festgelegt. Anfang Februar 1906 erscheint in dieser Zeitung ein weiteres Gedicht von ihm, das, zur Jahreszeit passend, den Titel „Schneeflocken“ trägt.136 Mehr scheint ihm der Chefredakteur nicht zuzutrauen. Als Rilke im Städtischen Museum von Elberfeld einen Vortrag über Rodin hält, berichtet Kerst darüber. Zech behauptet später, er habe einen Beitrag geliefert. Der entsprechende Beleg fehlt.137 Was er an diesem Abend als Zuhörer empfindet, beschreibt er in einem „Requiem“, das nach dem Tod des Dichters erscheint: „In einer knappen Stunde geschah der vollkommenste Querschnitt durch das Werk, und doch fiel der Name [Rodin] nur einmal laut und deutlich wie ein Name in den Raum. Einmal. Und war der Ausklang.“138 Von nun an stehen Zechs Gedichte inhaltlich und formal im Banne dieses „Meisters“. Für ihren Verfasser „ist in allen Phasen seines Werks und auf allen Stationen seines Lebens […] das Werk Rainer Maria Rilkes in auffälliger Weise ein ständiger Begleiter, ja der entscheidende Leitstern“.139
Paul Zech um 1905
Auch Heinrich Toelke, Chefredakteur des „General-Anzeigers für Elberfeld-Barmen“, gewinnt Interesse an dem jungen Mann, der ihm fortwährend Verse auf den Schreibtisch legt. Er erweist ihm den Gefallen und druckt termingerecht eines seiner Gedichte, „Ostermorgen“, ab. Das bedeutet ein großes Entgegenkommen, denn es ist ausschließlich der lokalen schriftstellerischen Prominenz vorbehalten, anlässlich hoher kirchlicher Feiertage die Leserschaft des Blattes mit Lyrik zu beglücken. Zechs Verse erscheinen freilich noch nicht auf der Titelseite der Zeitschrift, sondern im Inneren: „Eines Glöckleins Silberstimmchen / Zittert durch die linde Luft; / Von der Halde kommt herüber / Feiner süßer Veilchenduft.“140 Den Abonnenten gefällt das und Toelke veröffentlicht künftig weitere Beiträge des neuen Mitarbeiters. Damit hat dieser bei seinen Bemühungen, als Schriftsteller öffentlich Anerkennung zu finden, einen weiteren Erfolg errungen.
Zeugin dieser Entwicklung ist Emmy Schattke, eine junge Lehrerin aus Elberfeld. Sie schließt sich 1906 einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen an, die, wie die Pädagogin rückblickend festhält, „für eine neue Schule schwärmten und sich im 'Volkserzieher‘ vereinigt“ haben.141 Das ist ein Lehrerverband, der auch eine Zeitschrift dieses Namens herausgibt. Bei seinem Gründer Wilhelm Schwaner handelt es sich um einen aktiven Antisemiten: „'Der Volkserzieher‘ tritt mit voller Überzeugung und mit Energie für eine weniger forcierte Behandlung der Judengeschichte in der Schule ein; er wünscht die Einführung der wundersamen deutschen Märchen und der germanischen Heldensage“.142 In einer Ausgabe des Blattes verkündet 1906 ein Verbandsmitglied aus Berlin: „Unser Bundeszeichen ist das Hakenkreuz. […] das Hakenkreuz ist ein religiöses Symbol, das für uns von besonderem Interesse ist, da es sich erwiesen hat, dass das Hakenkreuz von den ältesten Zeiten sich nur bei arischen Völkerstämmen findet.“143
Die „Volkserzieher“ des Wuppertals treffen sich an jedem ersten Montag des Monats im Gasthaus Friedrichs an der Dörnerbrücke in Barmen. Auch Fahrenkrog gehört zu der Runde. Er ist mit Schwaner befreundet. Vertreten sind ferner Anhänger von Adolf Damaschke, dem Führer einer Bodenreformbewegung, sowie Johannes Langermann, ein Barmer Schulreformer. Unter den fünf oder sechs Frauen der Gruppe befindet sich Amalie Pohl, genannt „Ma“ oder „Male“. Diese Kollegin kennt Emmy Schattke seit 1905: „Sie war sehr klug und brachte manche Anregung mit, aber sie suchte auch Trost, wenn das Schicksal es nicht gut gemeint hatte.“144 In Schattkes Erinnerungen heißt es: „Wie Paul Zech in den Kreis kam, weiß ich nicht, er kam mit einem anderen Dichter Grünewald, der Theaterstücke schrieb für Bauerntheater, voller Einbildung war, aber schon 1910 starb.“145
Bei den Treffen am Stammtisch der „Volkserzieher“ bemüht sich Zech, keine Einzelheiten aus seinem Leben bekannt werden zu lassen. Er spricht weder über seine Herkunft noch über die Arbeit als Konditor. Aus den familiären Verhältnissen macht er gleichfalls ein Geheimnis. Dabei hätte er Erfreuliches zu berichten: 1906 stellt sich bei Helene erneut Nachwuchs ein. Dem Sohn Rudolf folgt ein Mädchen namens Elisabeth Dorothea, das seinen ersten Vornamen nach Pauls Schwester und den zweiten nach dessen Schwiegermutter erhält. Die Geburtsurkunde enthält den Vermerk, der Vater sei von Beruf Konditor. Jahre später trägt Zech in das Poesiealbum der Tochter Verse mit dem Titel „An Elisabeth“ ein und erinnert sich der Ängste, die seine Frau während ihrer Schwangerschaft geplagt haben: „Sie ging durch den Tag oft so bang, als ob ihr ein Leid von Dir drohte“.146
In der Wohnung von Dorothea Siemon leben nun sechs Personen, darunter zwei kleine Kinder. Die Größe und Anzahl der Räume ist bescheiden, handelt es sich doch bei der Inhaberin um die Witwe eines Schuhmachers mit kleiner Rente. Für einen harmonischen Alltag der Gemeinschaft ist die Situation nicht förderlich. Die junge Mutter hat ihr Neugeborenes sowie den zweijährigen Rudolf zu versorgen und kann keine Arbeit annehmen, um zum Unterhalt der Familie beizutragen. Ehefrau und Schwiegermutter drängen Paul, mehr Geld nach zu Hause bringen. Ihm aber ist es wichtiger, als Autor voranzukommen. So wiederholt sich nun, was er bei den Eltern während der Briesener Jahre hat miterleben müssen: überall herrscht Mangel. Das ist auch der Grund dafür, weshalb der Familienvater weder alleine, geschweige denn mit Frau und Kindern ins ferne Westpreußen reisen kann, als im Oktober 1906 seine Schwester Elisabeth bei den Eltern in Briesen Hochzeit mit dem Geschäftsführer Wilhelm Werner feiert.
Zech macht nicht nur seine Armut und die Enge der Wohnung zu schaffen, ihn verbittert auch, was im Herbst 1906 in Elberfeld und Barmen auf literarischem Gebiet vor sich geht. Er muss verkraften, wie Friedrich Kerst, der Vorsitzende der „Literarischen Gesellschaft Elberfeld“, sein Amt ausnutzt und die Vorstandsmitglieder dazu überredet, dem vor sechs Jahren erschienenen Band „Bergische Dichtung“ einen zweiten folgen zu lassen, finanziert aus Mitteln der Gesellschaft. In dem Almanach findet sich kein Beitrag Zechs. Ursache dafür ist nicht die Qualität von dessen Gedichten, aber beim Verfasser handelt es sich um einen Niemand, der weder durch familiäre Herkunft noch gesellschaftliche Stellung irgendwie Bedeutung hat. Die Freundschaft mit Fahrenkrog zählt in diesem Zusammenhang ebenso wenig wie die Mitgliedschaft in der „Literarischen Gesellschaft“ von Elberfeld. Entsprechend groß ist die Enttäuschung beim Autor über die Missachtung seines Talents.
Welche Gründe Kerst bewegen, in dem Almanach drei Gedichte zu veröffentlichen, die nach Inhalt und Form völlig aus dem Konzept des Buches herausfallen, erscheint auf den ersten Blick rätselhaft. Sie heißen „Heim“, „Weltende“ und „Groteske“.147 Das Rätsel löst sich, liest man den Namen der Verfasserin: Else Lasker-Schüler, Tochter des Elberfelder Privatbankiers Aaron Schüler. Sie hat 1894 den Mediziner Dr. Jonathan Berthold Lasker geheiratet und ist mit ihm nach Berlin gezogen. Nach der Scheidung von Lasker hat sie 1903 den Schriftsteller Georg Lewin geheiratet, der später als Herwarth Walden Berühmtheit erlangt.
Karneval im Mai
Chefredakteur Salomon, der seinen Posten als Chefredakteur beim „Täglichen Anzeiger“ aufgegeben hat und in Rente gegangen ist, berichtet Zech von „Blumenspielen“, die der Jurist und Schriftsteller Johannes Fastenrath jährlich im Mai in der „guten Stube Kölns“, dem „Gürzenich“, veranstaltet. Der gebürtige Remscheider, vom Großherzog von Sachsen-Weimar zum „Geheimen Hofrath“ ernannt, ist vermögend genug, um diesen literarischen Wettbewerb aus eigener Tasche zu bezahlen. Viele Zeitgenossen kritisieren das Niveau der Veranstaltung. Obwohl Zech das weiß, will er daran teilnehmen, bestärkt durch Salomon, der zur Jury gehört. Seine Beweggründe dafür sind leicht zu durchschauen. Bei einem der Preise, die den Siegern winken, handelt es sich um eine goldene Uhrkette. Er reicht fünf Gedichte ein, gewinnt aber nichts, sondern erhält lediglich die Nachricht, seine Verse würden bei der Preisverleihung eine lobende Erwähnung finden. Fastenrath fragt: „Dürfen wir Sie zum 5. Mai in Köln erwarten? Für unser Jahresbuch erbitte ich mir Ihre Fotografie und gefällige Angaben, wann und wo Sie geboren sind. Vielleicht erfreuen Sie uns noch mit einem gereimten Festgruß.“148
Zech unterdrückt seine Enttäuschung und antwortet: „viel Jubel und Freude brachte ihre frohe Botschaft in mein Haus. Nur Poeten können ja fühlen, wie wohl selbst die kleinste Anerkennung tut.“ Bei der Niederschrift seines Lebenslaufs lässt er viel Phantasie walten.149 Den Vater befördert er vom „Seilermeister“ zum „Bahnmeister“ und gibt als Land, in dem seine Eltern zu Hause sind, Niedersachsen an. Die falschen Auskünfte ermöglichen aber Rückschlüsse auf Daten seiner Kindheit und Jugend. Wenn er schreibt: „Verblieb dort [in Briesen] bis zum vierten Lebensjahre. Dann wurde mein Vater nach Lüneburg (Hannover) versetzt“, so trifft diese Angabe zwar nicht zu, aber der Hinweis auf das vollendete vierte Lebensjahr ist ein weiteres Indiz dafür, wann er von seinem Vater im Vorschulalter nach Müncheberg gebracht worden ist. Weiter heißt es: „Besuchte dort die Bürgerschule und trat mit 14 in ein kaufmännisches Geschäft in die Lehre.“
Den Tatsachen entsprechend nennt Zech für den Zeitpunkt des Schulabschlusses das 14. Lebensjahr und erwähnt den Beginn einer Berufsausbildung. Die verlegt er aber von Briesen nach Lüneburg und vom handwerklichen in den kaufmännischen Bereich. Dann erklärt er Fastenrath: „Ihren Wunsch betreffend der Fotografie kann ich momentan nicht erfüllen. Wollen Sie mir bitte mitteilen, bis zu welchem Zeitpunkt dieselbe in Ihren Händen sein muss?“ Offenbar besitzt er kein Geld für einen Besuch beim Fotografen, stellt aber in Aussicht: „Zu den Festspielen werde ich, wenn nichts dazwischen tritt, erscheinen“. Allerdings ist er schon jetzt entschlossen, der Preisverleihung fern zu bleiben, denn dazu hat er weder Lust noch die nötigen Mittel. Der Aufforderung, vorab eine gereimte Verbeugung vor dem Hofrat zu verfassen, kommt er nicht sofort nach: „Vielleicht schreibe ich auch einen Festgruß“. Unter Hinweis auf seine finanzielle Lage bittet er um Überlassung eines Jahrbuchs der „Kölner Blumenspiele“ aus früherer Zeit.150
Als Fastenrath Zech diesen Wunsch erfüllt, schmeichelt er dem Geber: „Ich weiß meinen Dank nicht in Worte zu kleiden, den Dank, den ich Ihnen schuldig bin für die große Freude, die sie mir […] bereitet haben.“ In Wirklichkeit hält er nichts vom Wettbewerb, zu dem er sich nur in der Hoffnung angemeldet hat, materiellen Gewinn zu erzielen. Beim Lesen eines Verrisses der „Blumenspiele“ in der Zeitschrift „Der Kunstwart“ ist ihm endgültig klar geworden, was ihn in Köln erwartet. Fastenrath gegenüber redet er die Veranstaltung schön: „Ein ganz anderes Bild habe ich nun von den Blumenspielen, respektive vom Wert derselben bekommen. Waren mir doch erst kürzlich sehr abschreckende Äußerungen über die Blumenspiele zu Gesicht gekommen.“ Weiter schreibt er: „Ich bin nun zu der Überzeugung gekommen, dass die Blumenspiele und ihr Organisator […] in der deutschen Literaturgeschichte nicht unerwähnt bleiben werden. Denn der literarische Wert der Spiele ist ein sehr hoher.“151 Zech liefert auch den gewünschten Festgruß: „Sieh‘ König Mai, Dein Freund ist da / Mit tausend, abertausend Blumen. / Wie leuchten nun im Sonnenschein / Die eisbefreiten Ackerkrumen“.152
Der „General-Anzeiger“ veröffentlicht in seiner Karfreitagsausgabe Zechs Gedicht „Ostern“.153 So herausgestellt worden sind bisher nur die lokalen „Haus-Dichter“ Rittershaus, Wiegershaus und Hückinghaus. Das hilft dem Verfasser über die Enttäuschung hinweg, bei Fastenraths Wettbewerb keinen Preis bekommen zu haben. Wie längst geplant, fährt er nicht nach Köln und schreibt an den „Geheimen Hofrath: „Erhielt soeben die Nachricht von einer schweren Erkrankung meiner Mutter. Ich sehe mich daher genötigt, den in Aussicht gestellten Besuch der Blumenspiele wieder rückgängig zu machen. […] Ich reise schon morgen nach Lüneburg ab“.154 Die Mutter mag krank sein, in Lüneburg wohnt sie bestimmt nicht. Dem Brief legt Zech ein Portraitfoto aus dem Atelier von Emil Saurin-Sorani in der Elberfelder Königstraße bei. Es zeigt einen modisch gekleideten jungen Mann mit Bürstenhaarschnitt, dem man sein Alter nicht ansieht. Er trägt ein dunkles Jackett sowie ein weißes Stehkragenhemd.
Die Zeitschrift „Niedersachsen“ veröffentlicht, wenn auch mit zeitlicher Verspätung, ein Gedicht von Zech, in dem der „Vorfrühling“ besungen wird. Wie schon im Loblied auf den Mai zeigt sich der Verfasser darin thematisch der Erde verbunden: „Braune Schollen, die sich endlos dehnen. […] Einsam ragt ein Pflug am Ackerrain“.155 Bezüge zum Lebenskult sind darin nicht zu übersehen.
Über die Preisverleihung bei den „Kölner Blumenspielen“ ist im „Täglichen Anzeiger für Berg und Mark“ zu lesen: „Ehrenvolle Erwähnungen fanden Rechtsanwalt Dr. Prüßmann (Remscheid) und Paul Zech (Elberfeld).“156 Was Letzterer vom Wettbewerb in Erinnerung behält, hat mit dessen tatsächlichem Verlauf nichts zu tun. In späteren Jahren sieht er es so, dass „man Rilke, Mombert und Stefan George zu Köllen am Ring noch auspfiff. (So geschehen im Jahre 1907 im Gürzenich).“ Diese Behauptung entspringt ebenso der Phantasie des Schreibers wie eine zweite: „Das Rheinland, dem ich durch Geburt angehöre“.157
Im „Volkserzieher“ fordert Fahrenkrog die Schaffung einer „arteigenen Religion“.158 Deren Grundlage soll die germanische Mythologie sein. Erste Erfolge lassen nicht lange auf sich warten. Die neue Glaubensgemeinschaft mit Namen „Deutsch-Religiöse Gemeinde“ wächst rasch, auch Wilhelm Schwaner, Gründer des Lehrerverbands und der Zeitschrift „Volkserzieher“, erklärt seinen Beitritt. Er hat vor kurzem eine „Germanen-Bibel“ herausgegeben, die Fahrenkrog „herrlich“ findet.159 Zech gehört der Sekte nicht an, pflegt aber mit ihrem geistigen Führer und mehreren Mitgliedern freundschaftlichen Umgang. Damit bewegt er sich in antichristlichen und militant antisemitischen Kreisen. Rückblickend zeichnet er von diesem Lebensabschnitt ein völlig anderes Bild, das sein Sohn Rudi sowie seine Schwiegertochter Hella nach dem Zweiten Weltkrieg wider besseres Wissen unverändert übernehmen und an Dritte weitergeben. Solche Darstellungen sehen wie folgt aus: „Während dieser Jahre [1904 bis 1906] wurde er wegen Majestätsbeleidigung verfolgt, weshalb er 1907 für einige Zeit nach Dänemark und dann nach Paris ging“.160
Paul Zech um 1907
Zech denkt nicht daran, im deutschen Kaiserreich des Jahres 1907 gegen die Obrigkeit zu protestieren. Das belegt eine Ansichtskarte, die er im August an Helene schreibt. Sie zeigt ein Foto: „Bochum. Partie aus dem Stadtpark“. Im Vordergrund befindet sich ein Kreis mit einem Kreuz im Innern, der von den Zahlen 1870/71 und dem Schriftzug „Mit Gott für König und Vaterland“ umrundet wird. Diese Losung ist im Krieg 70/71 gegen Frankreich von deutschen Soldaten bei Angriffen auf den Gegner geschrien worden. Noch lange nach Friedensschluss hat sie konservativen Kreisen in Preußen als Leitspruch gedient. Auf der Bildseite notiert Zech: „Dies ist der Ort, an welchem wir Feuer abbrannten.“161
Im „Märkischen Sprecher“ steht, um welchen Personenkreis es sich handelt, der auf diese Weise feiert. Mitglieder eines „Marinevereins“ brennen am 4. August im Stadtpark von Bochum ein Feuerwerk ab: „Trotz der Empörung eines hiesigen Blattes, das der Veranstaltung des Marinevereins aus bekannten Gründen nicht sympathisch gegenübersteht.“162 Bei dieser anderen Zeitung handelt es sich um das sozialdemokratische „Volksblatt“. Es hat im Vorhinein gegen die „kaisertreue“ Kundgebung gewettert. Paul Zech nimmt an einer Veranstaltung teil, die der Glorifizierung Wilhelms II. und seiner Regentschaft dient. Folgerichtig befindet sich er sich auch nicht unter den Genossen, als im September die Sozialdemokraten in Essen ihren Parteitag abhalten, sondern in Mönchengladbach, wie eine Ansichtskarte zeigt, die er von dort an seine Frau schreibt.163
Die Wohngemeinschaft in der Hatzenbecker Straße bringt für das junge Paar, seine Kinder und die Schwiegermutter immer mehr Belastungen mit sich. Andeutungen darüber finden sich in einem Gedicht Zechs. Er beschreibt, wie die Vorweihnachtszeit das häusliche Einvernehmen fördert: „Und dann sind uns Abende beschieden, / wo der rotverklärte Lampenfrieden / einem Opfersinn entgegenreift. / Wo selbst Frauen mit schneeweißen Scheiteln / ernsthaft sich bemühn, nichts zu vereiteln, / was um Enkelstirnen wünschend schweift.“164 Auch im neuen Jahr arbeitet der Familienvater weiterhin in seinem „Brotberuf“ als Konditor und Bäcker, hofft aber unbeirrt stets auf literarischen Erfolg. Der will sich nicht recht einstellen. Es bleibt beim Verfertigen von Gedichten nach Vorgabe des Kalenders, beispielsweise einer Frühlingsbotschaft mit dem Titel „Prinz Himmelblau“: „Die Amsel ist ganz außer sich / Und ruft den ganzen lieben Tag: / Heraus, Du Menschenkind: geschwinde, / Es ist die höchste Zeit für Dich!“165
Lasker-Schüler soll‘s richten
Im Mai 1908 feiert Barmen mit großem Aufwand die Verleihung der Stadtrechte vor hundert Jahren. Den Höhepunkt der Veranstaltungen bildet ein historischer Festzug, dessen Gestaltung die Kommune Fahrenkrog übertragen hat. Zech ist nicht beteiligt. Der Meister gibt seinem Bewunderer keine Chance, öffentlich aufzutreten. Dem bleibt lediglich die Statistenrolle eines Zuschauers. Möglicherweise geschieht das deshalb, weil Zech Zurückhaltung übt, was die Teilnahme an den Umtrieben der „Deutsch-Religiösen Gemeinde“ betrifft.
Bei den Treffen der „Volkserzieher“ und den Veranstaltungen der „Literarischen Gesellschaft“ Elberfeld kommt Zech mit Leuten zusammen, die wie er den Ehrgeiz haben, Schriftsteller zu werden. Drei davon sind Christian Grünewald-Bonn, August Vetter und Georg Kreidt. Grünewald ist 1902 im Bonner Adressbuch als Seilergehilfe ausgewiesen. Am Stammtisch erwähnt er seinen Beruf ebenso wenig wie Zech dort die Herkunft aus einer westpreußischen Seilerfamilie verrät. Vetter arbeitet als Grafiker. Von Kreidt ist nur der Name bekannt. Die Herren beschließen, gemeinsam mit Zech und Friedrich Kerst, dem Vorsitzenden der „Literarischen Gesellschaft Elberfeld“, eine Autorengemeinschaft zu gründen. Sie soll „Jungbergische Dichtergruppe“ heißen, auch wenn Friedrich Kerst schon 38 Jahre alt ist. Als jugendlich können Vetter (21) und Grünewald-Bonn (24) durchgehen. Bei Zech (27) fällt das schon schwerer. Auch was das „Bergische“ anbelangt, bedarf es einiger Mühe, diese Bezeichnung glaubhaft erscheinen zu lassen. Grünewald stammt aus Bonn und Zech ist Westpreuße. Die fünf Autoren gehen ein Zweckbündnis ein, von dem sich jedes Mitglied mehr Aufmerksamkeit für sein Schaffen erhofft. Deshalb beschließen sie die Herausgabe einer Sammlung „Bergischer Dichtung“ und tauschen Texte zur jeweiligen Begutachtung aus. Grünewald-Bonn schreibt an Zech: „Einliegend finden Sie einige von meinen älteren Gedichten. Sehen Sie doch mal nach, was davon wohl noch des Aufhebens wert erscheint.“166 Das ist nichts weiter als Koketterie.
Auf der Zeche Radbod bei Hamm, nur 75 Kilometer von Elberfeld entfernt, kommt es im November 1908 zu einer Schlagwetterexplosion, in deren Folge 348 Kumpel sterben. Zech verliert darüber in Briefen oder Gedichten aus dieser Zeit kein Wort. Dem ehemaligen Berghehilfen dürfte das Schicksal der Toten und Verletzten zwar nahegehen, einen Anstoß, es zum Thema seines literarischen Schaffens zu machen, gibt es nicht. Während der spärlichen Freizeit, die ihm außerhalb der Backstube bleibt, bemüht er sich, die geplante Anthologie fertigzustellen sowie um eine preiswerte Unterkunft, denn die Wohnung der Schwiegermutter erweist sich von Tag zu Tag mehr als viel zu klein, auch wenn Helenes inzwischen neunzehnjährige Schwester Julia in der Hatzenbecker Straße ausgezogen ist und den Eisenbahner Gustav Bunse geheiratet hat.
Im Februar 1909 setzt in weiten Teilen des Bergischen Landes, wo es den Winter über lange und heftig geschneit hat, Tauwetter ein. Es regnet ununterbrochen. Eine hohe Schneedecke schmilzt in kürzester Zeit. Flüsse und Bäche werden rasch zu reißenden Strömen und verursachen großflächige Überschwemmungen. Heinrich Toelke, Chefredakteur des „General-Anzeigers für Elberfeld-Barmen“, gibt Zech den Auftrag, die Katastrophe zum Thema eines Gedichts zu machen. Er erhält es binnen weniger Stunden. Vier Verse lang veranschaulichen Wortbilder das Ereignis „Hochwasser“: „Es kam ein schwarzes Heer von West gezogen. / Die Sturmtrompete schrie: Gebt Raum! Gebt Raum! / Da schmolzen Schnee und Wintereis zu Schaum. / Und talwärts wälzten sich die Wasserwogen. / Der Damm zerbarst. Die Brückenpfeiler krachten […]“. Erst im letzten Vers macht der Verfasser Zugeständnisse an die Lesegewohnheiten der Abonnenten, indem er den Blick himmelwärts lenkt: „Ein Glöcklein wandert durch die Wasserwüste / Und wimmert wie ein heimatloses Kind; / Aus Wolken aber, die zerrissen sind, / Schimmert die hoffnungsselige Sternenküste.“167 In Zechs Schaffen scheint sich ein Wechsel anzubahnen, obwohl er bald darauf wieder ein Gedicht in der Art seiner bisherigen lyrischen Ansagen zur Jahreszeit schreibt. Es heißt: „Märzenschnee“: „Draußen tanzt der Schwarm der Flocken / Einen wundervollen Reigen […]. Aber hinter klarem Fenster, / Hinter seidener Gardine, / Duften schon die Hyazinthen / Eine Frühlingskavatine.“168 Die nur vier Wochen zurückliegende Naturkatastrophe scheint vergessen.
Paul und Helene beziehen mit ihren Kindern eine eigene Wohnung in der Neuen Gerstenstraße 24, nahe dem Elberfelder Bahnhof. Die Familie lebt hier weiter in einfachsten Verhältnissen. Zech schreibt an Emmy Schattke: „Ich werde versuchen in die Wege zu leiten, dass Sie bald uns besuchen. Ich kann Ihnen nur eine sehr primitive Mansardensituation bieten.“169 Selbst dieses billige Quartier bringt zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich, was umso problematischer ist, als der Familienvater seine Stelle als Konditor kündigt und glaubt, mit Frau und Kindern von den spärlichen, unregelmäßig eingehenden Honoraren eines freien Mitarbeiters bei Zeitungen und Zeitschriften auskommen zu können. Er hofft ständig auf eine Verbesserung seiner Einkünfte und mehr Anerkennung als Autor. Die scheint gekommen, als Toelke ihm erneut den Auftrag für ein Festtagsgedicht erteilt. Es heißt „Pfingstfreude“ und steht auf der Titelseite des „General-Anzeigers“. Damit hat er „offenbar den ‚Durchbruch‘ im Wuppertal geschafft“.170
Nach Pfingsten bemüht sich die „Jungbergische Dichtergruppe“ verstärkt um das Zustandekommen ihrer Anthologie. Grünewald-Bonn nimmt Verbindung mit der Stuttgarter Verlagsbuchhandlung „Greiner & Pfeiffer“ auf. Bei diesen „Königlichen Hofbuchdruckern“ hat Fahrenkrog sein Stück „Baldur“ veröffentlicht. Die christlichen Grundsätze der Firma vor Augen schlägt Grünewald für die Veröffentlichung einen Titel vor, der nach Kirche klingt: „Die Orgel. Ausgewählte Dichtungen der Jung-Bergischen Dichtergruppe“. Der Verlag zeigt Interesse, doch die Autoren sind sich noch nicht über die Auswahl der Texte einig und beschließen, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten. Der soll sich zur Qualität der Gedichte äußern. In Börries von Münchhausen glauben sie, den geeigneten Mann dafür gefunden zu haben. Der Baron besitzt große Popularität, vor allem durch seine Balladen, die historische Stoffe aufwärmen. Zech fällt die Aufgabe zu, mit ihm Verbindung aufzunehmen, und Grünewald muss den Stuttgarter „Hofbuchdruckern“ mitteilen, „dass sich die Einsendung des erbetenen Manuskripts um einige Wochen verzögern wird, da dasselbe erst noch an verschiedene Autoritäten zur Begutachtung gegeben werden soll“.171
Münchhausen erhält Arbeitsproben von drei Mitgliedern der Gruppe. Kersts Gedichte sind nicht dabei. Entweder will sich der nicht beurteilen lassen, oder Zech hat den Kollegen bei der Auswahl bewusst übergangen und stattdessen Verse von Fahrenkrog mitgeschickt, der kein „Jung-bergischer Dichter“ ist. Der Juror zerpflückt die eingesandten Texte. In einem achtseitigen Gutachten wettert er am heftigsten gegen Grünewald. Fahrenkrogs Arbeiten kommen kaum besser weg: „Um Gottes willen, so was wollen Sie drucken?! Schrecklich!“ Kreidt und Zech werden milder beurteilt. Letzterem rät Münchhausen: „Augenscheinlich sind Sie nicht Landwirt. […] Landleute sollten Gedichte der Landleute schreiben. Schreiben Sie Gedichte der Kaufleute, oder was Sie nun sind, das ist ehrlich.“ Er bescheinigt ihm jedoch: „Sie sind ein unzweifelhaftes Talent, nichts himmelstürmendes, aber was echtes. Arbeiten Sie weiter, lassen Sie die Mitarbeit mit den anderen nur sein, und geben Sie in zwei bis drei Jahren einen eigenen Band heraus.“ Dem Angebot: „Ich werde mich freuen, gelegentlich mit gutem Rat weiter helfen zu können“, folgt die Einschränkung: „Denken Sie nicht zu hoch von Ihrer Kunst, seien Sie weiter wie bisher still, ehrlich, bescheiden und ernsthaft, Sie können noch einmal manchen anderen Menschen Freude machen!“172 Münchhausen überlässt die eingereichten Arbeitsproben für kurze Zeit einem Verleger zur Lektüre, ohne den Autoren dies mitzuteilen. Auf einer Karte, die der Baron seiner Sendung beilegt, heißt es: „Zech ist der beste, dann kommt Kreidt. […] Aber selbst ihm würde ich raten noch nicht zu drucken, er schadet sich nur damit.“173
Einige Tage später erhält Zech die Gedichte zurück samt dem kritischen Kommentar. Er sieht sich bestätigt. Seine Antwort an Münchhausen ist an Ehrerbietung kaum zu übertreffen: „Sie haben in allen Punkten recht. Ich werde aus der ‚Jungbergischen Dichtergruppe‘ ausscheiden und mit Ernst und Fleiß an meine Weiterbildung gehen.“ Nur den zweiten Teil der Ankündigung setzt er in die Tat um. Ein Ausscheiden aus der Gruppe kommt für ihn nicht in Frage, doch das behält er für sich. Er nimmt an, Münchhausen könne ihm künftig nützlich sein: „Besondere Freude macht mir Ihr ehrenvolles Versprechen, mir auch in Zukunft mit Rat zur Seite stehen zu wollen. Ich werde in Bälde davon Gebrauch machen.“ Da der Gutachter nach seinem Beruf gefragt hat, antwortet er ihm: „Landwirt bin ich, wie Sie ganz recht vermuten, nicht. Wohl bin ich auf dem Lande großgeworden. Mein Vater war Bauer im Holsteinischen. Ich verbringe […] den größten Teil meiner Ferien auf der heimatlichen Scholle. Daher die Vorliebe für ländliche Motive.“174 Münchhausen hält die Angaben für wahr und gibt sie mehrfach an Dritte weiter. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Zech ausgerechnet dem Nachfahren des legendären „Lügenbarons“ einen solchen Bären aufzubinden vermag.
Als die drei betroffenen Autoren Münchhausens Kritik zur Kenntnis nehmen müssen, ist die Verärgerung groß. Grünewald entwirft für die totgesagte Anthologie eine Traueranzeige: „Es hat dem nachterfüllten, schauervollen Orkus gefallen, die Sonne unseres dornenvollen Erdendaseins, unser einziges, innig geliebtes Kind, ‚Die Orgel‘, an dem wir zu vier Mann unsere ganze Kraft vergeudeten, zu verschlingen. Wir beweinen unsere Seele. Die Jung Bergische Dichtergruppe“. Den Text verziert er mit einem Totenkopf über zwei gekreuzten Knochen.175 Zech hingegen kümmert die Aufregung der Kollegen wenig, er verfolgt seinen persönlichen Karriereplan. Bei Münchhausen fragt er mehrfach an, ob er ihm nunmehr eine Auswahl ausschließlich eigener Gedichte zusenden dürfe. Der Baron lehnt das ab und schlägt vor, der junge Mann aus Holstein solle sich in einigen Monaten wieder bei ihm melden.176
Einige Zeit herrscht unter den „Jungbergischen Dichtern“ Ratlosigkeit, was geschehen soll, dann erinnert sich die Gruppe daran, dass Kerst vor Jahren von einer in Berlin lebenden Autorin aus Elberfeld drei Beiträge für seine Anthologie „Bergische Lieder“ erhalten hat. Sie soll zur Mitwirkung überredet werden. Drei der Kollegen drängen Zech, mit Else Lasker-Schüler einen Kontakt herzustellen. Mitte August schreibt er an die Dichterin.
Auf die Nachricht aus ihrer Geburtsstadt reagiert Lasker-Schüler freundlich: „Es rührt mich, dass die Elberfelder Dichter an mich denken.“177 Den Vorschlag zur Mitarbeit will sie sich überlegen. Die „Jungbergischen“ schöpfen Hoffnung, ihre Lyrik-Sammlung doch noch herausbringen zu können, und beraten, wie sie die arrivierte Kollegin zum Mitmachen bewegen könnten. Die größten Chancen, so rechnen sie sich aus, würden sich bei einem persönlichen Gespräch ergeben. Deshalb soll die Dichterin nach Elberfeld kommen und vor der „Literarischen Gesellschaft“ aus ihren Werken lesen. Eine Einladung kann aber nur deren Vorsitzender Kerst aussprechen. Dieses Mitglied der „Jungbergischen Dichter“ hat die Gruppe bisher übergangen, was ihm nicht verborgen geblieben ist. Nun revanchiert er sich für die erwiesene Nichtachtung und lehnt es ab, tätig zu werden.
Bei der darauffolgenden Kontroverse zwischen Zech und dem Vereinsvorsitzenden setzt sich dieser nicht durch. Grünewald gratuliert dem Sieger: „Lieber Paul! Es freut mich, dass Du mit Kerst so gut fertig geworden bist. Hatten wir von dieser Seite etwas zu erhoffen? Wie stellt sich die Literarische Gesellschaft zu uns?“178 Lasker-Schüler scheint geneigt, der Einladung in ihre Heimatstadt zu folgen. An Zech schreibt sie: „Natürlich würde ich Oktober gern kommen acht Tage in Elberfeld bleiben“.179 Drei Tage später fragt sie nach Einzelheiten der geplanten Lesung und erörtert Möglichkeiten weiterer Auftritte in Düsseldorf und Köln.180 Anfang Oktober wendet sie sich offiziell an Kerst. Der beauftragt Grünewald-Bonn, ihr zu antworten. Dessen Schreiben empört die Dichterin. Dem Verfasser lässt sie einen Vers in Elberfelder Platt übermitteln. Der Empfänger begreift die Botschaft nicht und legt mit einer Antwort nach, die den gebotenen Respekt vor dem weiblichen Geschlecht vermissen lässt. Das bringt die Empfängerin erneut in Rage.
Lasker-Schüler teilt Zech mit, Grünewald habe ihr einen „Dienstmädchenbrief“ geschrieben. Die Reise ins Rheinland sagt sie ab und lässt wissen, von ihr werde es keinen Beitrag für die Publikation der „jung-bergischen Dichter“ geben. Ohnehin habe sie mit Kersts Anthologie („die so lächerlich war“) keine guten Erfahrungen gemacht. Das Anschreiben Grünewalds nennt sie „eine geschmacklose Gemeinheit“. Allerdings bemüht sie sich, nicht die gesamte Gruppe für das Benehmen eines einzelnen Mitglieds verantwortlich zu machen: „Es täte mir in der Seele leid, wenn Herr Fahrenkrog […] von dem Brief des Herrn Grünewald-Bonn wüßte“. Den Kontakt mit Zech will sie aufrechterhalten: „Ich hatte Sympathie für Sie und kenne Sie wohl. Else LSchüler.“ Im Nachsatz steht: „Ich bitte Sie keinen Streit um der Affaire willen – ich möchte keinen Streit hinterlassen – bitte!“181
Zech geht die Angelegenheit weniger nahe, als Lasker-Schüler annimmt. Da deren Besuch nicht stattfinden wird und von ihr auch keine Beiträge für die Anthologie zu erwarten sind, nimmt er seine Korrespondenz mit Münchhausen wieder auf und schickt ihm ausschließlich eigene Gedichte zur Begutachtung. Gleichzeitig teilt er dem Baron mit, er habe der „Literarischen Gesellschaft“ vorgeschlagen, ihn zu einer Lesung nach Elberfeld einzuladen. Bei der Auswahl seiner Gedichte ist er darauf bedacht gewesen, den Geschmack des Kollegen zu treffen. Deshalb befindet sich eine Ballade darunter, „Der Rächer von Wilich“. Sie beginnt so: „Kurt von Arloff schlägt mit der Faust auf den Tisch […]: / Was sagt Ihr, Hammer von Borkenstich, / der Böhme hat Wilich berannt?“ Hier macht Zech Anleihen bei einem der bekanntesten Werke Detlev von Liliencrons, der Ballade „Pidder Lüng“. Sie beginnt. „Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch, / schlägt mit der Faust auf den Eichentisch: / ‚Heut fahr ich selber hinüber nach Sylt‘.“ Die lyrische Reportage vom historischen Freiheitskampf auf der Insel Sylt ist 1891 entstanden und 1902 in einer Neuauflage von Liliencrons „Gesammelten Werken“ erschienen. Zechs Verse muten stellenweise wie eine Parodie der Vorlage an.
Münchhausen redigiert alle zwölf Gedichte.182 Die Anleihe bei Liliencron bemerkt er nicht. Seine Anregungen schickt er dem jungen Kollegen und hofft, nun für eine Weile Ruhe vor ihm zu haben, indem er ihn auffordert, sich erst im nächsten Jahr wieder zu melden.183 Als Zech den Brief erhält, bedankt er sich jedoch sofort für Lob und Tadel. Er bittet den Baron, sich für ihn einzusetzen und begründet das so: „Ich betrachte mich gewissermaßen als Ihren Schüler und mein höchstes Streben soll sein, Ihrer würdig zu werden.“184 Das ist Heuchelei. Zech möchte Karriere machen und dazu will er die Protektion Münchhausens nutzen. Dieser denkt jedoch nicht daran, sich bei „Velhagen & Klasings Monatsheften“, bei der „Gartenlaube“ oder bei der Monatsschrift „Der Türmer“ für den Kollegen einzusetzen.
Wie angekündigt, nimmt Lasker-Schüler erneut Verbindung mit Zech auf und äußert den Wunsch, Geschenke mit ihm zu tauschen. Bunte Steine möchte sie haben, wie die Schulkinder in Elberfeld sie in der Tasche tragen. Als Gegengabe stellt sie ihm Muscheln und einen Federhalter aus Glas in Aussicht. Die Dichterin zeigt dem Kollegen offen ihre Sympathie. Dabei sind persönliche Erinnerungen im Spiel. Ihr Lieblingsbruder heißt Paul und ihrem Sohn hat sie den gleichen Vornamen gegeben. Sie kommt auch nochmals auf die geplante Anthologie zu sprechen: „die Gedichte der anderen Herren sind unkünstlerisch total kindisch, talentlos. […] Sie und wir können kein Buch herausgeben mit diesen Herren.“ Lasker-Schüler rät Zech, seine Arbeiten dem britischen Autor Jethro Bithell sowie dem Dichter Richard Dehmel zur Begutachtung vorzulegen. Ferner teilt sie ihm mit, Peter Baum habe bei ihr angerufen und gesagt, von den Versen der Gruppe seien nur die von Zech brauchbar. Der Kollege ist 1869 in Elberfeld geboren.
Schließlich fragt Lasker-Schüler: „Daß Münchhausen Dehmel denunziert hat vor Zeiten wissen Sie doch?“185 Demnach ist sie über Zechs Kontakte zum Baron informiert und möchte nun erfahren, wie er dessen Verhalten einschätzt. 1896 hat Münchhausen Dehmel wegen dessen angeblich unzüchtigen und blasphemischen Gedichts „Verwandlungen der Venus“ angezeigt. Dehmel ist daraufhin gezwungen gewesen, den bean-standeten Text in der Erstausgabe seiner Werke schwärzen zu lassen. Zech liest über diese Mitteilung hinweg, denn noch will er es mit Münchhausen nicht verderben. Zwei Tage später meldet sich Lasker-Schüler nochmals: „Es tut mir schrecklich leid, ja es ist für mich eine Pein, daß ich Ihren Freunden nichts Gutes sagen kann künstlerisch“. Als Begründung führt sie an: „Lieber Paul Zech, in Kunstdingen muß man wahr bleiben – das ist unser Halt.“186