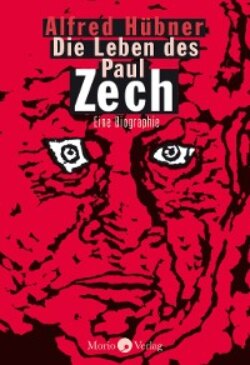Читать книгу Die Leben des Paul Zech - Alfred Hübner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel
ОглавлениеDie große Liebe
Anfang Januar liest Rilke in Elberfeld vor den Mitgliedern der „Literarischen Gesellschaft“ aus eigenen Werken. Auf der Einladung steht, wofür es keine Erklärung gibt, Zechs Gedicht „Du bist die Ruh“. Es könnte ein Zeichen für Zechs gewachsenes Ansehen im Wuppertal sein. Er ist von Heinrich Toelke beauftragt, im „General-Anzeiger“ über den Abend zu berichten, und gestaltet seinen Beitrag zum sprachlichen Kunstwerk, das so beginnt: „Drei Worte nenn‘ ich euch: Rainer Maria Rilke.“ Dieses Stakkato wiederholt er: „Zuweilen eine einsame Flöte. Ganz Wehmut. Ganz Betrachtung. Und dann Pan. Und Duft von Faulbaum und Heliotrop.“ Ein Vorbehalt am Ende gilt dem Publikum: „O, diese Flagellanten der geliebten Form, der Wortkultur. Ein neuer Irrtum. Rainer-Maria-Rilke. Schade!“1
Der Dichter ist während seines Aufenthaltes in Elberfeld Gast von August und Selma von der Heydt. In diesen Kreisen verkehrt der Korrespondent des „General-Anzeigers“ nicht. Deshalb findet nach der Veranstaltung auch kein Gespräch zwischen ihm und Rilke statt, zumal er die Lesung nicht allein besucht. Emmy Schattke ist mit dabei. Ihren Begleiter versetzt der Abend in derart euphorische Stimmung, dass er spontan das Gedicht „Eve“ verfasst und mit der Widmung versieht: „Fräulein Emmy Schattke in kameradschaftlicher Freundschaft“. Am unteren Rand des Blattes findet sich in Versalien das Wort „Liebe“.2
Toelke beauftragt Zech nun regelmäßig, für den Kulturteil seines Blattes Beiträge zu schreiben. Stadtarchivar Uwe Eckardt hält dazu fest: „Es hat meines Wissens in der Geschichte der Lokalzeitungen des Wuppertals weder davor noch danach einen Abschnitt gegeben, in dem ebenso umfassend und engagiert über zeitgenössische Literatur berichtet worden ist wie in den drei Jahren, in denen Paul Zech im ‚General-Anzeiger‘ für die Rezensionen verantwortlich gezeichnet hat. Weit über 100 Bücher stellt er in diesem Zeitraum vor.“3
Mit der journalistischen Tätigkeit kann Paul gegenüber Helene seine oftmalige häusliche Abwesenheit glaubhaft begründen. Da sie stets gefordert hat, er müsse mehr Geld verdienen, ist ihr die Möglichkeit genommen, darauf zu bestehen, er solle öfter im Familienkreis zugegen sein. Nach außen hin scheint das Eheleben der beiden in Ordnung, doch der Schein trügt. Der Familienvater schwärmt für die junge Lehrerin.
Emmy Schattke um 1910
Obwohl für Zech in beruflicher Hinsicht alles nach Wunsch läuft, erkundigt er sich weiterhin bei Freunden und Bekannten nach Möglichkeiten zur Drucklegung seiner Gedichte. Eine Grußkarte von Lasker-Schüler zum neuen Jahr4 beantwortet er möglicherweise deshalb vier Monate lang nicht, weil es ihm gelungen ist, einen neuen Kontakt zu knüpfen, den er für vielversprechend hält. Vor der Jahreswende hat er an Stefan Zweig geschrieben, ihn zu einer Lesung nach Elberfeld eingeladen und ihm Gedichte geschickt. Der Kollege will, wie er mitteilt, gerne kommen, sofern sich weitere Stationen für eine Lesereise finden ließen. Die Talent-proben lobt er: „Ich empfinde alle drei Gedichte als sehr schön und rein, und danke für diesen Eindruck.“ Vorbehalte kleidet er höflich in eine Erinnerung: er und seine Freunde hätten früh, „zu früh angefangen und wir müssen nun ernstlich an uns arbeiten und uns nicht von den allzu leichten Erfolgen der ersten glatten Versuche verführen lassen“. Auf eine neuere Publikation ist er jedoch stolz: „Im Frühjahr erscheinen meine drei Bände Verhaeren: hier glaube ich wirklich eine Tat vollbracht zu haben […]: ich hoffe, sie ist gelungen.“5 Ihm liegt daran, das Werk des belgischen Kollegen, mit dem er seit 1902 befreundet ist, im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen.
Bei den „Jungbergischen Dichtern“ bilden sich zwei Lager. Eines um Kerst, das andere um Fahrenkrog. Unabhängig davon verfolgt Zech weiter eigene Pläne zur Veröffentlichung seiner Werke. Für Schattke verfasst er das Gedicht „An E.“, dessen zweite Strophe den Wunsch enthält: „Laß mich bei Dir sein, / Du an der [!] ich mein Lebtag geglaubt.“ Der Fehler ist möglicherweise durch Frühlingsgefühle verursacht, die der Verfasser hegt: „Sieh, meine Seele strebt / Zu Dir empor wie ein Baum, / Und wartet und bebt / Auf den großen Frühlingstraum.“ Das Geständnis enthält Anleihen aus einem Band „Gedichte“ des Juristen Carl Bulcke, der gereimt hat: „Sieh, meine Seele strebt, ein armer Baum / Den Himmel an mit winterkahlen Zweigen, / Und wartet auf den großen Frühlingstraum.“6
Im April kommt die Anthologie „Bergische Lieder. [Eine] Zusammenstellung der zu den Kölner Blumenspielen 1907 eingesandten Gedichte auf das Bergische Land um den Remscheider Preis“ heraus. Da Fastenrath inzwischen verstorben ist, hat sich das Erscheinen verzögert. Zech ist in der Publikation mit den vier Gedichten vertreten, für die er vor drei Jahren eine „lobende Erwähnung“ erhalten hat. Damit steht seine Lyrik erstmals nicht nur in einer Zeitschrift oder Zeitung, sondern in einem Buch. Bei den Gedichten der anderen Autoren, die darin vertreten sind, handelt es sich ebenfalls um Lobpreisungen der Region. Eine davon stammt von Carl Robert Schmidt. Mit ihm, einem Lehrer, der in Remscheid lebt und arbeitet, ist Zech seit längerer Zeit bekannt. Durch zahlreiche Besuche bei ihm fühlt er sich in der Nachbarstadt wie zu Hause und behauptet in den Zwanzigerjahren: „Ich wohnte lange in einem schön geschnörkelten Haus an der Straße, die schräg nach Burg herunterschießt.“7
Schattke unternimmt nichts, um Zech aus dem „Frühlingstraum“ zu wecken, und setzt den Briefwechsel fort. Nach Erhalt des Gedichts „An E.“ hat sie ihm mehrmals geschrieben. Nun wird ein gemeinsamer Theaterbesuch geplant, der jedoch nicht zustande kommt, weil Zech kurz vorher absagt: „Bin aus meinen vier Wänden nicht herausgekommen. Inzwischen habe ich nichts Wesentliches auf literarischem Gebiet getan. Ich bin in einer unverändert schlechten Stimmung.“ Eine Visite beim Fotografen hat ihm zusätzlich die Laune verdorben. Dessen Aufnahmen missfallen ihm: „Meine liebe Eitelkeit hat einen kräftigen Stoß erhalten. Das ist nicht der Paul Zech, den ich mir erträumte. Aber der andere, echte P. Z., in seiner ganzen abstoßenden Hässlichkeit.“ Die Ursache des Stimmungstiefs können diesmal keine Geldsorgen sein, denn der Chefredakteur des „General-Anzeigers“ deckt den Mitarbeiter mit Aufträgen ein. Im Brief an Schattke heißt es: „Tölke schickte mir zwei Romane zur Besprechung. Jeder Roman von circa hundert Seiten. O ich Ärmster.“ Der Brief belegt auch, wie Lasker-Schüler sich darum bemüht, ihre Verbindung nach Elberfeld nicht abreißen zu lassen: „Frau Schüler hat mir auch geschrieben, und zwar, dass sie bald nach hier komme.“8
Trotz der Fülle an Buchbesprechungen, die er schreiben soll, scheint Zech als Autor nicht ausgelastet zu sein. Schattke schickt er ein Feuilleton mit Eindrücken von einem Morgenspaziergang zur Elberfelder „Königshöhe“. Er möchte sie veranlassen, ihn am übernächsten Tag vier Stunden nach Mitternacht auf einem „Gang in die Morgenweihe“ zu begleiten. Die Lehrerin muss an Werktagen spätestens um acht Uhr morgens in der Schule sein. Zech hat, wie er weiter mitteilt, von der „Insel der Seligen“ aus der Artussage geträumt: „wir wären gewandert Hand in Hand durch die blühenden Gärten und grünen Waldmorgen Awaluns und Kinder streuten Rosen vor uns her und der Abend reichte uns goldene Kronen.“9 Für eine Antwort gewährt er der Eingeladenen zwölf Stunden Bedenkzeit.
Emmy Schattke ihrerseits verblüfft Zech, indem sie ihm ankündigt, in den kommenden Tagen die deutsche Hauptstadt besuchen zu wollen. In der Nacht zu Pfingstsonntag, morgens ein Uhr, schreibt er an sie: „Gold Herz! Sehr überraschend kam mir Ihre Pfingstfahrt nach Berlin. Haben Sie das große Los gezogen?“ Rasch fällt ihm ein, wie er diese Reise für seine Pläne nutzen könnte: „Vor allem gehen Sie zu Frau Else Lasker-Schüler. Ich lege einen Brief bei, der mag Empfehlung sein. Legen Sie meiner großen Freundin ans Herz, bald nach hier zu kommen.“10 Nachdem er den Brief verschlossen hat, legt er sich vier Stunden schlafen und steht um fünf Uhr auf, um ein Frühkonzert in den Parkanlagen von Barmen zu besuchen. Pfingsten verbringt der Familienvater nicht mit Frau und Kindern. Diese unternehmen mit dem Ehepaar Grünewald eine Schiffstour auf dem Rhein.
Auf Zechs Vorschlag geht Schattke ein und besucht in Berlin Lasker-Schüler. Zurück in Elberfeld möchte sie ihn am folgenden Wochenende sehen, um ihm von ihren Erlebnissen zu berichten. Er gerät in Bedrängnis, weil sich zum fraglichen Zeitpunkt seine Schwägerin und deren Mann in der Neuen Gerstenstraße angesagt haben. Die Ehepaare machen bisweilen gemeinsam einen Spaziergang. Überliefert ist ein Foto, aufgenommen von Helene auf der Hardt. Es zeigt zwei selbstbewusst dreinblickende Herren, jeweils mit einem Spazierstock in der rechten Hand, auf dem Kopf Strohhüte nach der Mode der Zeit. Sie posieren links und rechts von Julia Bunse, die zum langen Kleid der Wilhelminischen Ära einen ausladenden Hut mit prächtiger Garnierung aus Stoffblumen trägt. Vom Aussehen her wirkt Zech nicht wie jemand, der mit seiner Familie an der Armutsgrenze lebt, sondern wie ein gut situierter sorgenfreier Bürger.11
Misstrauischer als Helene beobachten die Bunses Pauls Damenbekanntschaft. Er muss sich für Schattke etwas einfallen lassen, weshalb er nicht zum Treffen mit ihr kommen kann, und schützt berufliche Verpflichtungen vor. Was dann geschieht, könnte vom Verfasser eines zeitgenössischen Schwanks nicht komischer erfunden sein: Beim Sonntagsspaziergang treffen die Ehepaare Zech und Bunse zufällig mit Schattke zusammen. Der überführte Schwindler gerät der Lehrerin gegenüber in Erklärungsnot. Nach einem kurzen Austausch von höflichen Floskeln trennt man sich hastig. Schwester und Schwager machen Helene Vorhaltungen, weshalb sie sich nicht energischer gegen diesen Umgang ihres Ehemannes wehre. Der gewinnt rasch seine Fassung wieder und sieht im Angriff die beste Verteidigung. Als Schriftsteller benötige er, so seine Argumentation, für das eigene Schaffen intellektuellen Austausch, und den pflege er mit Fräulein Schattke.
Die Lehrerin schreibt zu Anfang der Woche einen (nicht überlieferten) Brief an Helene, über den sich diese ärgert. An ihrer Stelle antwortet der Ehemann: „Zürnen Sie nicht, dass ich mit dem Schreiben so lange zögerte. Ich war aber eher nicht imstande.“ Er macht zunächst seinem Unmut über die Bunses Luft: „Ich kann und kann es nicht verstehen, dass im Verkehr zwischen Künstler und Künstlerin die Banausen immer ein erotisches Motiv wittern.“ Schattke soll ihn und seine Familie zur Versöhnung zu Hause besuchen. Bis Freitag dieser Woche will er wissen, ob sie den Vorschlag annimmt. An dem Tag empfangen Max und Male Pohl, gemeinsame Bekannte aus dem Kreis des „Volkserziehers“, Gäste, unter ihnen Zech und weitere Mitglieder des Barmer Stammtisches: „ich hoffe, dass ich Sie bei Pohls begrüßen darf. Tun Sie es mir nicht an und schreiben ab. Ich brauche zuweilen einen Halt. Ich denke: Sie sind er.“ Am Schluss des Briefes heißt es: „Viele Grüße und Segnungen Ihr Paul Zech“.12 Der Wunsch verfehlt seine Wirkung. Die Lehrerin will künftig nicht mehr mit ihm zusammenkommen.
Paul Zech mit Schwägerin und Schwager, Julia und Gustav Bunse
Fahrenkrog genügt die „Deutsch-Religiöse Gemeinde“ nicht, um seine Mission als Weltverbesserer erfüllen zu können. Deshalb hat er einen „Deutschen Bund für Persönlichkeitskultur“ gegründet und sich zu dessen Erstem Vorsitzenden wählen lassen. Als aktive Mitglieder innerhalb der Vereinsführung gewinnt er die Pohls. Harry Kramer, der im hessischen Arolsen als Redakteur der dortigen Lokalzeitung tätig ist, wird „Schriftleiter“ des Vereinsorgans „Mehr Licht!“. Zech liefert ihm Verse, die sich gegen die Institution Kirche wenden. Den Anfang macht ein Gedicht mit dem Titel „Götzendienst“: „Oh, wüssten wir es doch, dass alle Türen / Nur auf den Weg zu neuen Wegen führen.“13 Das gefällt Kramer und er schiebt einen weiteren Text mit gleicher Tendenz nach.14
Nachhilfe von Münchhausen
Zech schickt fünfzehn Gedichte an Münchhausen, alle zu den Themen Jahreszeiten, Schönheit der Natur und Frömmigkeit. Im Begleitbrief beugt er vor: „Erschrecken Sie bitte nicht, dass ich nun schon wieder mit Versen komme. Sie waren aber so liebenswürdig und erbaten […] im Frühjahr weitere Gedichte zur gefälligen Durchsicht.“ „Velhagen & Klasings Monatshefte“, so teilt er mit, hätten keines seiner Gedichte veröffentlicht, trotz eines Hinweises auf das positive Urteil des Herrn Barons. In gespielter Bescheidenheit erklärt er: „Ich bin gewiss nicht eitel und verlange auch durchaus keine breite Würdigung meiner lyrischen Künste. Ich hätte es aber doch gern gesehen, wenn mir ein paar Groschen zugekommen wären.“ Der Sohn eines reichen Landwirtes aus Holstein, als den er sich gegenüber Münchhausen ausgibt, bezeichnet seine Verhältnisse als „nicht glänzend“: „Meine Studien haben viel verschlungen“. Geld sei ihm daher wichtiger als Anerkennung: „Auf einen sogenannten Ruhm pfeife ich.“ Tatsächlich will er beides. Da sich die „Literarische Gesellschaft“ gegen eine Lesung Münchhausens in Elberfeld ausgesprochen hat, kann er nicht umhin, das dem Baron mitzuteilen. An dessen Stelle soll der Schriftsteller Gustav Schüler auftreten. Etwas unsicher beendet Zech den Brief mit der Schmeichelei: „In der hiesigen Stadtbücherei fand ich auch Ihre Balladen. Mir war das Buch eine Offenbarung. Ich habe es dreimal entliehen.“15
Münchhausen lobt Zechs Gedichte: „Ich […] bekenne offen, dass ich seit langer Zeit nicht so viel gutes in der Hand gehabt habe.“ Er kreidet ihm aber grammatikalische Fehler an sowie Sprachbilder, die seiner Ansicht nach schlecht sind. Zudem bringt er einen grundsätzlichen Einwand vor: „auch entfernen sich Ihre letzten Gedichte mehr und mehr von der Wirklichkeit.“ Das Plagiat „Der Rächer von Wilich“ bleibt weiter unbeanstandet. Die Übereinstimmungen mit Liliencrons Gedicht hat der Baron nicht entdeckt. Zechs trotziger Bemerkung: „Auf einen sogenannten Ruhm pfeife ich“ hält er ein Wort Nietzsches entgegen: „Das Gute soll nicht nur herrschen, das Gute will auch herrschen und sich durchsetzen.“ Den Auftritt des Kollegen Gustav Schüler, der an seiner Stelle vor den Mitgliedern der „Literarischen Gesellschaft“ in Elberfeld lesen soll, kommentiert er ironisch: „die Leutchen haben ja […] wenn auch keinen überragenden Geist, so doch einen tüchtigen und geschickten Versmacher sich engagiert.“16
Durch die positive Antwort sieht sich Zech veranlasst, dem Mentor noch mehr Gedichte zu schicken. Diesem ist die Nachwuchsförderung jedoch endgültig lästig. Das zeigen seine Randbemerkungen in den Manuskripten, die er dem Verfasser wieder nicht zurückgibt, sondern an seinem Wohnsitz, Schloss Windischleuba, aufbewahrt: „Russ und Rauch“ hält er für „Grässliche Hofmannsthalerei“, zu „Spätherbst“ merkt er an: „Grässliche Wienerei, man wird ja seekrank bei dem ewigen Geschaukel des Enjambements!“, und das Gedicht „Zum Abend“ findet er „ganz nett“, aber „zu sehr Hofmannsthal“.17
In einem (verlorenen) Brief, dessen Inhalt sich aus der Antwort des Empfängers erschließen lässt, macht Münchhausen Zech Vorwürfe „wegen fehlender Distanz zu den Wiener Juden-Ästheten“. Vorerst, so lässt er ihn wissen, werde er keine Zeit mehr zum Verbessern der Verse finden. Der „Schüler“ widerspricht seinem Lehrer nicht, übergeht aber dessen Ratschläge. Sämtliche Verse, die dem Baron missfallen, wirft er nicht in den Papierkorb, wie er später behauptet, sondern bietet sie weiterhin Zeitungen und Zeitschriften zur Veröffentlichung an. Mit traditioneller Lyrik möchte er sein Einkommen verbessern und mittels neuer Gedichte als Vertreter der „jungen Autoren“ Beachtung finden.
Else Lasker-Schüler fordert Zech auf: „Bitte senden Sie von sich einige Gedichte zur Auswahl […] an Redaktion: Der Sturm Herwarth Walden“.18 Das macht er sofort. Die Dichterin bestätigt den Erhalt der Sendung und stellt ihm in Aussicht, bald ins Bergische Land zu reisen: „Vielleicht bringe ich meinen Jungen mit nach Elberfeld, da ich hörte, Sie haben auch einen Bengel.“ Der Brief schließt: „Ich grüße Sie auch Ihre Frau [sic!]. Tino von Bagdad.“19 Lasker-Schüler setzt in die Tat um, was sich Zech von Münchhausen erhofft hat. Sie schickt seine Manuskripte an die Redaktionen der Berliner Zeitungen. Eine von ihnen, „Der Tag“, veröffentlicht das Gedicht „Ausklang“.20
Helene ist unverändert misstrauisch, was die Treue ihres Mannes betrifft. Das lässt ihn an Scheidung denken. Schattke schreibt er: „Wenn meine Frau mit dem Feuer spielen will – mag sie sich die Finger verbrennen. […] was ich tu‘ und treibe kann das Tageslicht vertragen. Sind meine Lieben zu dumm das zu begreifen, so mögen sie eben die Konsequenzen ziehen.“ Auch die Freundin ist noch wütend über den sonntäglichen Vorfall und möchte keinen Kontakt mit ihm. Ihre Briefe hat sie zurückverlangt und angekündigt, die seinen zu verbrennen. Das kann er nicht zulassen. Um Schattke umzustimmen, verweist er auf ein tragisches Paar der Literaturgeschichte: „Ich erzittre aber vor dem Verlust Ihrer Freundschaft. Lesen Sie das Schicksal Lenaus und Sophie von Löwenthals – und dann werfen Sie den ersten Stein auf mich.“ Das zeigt, in welchem literarischen Umfeld Zech, der angeblich uneitel ist, sein Werk sieht. Unter der Grußformel mit „Handkuß“ steht: „Soweit ich sie noch hatte, finden Sie die Briefe anbei“.21
Auf Zechs Frage an Lasker-Schüler, wie seine Arbeiten Walden gefallen haben, erwidert diese: „Ihre Gedichte sind, glaube ich, genommen.“ Es ist ihr gelungen, den Herausgeber des „Sturm“ von der Qualität der Verse zu überzeugen, weshalb bald regelmäßig neue Titel in der Zeitschrift erscheinen. Sie selbst lobt: „Ihr Gedicht im ‚Tag‘ wundervoll.“22 Einen Monat später stellt sie erneut in Aussicht: „Vielleicht kommen Herwarth Walden und ich bald nach Elberfeld.“23 Das Ehepaar will im Rheinland für den „Sturm“ Werbung machen.
Zech hat Zweig auf seinen Brief von Mitte Januar geantwortet und ihm mitgeteilt, er plane, erstmals ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Dazu schreibt ihm der Kollege: „Ich wünsche Ihnen, dass […] es Ihnen besser ergehen möge, als mir bei Verhaeren: von Woche zu Woche hingehalten, mit immer neuen Ausreden vertröstet.“ In der (nicht überlieferten) Mitteilung hat Zech wissen lassen, er liebe das Werk des belgischen Dichters und sei auch bereit, sich für diesen zu engagieren. Die Reaktion darauf aus Wien: „Sie haben ja recht – es sind viele, die Verhaeren lieben, aber wahrhaft wertvoll ist doch nur tätige, wirkende Liebe, die Liebe weiter verbreitet.“ Zweig prophezeit richtig: „Vielleicht wird Verhaeren ihr Gedicht beeinflussen: wehren Sie sich nicht, ich habe mich auch gefürchtet und bin nun froh, mich doch dem Ganzen hingegeben zu haben.“ Er bestärkt Zech, Texte aus fremden Sprachen zu übertragen: „Ich freue mich bestätigt zu finden, dass immer diejenigen, die es verstehen, sich fremden Werken hinzugeben […] damit innerlich ihr eigenes Werk kräftigen.“ Zudem kündigt er an: „Ich selbst gehe jetzt zu Verhaeren auf Besuch nach Belgien: ich will Ihnen als Förderer des Werkes eine gemeinsame Karte senden oder eine Fotografie erwirken.“24
Gegenüber Rudolf Presber, dem Redakteur der Zeitschriften „Über Land und Meer“ sowie „Arena“, klagt Zech: „Ich ringe schon seit Jahren um ein wenig Anerkennung und es wird mir durchaus nicht leicht gemacht, sodass ich manchmal an meinem bescheidenen Talent zweifle.“ Nach dieser nicht ernst gemeinten Untertreibung fährt er fort: „Börries von Münchhausen, der zuweilen meine neuen Verse liest, ermuntert mich stets zu weiterem Schaffen und schrieb mir kürzlich unter anderem ‚Sie müssen sich durchsetzen. Bei Ihrer durchaus originellen Eigenart kann ein Erfolg nicht ausbleiben‘.“ Dann kommt er zur Sache und verweist auf ein „lyrisches Flugblatt“, das in Kürze mit Gedichten von ihm erscheinen soll. Seinem Brief fügt er die Verse „Nachtgesang“ bei und hofft auf deren Veröffentlichung.25 Der Redakteur druckt von nun an tatsächlich regelmäßig Zechs Lyrik in beiden Blättern ab.
Im Juli 1910 stirbt in Briesen Emilie Zech. Ihr ältester Sohn fährt zur Beerdigung nach Westpreußen: „Der Zug geht und kommt in langsamen Atempausen. Gleitet in den Bahnhof wie das kantige Gewicht einer Stangenwaage und wiegt dem Hutzelort die Pfunde seines Daseins zu.“26 Als die Tote auf dem evangelischen Friedhof an der Schönseer Straße zu Grabe getragen wird, geben ihr noch zwei weitere Söhne das letzte Geleit. Zum älteren von beiden hält Paul mehr als den üblichen oberflächlichen Kontakt, obwohl er ihn früher nicht gemocht hat: Eines der Gedichte, die an Münchhausen gegangen sind, „Sommernacht“, trägt die Widmung „Für Rudolf Zech“.27 Auch Elisabeth, die Lieblingsschwester, ist mit Ehemann und Kindern aus dem nahen Strasburg zur Beerdigung gekommen. Die zwölfjährige Ida, Pauls jüngste Schwester, wohnt noch im Elternhaus. Auf die Anwesenheit von Bruder Gustav, geboren Ende 1894, gibt es keinen Hinweis. An der Spitze des Trauerzuges gehen in Briesen hinter dem Sarg der Pfarrer sowie der Witwer Adolf Zech und die Kinder der Toten. Ihnen folgt eine große Anzahl von Enkeln, nahen Verwandten, Freunden und Nachbarn. Den Vater wird Paul künftig meiden, wie er später bedauert: „Man hat viele Jahre hinter sich. Vielleicht war man in einem der allerfrühesten so schuldig. Kurz nachdem mir die Mutter wegstarb und der Vater mir so fremd wurde, dass ich ihn nicht mehr wiedersah.“28
Emilie Zech im Jahre 1910
Zech fährt von Westpreußen aus nicht direkt ins Bergische Land. Schattke schreibt er: „Freitag voriger Woche habe ich meine Mutter begraben. Auf der Rückreise vom Begräbnis machte ich in Berlin Halt und besuchte Else Lasker-Schüler, der es auch sehr schlecht geht.“29 Er berichtet auch von einem Gespräch mit Walden, dem er dabei vorgeschlagen hat, Besprechungsexemplare des „Sturm“ an die Lokalzeitungen im Wuppertal zu schicken. Wieder daheim, erreicht ihn vom Herausgeber die Mitteilung: „Wie ich festgestellt habe, erhält der Generalanzeiger von Elberfeld bereits seit Bestehen unsere Zeitschrift zugestellt. Eine Notiz über den Sturm ist unseres Wissens bisher noch nicht erschienen.“ Walden bittet: “Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das freundlichst veranlassen würden.“30
Spaziergang mit Kokoschka
1910 feiert Elberfeld sein dreihundertjähriges Bestehen als Stadt. Vor Beginn einer „Festwoche“, die im Sommer den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet, erscheint eine Sonderbeilage des „General-Anzeigers“, in der das Programm ausführlich vorgestellt wird. Von Zech steht im Innenteil ein Gedicht, „Nachtgebet“31, aber die Titelseite ist einem „Festgruß“ von Walter Bloem vorbehalten.32 Die Barmer „Allgemeine Zeitung“ bringt zum Jubiläum ein Feuilleton „Elberfeld und seine zeitgenössischen Dichter“ von Leo Grein. Darin heißt es: „Zech ist […] der vollendetste Sprachkünstler unter den Wuppertaler Dichtern. In seiner hohen Sprachkultur kommt er den Jung-Wienern in ihren besten Vertretern nahe. Ich halte ihn für den augenblicklich besten bergischen Dichter.“ Als Gründe zählt der Autor auf: „Dieser einsame Grübler und Träumer hat ein erstaunliches Gehör für Rhythmus und Wortmelodie und ist reich an überraschenden Bildern und Gedanken.“33 Der Gelobte widmet Grein zum Dank sein Gedicht „Novembernacht“.34
Aus Berlin erhält Zech überraschend die Nachricht: „Wir kommen dieser Tage nach Elberfeld, ich komm plötzlich zu Ihnen – passen Sie nur auf. Grüßen Sie ihre Frau und Däumling. Viele Grüße Ihre Else Lasker-Sc[hüler]“. Weiter schreibt sie: „Mein Mann grüßt herzlich. Wahrscheinlich kommt Oskar Kokoschka mit.“35 Vor Ankunft der Gäste hat Zech Stress durch Emmy Schattke. Sie ist über erotische Gedichte verärgert, die er ihr gewidmet hat. Das ergibt sich aus dem Wortlaut von Pauls Versuch, die Freundin zu beschwichtigen: „Ich komme mir vor wie Adam, als er aus dem Paradies vertrieben wurde. Ich finde aber keinen Schatten, meine brennende Scham zu bedecken. […] Handkuß und Grüße bestens Paul Zech“.36
Am 10. August steigen Lasker-Schüler, Walden und Kokoschka im Elberfelder Hotel „Weidenhof“ ab. Für die Gäste und Zech ist der mehrtägige Besuch erfüllt von bleibenden Eindrücken. Über die berichten drei von ihnen später in schriftlicher Form. Lasker-Schüler schreibt ein Loblied auf ihren Heimatort und erzählt, wie sie auf den Straßen ihrer Kindheit durch die Stadt flaniert. Begleitet wird sie von Zech. Ab diesem Zeitpunkt ist er ihr „Wupperfreund“. Als Paul beim Rundgang über einen Jahrmarkt längst genug hat von Luftschaukeln und Kirmesmusik, will sie immer noch mal Karussell fahren und überredet ihn schließlich zum Besuch des Kölner „Hännesken“-Theaters.37
Kokoschka berichtet über den Versuch der drei, Abonnenten für den „Sturm“ zu gewinnen: „Die einzelnen Nummern warfen wir in die Postkästen der Villen und Häuser in den Städten, die uns für unsere Werbung günstig erschienen.“ Der Erfolg ist bescheiden. Das mag nicht zuletzt am Erscheinungsbild der Truppe liegen, die Werbung treibt. Lasker-Schüler trägt auf ihrem langen schwarzen Haar einen Turban, steckt in weiten bunten Pluderhosen und raucht auf der Straße mit einer langen Spitze Zigaretten. Walden hat einen verschlissenen schwarzen Gehrock an, dazu ein weißes Hemd mit hohem Stehkragen und gelbe Schnabelschuhe. Kokoschka sieht nicht weniger exotisch aus: „ich war ebenso komisch-elegant noch vom kaiserlichen Schneider in Wien gekleidet.“ Die rheinische Bevölkerung toleriert solche Bekleidung nur während des Karnevals: „[Wir] wurden natürlich von den zusammenlaufenden Passanten belacht, verhöhnt, von Kindern bejubelt und von verärgerten Studenten fast verhauen.“38
Zech geht später mehrfach auf den Besuch aus Berlin ein. In „Die Reise um den Kummerberg“ schreibt er: „Mit Kokoschka nahm ich, nach einer Visite beim August von der Heydt[-Museum], im Sturm die Königshöhe“.39 Aufzeichnungen aus der Emigrationszeit enthalten Angaben darüber, was er gemeinsam mit Lasker-Schüler unternommen hat: „Drei Vormittage lang trieben wir uns, die Dichterin und ich, auf der Königshöhe herum“. Erwähnung findet an dieser Stelle auch eine Episode, in deren Verlauf die beiden auf dem Rückweg Kindern bunte Glasabfälle aus den örtlichen Knopffabriken, sogenannte „Knippsteine“, abkaufen und damit um die Wette spielen, bis Lasker-Schüler gewonnen hat. Frei erfunden ist Zechs Behauptung: „Ich war auf ein Telegramm der Dichterin hin aus dem ‚Kohlenpott‘ herübergekommen.“ Er und seine Familie haben ihren festen Wohnsitz in Elberfeld.
Um ein Phantasieprodukt handelt es sich auch bei der Schilderung in diesem Text, wie Lasker-Schüler nach Ende der Vorstellung im „Hännesken“-Theater aufspringt und lautstark eine Aufführung ihres Stückes „Die Wupper“ im Elberfelder Stadttheater fordert. Ihr Begleiter muss auf ihren Wunsch hin „den Lukas hauen“. Da ihm das gut gelingt, bekommt er einen Blechorden, den er an sie weiterreicht. „Mit einem halben Dutzend heißer Waffeln, ‚blutfrisch ut de Pann‘, nahm der Spaß […] schließlich ein Ende.“ Zech erzählt ferner Märchen vom Besuch einer Ausstellung im Städtischen Museum, wo Portraits prominenter Persönlichkeiten hängen, und behauptet, sein Bildnis habe sich darunter befunden. Weder gibt es 1910 ein solches Gemälde, noch hat die Stadt irgendeine Veranlassung, ihn in ihrem Museum zu ehren.
Dem wirklichen Geschehen näher ist der Satz: „Wir schrieben auf der Wiese Spottbriefe an Walden und Kokoschka, die einen Abstecher nach Hagen gemacht hatten, um mit Osthaus, dem Begründer und derzeitigen Besitzer des ‚Folkwang-Museums‘ geschäftlich zu verhandeln.“40 Die beiden Herren besuchen den Mäzen, um mit ihm die Möglichkeiten einer Ausstellung in seinem Haus zu erörtern. Es sollen frühe Arbeiten Kokoschkas gezeigt werden, die kürzlich in Paul Cassirers Galerie an der Berliner Viktoriastraße erstmals in Deutschland zu sehen gewesen sind. Die Eröffnung ist für August geplant. Kokoschka willigt ein. Zufrieden fahren beide Männer nach Elberfeld zurück. Während ihres restlichen Aufenthaltes verbringen die Gäste aus Berlin auch einen Abend im „Café Holländer“. Zech hat sich mit Schattke versöhnt. Sie ist in der Runde mit dabei.41 Schließlich müssen die drei Besucher ihre Reise abbrechen, weil sie kein Geld mehr haben.
Im „Sturm“ liest Zech Lasker-Schülers Artikel über Kokoschkas Werke, die sie bei Cassirer gesehen hat.42 Das macht ihn neugierig und er beschließt, die Bilder ebenfalls anzuschauen. Walden erfährt von ihm: „Gestern war ich in Hagen und habe dort die Ausstellung von Kokoschka besucht. Ich muss mich erst wieder 24 Stunden an die Wirklichkeit gewöhnen. Kokoschka hat mich betäubt. Noch kann ich nicht alles fassen.“ Nach diesem Erlebnis steht für ihn fest: So wie bisher kann und will er nicht weitermachen. Walden schreibt er: „Zwei Tage nach Ihrer Abreise empfing ich von Herrn Kerst einen saugroben Brief. Ich habe noch gröber geantwortet. Jetzt bin ich hier vollständig unten durch. Desto besser.“ Abschließend bittet er um Beistand in diesem Streit: „Es würde eine gute Waffe für mich sein, ein paar Arbeiten im ‚Sturm‘ zu haben, damit ich den Elberfeldern eins auswischen kann!“43
Zweig hält sein Versprechen. Während des Besuchs bei Verhaeren bittet er den Gastgeber, auf einer Ansichtskarte, die er Zech schicken will, zu unterschreiben. Deren Bildseite zeigt: „Angre. La Honelle. L‘Eglise“, eine Kirche sowie vier Häuser. Eines davon ist gekennzeichnet und Zweig notiert daneben: „Viele Grüße von Verhaerens Heim.“44 Unter seinem Namen findet sich der des belgischen Dichters. Daraus macht der Empfänger Jahre später folgende Story: „Es geschah auf dem belgischen Landgut Verhaerens im Jahre 1909, dass wir uns zum ersten Mal als ‚Kollegen‘ die Hand schüttelten.“ Als Zeugen der Begegnung nennt er Zweig und schildert ein Detail der Unterhaltung, das ebenso seiner Phantasie entspringt wie die Begegnung selbst: „Verhaeren prophezeite uns beiden ein biblisches Alter und sich einen frühen und tragischen Tod.“45 Dank der Fürsprache Zweigs kann Zech ab 1910 mit dem belgischen Dichter korrespondieren und einige von dessen Werken ins Deutsche übertragen, persönlich begegnet er ihm nie.
Vorzeitiges Gebimmel
Fahrenkrog nimmt Verbindung mit Alfred Richard Meyer auf, einem Literaten, der bei der Leipziger „Offizin W. Drugulin“ „Lyrische Flugblätter“ am Fließband drucken lässt und sie preiswert in den Handel bringt. Beide werden sich über die Veröffentlichung einer Ausgabe einig, die zwölf Gedichte der „Jungbergischen Dichtergruppe“ enthält. Das Heft erscheint unter dem Titel „Das frühe Geläut“. Böse Berliner Zungen bezeichnen den Inhalt als „vorzeitiges Gebimmel“, was der Veröffentlichung nicht gerecht wird, auch wenn sie nicht zu den besten Nummern der Reihe gehört.46 Vertreten sind darin Zech, Fahrenkrog, Vetter und Grünewald-Bonn. Beiträge von Kerst und Kreidt fehlen. Der Buchschmuck stammt von Fahrenkrog. Die drei Seiten, auf denen seine Gedichte stehen, hat er mit einer germanischen Swastika, dem „Hakenkreuz“, ausgeschmückt. Im Anhang weist er darauf hin, demnächst werde sein Drama „Baldur“ bei „Greiner & Pfeiffer“ erscheinen. Eine zweite Ankündigung lautet „Von den Autoren lassen ihre Einzelwerke folgen: Paul Zech die Gedichtsammlung ‚Zieh deinen Pflug und liebe‘. Christian Gruenewald-Bonn die lyrischen Flugblätter: ‚Die frühe Ernte‘, ‚Die Nacht der Leiden‘ und die Gedichtsammlung: ‚Denn ich bin Gott!‘.“47
Paul Zech im Garten von Ludwig Fahrenkrog
Lasker-Schüler schreibt Zech: „Herwarth lässt sie grüßen, er hat sie gern“.48 Dem Verleger gefällt die Lyrik des „Wupperfreundes“ seiner Gattin. Dessen Bitte um Veröffentlichung eines Beitrags im „Sturm“ kommt er mit „Sommerabend im Park“ nach.49 Die Verse finden sich in der illustren Nachbarschaft längerer Wortbeiträge von Adolf Loos, Richard Dehmel, Albert Ehrenstein sowie Paul Scheerbart und der Werke Oskar Kokoschkas. Die Initiatorin der Veröffentlichung berichtet in dieser Ausgabe über ihre Erlebnisse im Bergischen Land und schließt mit den Worten: „die Einkehr in meine Heimat habe ich einem Dichter in Elberfeld zu verdanken, der kam dorthin lange nach mir. Paul Zechs feine künstlerische Gedichte duften morsch und grün nach der Seele des Wuppertals.“50 Der „Volkserzieher“-Stammtisch, den Zech seit Jahren besucht, löst sich auf. Ursache dafür sind interne Meinungsverschiedenheiten und der Wegzug mehrerer Teilnehmer. Auch Amalie Pohl verlässt das Wuppertal. Ihr Mann, Max Pohl, wird als Postbeamter nach Siegburg bei Bonn versetzt. Das Ehepaar kauft ein kleines Bauernhaus in Heide. Tochter Maria berichtet darüber: „Es war ein wenig verwahrlost, das Fachwerk fiel überall ab, aber das machte nichts. Vater war der geborene Handwerker und wurde mit allem fertig, und so sah das Häuschen bald manierlich aus.“51 Die Mitgliedschaft in Fahrenkrogs „Deutschem Bund für Persönlichkeitskultur“ behalten Pohls bei und üben auch ihre Ämter im Verein weiter aus.
Zech erhält eine Einladung, in Heide Gast zu sein, doch er sagt ab. Die Gründe dafür lässt er Schattke wissen: „Wenn ich auch könnte, so muss ich es mir versagen, nach Siegburg zu kommen. Ich bin die letzte Zeit so heruntergekommen, dass ich für Freund und Feind nicht zu genießen bin.“ Verursacht wird das Unwohlsein zum Teil durch seine Mitgliedschaft im „Bund für Persönlichkeitskultur“, dem er beigetreten ist, um Fahrenkrog gefällig zu sein: „Ich kann auch die Sache […] nicht aufrecht erhalten. Ich werde wahrscheinlich ausscheiden mit dem 1. Oktober.“ Diese Ankündigung macht er nicht wahr, doch Heide meidet er, weil er befürchtet, dort „Jungbergische Dichter“ und Mitglieder von Fahrenkrogs Verein zu treffen: „Mit Leutchen wie Grünewald kann ich nimmer unter einem Dache in Berührung kommen. Ich werde Ihnen seinerzeit mündlich jede Aufklärung geben. Es tut mir leid für Pohls.“52 Den Besuch in Heide will er nachholen.
Diese Zusage hält Zech ein und ist in der kommenden Zeit an Wochenenden mehrfach zusammen mit Schattke oder allein Gast in Heide. Dort verfasst er Gedichte, die der Landschaft und der Freundin gewidmet sind. Detailliert beschreibt er das Anwesen der Pohls: „Die Kate am Heiderand / steht lauernd wie ein Posten / mitten im Feindesland. / Unter der Strohkapuz / glühn ein paar klare Augen, / die funkeln nur so von Trutz. / Am Giebel prunkt und prahlt / manch eine Wetternarbe.“53 An die Begleiterin ergeht gereimt die „Aufforderung“: „Komm in Deinem weißen Kleide, / liebe wunderblonde Frau. / Sieh der Himmel ist so blau / und ein Märchenreich die Heide.“ Das lyrische Ich möchte mit ihr auf „Brautfahrt“ gehen: „Morgen werden alle Glocken singen, / morgen wird Dein junges Herz aufspringen / und Dein Blondhaar grün bekränzt.“54
Einem Rat Lasker-Schülers folgend, knüpft Zech Verbindung mit Richard Dehmel und schreibt ihm: „Ich beabsichtige ein kleines Werkchen herauszugeben, das von den Schönheiten des Landes Elberfeld-Barmen zeugen soll. Dafür kommen auch einige Aussprüche bedeutender Männer in Betracht, die hier vorübergehend anwesend waren.“ Offensichtlich spielt er auf Texte von Hille, Rilke und Bierbaum an.
Im weiteren Verlauf des Schreibens heißt es: „Nun habe ich auch einen Brief von Liliencron, den er mir 1906 geschrieben hatte, nachdem er in der Literarischen Gesellschaft aus seinen Werken vorgelesen [hat].“55 Da die Rechte am Werk des verstorbenen Autors bei Dehmel liegen, bittet er diesen, das genannte Dokument veröffentlichen zu dürfen, was deshalb paradox ist, weil ein solches nicht existiert. Zwar hat Liliencron 1901 in Elberfeld und 1904 in Barmen aus seinem Schaffen rezitiert, jedoch keinen derartigen Brief geschrieben.
Zech schätzt die Lyrik des älteren Kollegen, insbesondere den Band „In Poggfred“. Belegt ist das durch das Gedicht „Feierabendidyll“, in dem ein Ehemann seine Frau abends bittet: „Dämpf etwas ab den grellen Lampenschein / und hol mir aus dem kleinen Bücherschrein / den Liliencron. […] / mit feierlich gestimmtem Ton [will ich] / aus Poggfred einen Kantus deklamieren / und in des Dichters Traumland mich verlieren.“56 Dehmel soll auch sein eigenes Gedicht „Die stille Stadt“ [Elberfeld] honorarfrei für den geplanten Sammelband zur Verfügung stellen. Das macht er nicht, sondern erteilt lediglich die Erlaubnis zur Veröffentlichung des nicht existierenden Briefs.57 Der geplante Sammelband erscheint nie.
Wegen eines Beitrags hat sich Zech auch an den erfolgreichen Barmer Schriftsteller Rudolf Herzog gewandt und von ihm eine Zusage erhalten: „Gerne gestatte ich Ihnen, in Ihrer Broschüre […] einige Stellen mit meinen ‚Wiskottens‘ zu zitieren.“58 Als dann die Drucklegung der Anthologie am fehlenden Geld scheitert, bringt er in einer Buchbesprechung zum Ausdruck, was er vom Werk des Kollegen wirklich hält. Zu Beginn heißt es da zwar: „Über Rudolf Herzog etwas Lobendes zu sagen, dünkt mir überflüssig. Er feiert täglich Feste der Anerkennung und Verehrung.“ Dann aber fährt er fort: „Eins muss ich dem Dichter doch aufmutzen. Die letzte Novelle fällt bedenklich ab. Etwas mehr Vorsicht bei der Zusammenstellung der meist im Feuilleton bekannter Tageszeitungen erschienenen Geschichten hätte nichts geschadet.“59
Mit der Veröffentlichung „Das frühe Geläut“ bei A. R. Meyer hat Fahrenkrog gegen Kerst gesiegt. Der sucht nach dem Erscheinen des Flugblattes, in dem er nicht vertreten ist, nach einer Möglichkeit, auf diese Kränkung entsprechend zu reagieren. Mit Hilfe seines Vereins findet er eine Lösung: Er wird „Poetische Flugblätter der Literarischen Gesellschaft Elberfeld“ herausgeben. Als erste Nummer schlägt er den Mitgliedern vor: „Gedichte von Paul Zech, August Vetter und Friedrich Kerst“. Fahrenkrog, Kreidt und Grünewald-Bonn sollen nicht vertreten sein. Damit ist einmal mehr klar, wo die Fronten innerhalb der Gruppe verlaufen. Grünewald-Bonn steht mit seinem Schaffen ganz im Banne Fahrenkrogs. Wie es Zech gelingt, trotz anhaltender Fehden mit Kerst vier Gedichte in dieser Publikation unterzubringen, bleibt sein Geheimnis.
Vetter verdient seinen Unterhalt zurzeit im grafischen Gewerbe. Jahrzehnte später schreibt er über Zech: „Seine Zurückhaltung in menschlicher Hinsicht dürfte wohl charakteristisch für ihn gewesen sein.“ 1910 bleiben ihm die Lebensumstände des Kollegen verborgen: „Dass er Frau und Kinder hatte, glaube ich mich bestimmt erinnern zu können, doch waren sie meines Wissens nicht bei ihm in Elberfeld.“ Für die erste selbstständige Publikation seines Kollegen, die unter dem Titel „Waldpastelle“ bei A. R. Meyer erscheint, gestaltet er die Titelseite. Auch diesen Buchschmuck scheint er nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen zu haben, wenn er behauptet: „Bemerkenswert seine [Zechs] literarische Regsamkeit, die ihn ganz in Anspruch zu nehmen schien. Menschlich sind wir uns nicht näher gekommen.“60
Exemplare seiner ersten Publikation schickt Zech an Schattke mit der Bemerkung: „Wenig Freude hat es mir gebracht.“ Sie soll in ihrem Bekanntenkreis Käufer dafür finden. Wie er die Freundin wissen lässt, sind die Auseinandersetzungen um das Flugblatt zu viel für ihn gewesen: „Furchtbares habe ich in den letzten Wochen erleben müssen. Manchmal war ich irre. Ich habe Sehnsucht. Sie fehlen mir oft.“ Er schlägt ihr vor, gemeinsam mit ihm eine Lesung des Schriftstellers Ernst Zahn bei der „Literarischen Gesellschaft“ zu besuchen: „Sie werden doch kommen?“61 Über das Werk des Kollegen aus der Schweiz schreibt er im „General-Anzeiger“ süffisant: „Trotz all der plastischen Kleinmalerei klafft in der exakten Psychologie eine breite Lücke. Diese auszufüllen, erfordert eine tüchtige Höhe der Darstellung. Gottfried Keller besitzt sie. Ernst Zahn wünsche ich sie.“62
Ohne den Besuch eines Gymnasiums und einer Universität, unter oftmaligem Verzicht auf Nahrung und Schlaf, hat sich Zech gute Kenntnisse der europäischen Literatur angeeignet. Das macht es ihm jetzt möglich, vor einer kritischen Leserschaft zu bestehen. Längst ist er, was Aufträge zur Berichterstattung in der örtlichen Presse anbelangt, für Kerst zum Konkurrenten geworden. Um weiter Erfolg zu haben, trachtet er danach, immer neue Verbindungen zu knüpfen. Unter anderen lernt er den angehenden Lehrer Carl Hanns Wegener kennen. Dieser notiert später: „Es ist schon ein halbes Menschenalter her, da trafen sich in gewissen Kaffeehäusern der Wupperstadt Elberfeld eine Anzahl junger Leute, Dichter, Maler, Studenten und solcherlei müßige Gesellen […].“ Diese Bohèmiens von der Wupper beschreibt er näher: „Erfüllt von den himmelstürmenden Ideen der Jugend sannen sie über Gott und die Welt und über die Wunder der Kunst nach und stritten um Stefan George, den nicht alle […] als den großen Lehrmeister der jungen Talente anerkennen wollten.“ Ihr Treffpunkt ist das „Café Holländer“.
In den Erinnerungen des Pädagogen heißt es über Zech: „Unter uns war ein kleiner, stiller, besinnlicher Mann von untersetztem Körperbau. Über seinen blinzelnden Augen wölbte sich eine hohe Stirn […] und stark hervortretende Backenknochen gaben dem ganzen Gesicht etwas Slawisches.“ Von seinen Lebensumständen erzählt er den Mitmenschen nichts: „Wir scheuten uns, nach dem zu fragen, was vorher mit ihm war, und ahnten doch Abgründe und bittere seelische Not. Die Rillen seiner Stirn und das Geduckte seines Wesens redeten eine eigene Sprache. Sollten wir uns vermessen, […] Geschehenes aufzuwühlen?“63
Zech hofft, in Wegener den geeigneten Rezensenten für seine Gedichte gefunden zu haben, und schickt ihm „Das frühe Geläut“. Die Erklärung, weshalb es sich nur um ein dünnes Heft handelt, liefert er mit: „Zur Publikation dieses Schriftchens bewog mich der Gedanke, dass man als Unbekannter dem Fernstehenden eigentlich nur zwei bis drei Gedichte darbieten soll […] mir persönlich bereiten dickleibige Versbücher immer ein gewisses Unbehagen.“ Die Wirklichkeit sieht freilich anders aus: ein Buch hat er nicht bezahlen können. Auch wenn Zech vorgibt, nicht eitel zu sein, so drehen sich seine Gedanken meist um die eigene Person. In diesem Brief beginnen vier aufeinanderfolgende Sätze mit dem Wort „Ich“. Zwei davon lauten: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich über die kleinen Hefte kritisch äußern würden. Ich denke doch, dass Ihnen da oder dort eine Schrift zur Verfügung steht.“64 Da der Adressat nicht so schnell reagiert, wie der Absender es möchte, macht dieser nach einer Woche Druck: „Ich habe Toelke geschrieben, dass Sie ein paar Worte über unsere Flugblätter verlieren wollen. Sie können es nun ruhig versuchen.“65 Die Mitglieder der „Jungbergischen Dichtergruppe“ müssen sich Einiges einfallen lassen, damit in der Presse Besprechungen über ihre Beiträge im „lyrischen Flugblatt“ erscheinen. Nicht so Ludwig Fahrenkrog. Er bestellt bei der Redaktion seines eigenen Vereinsorgans „Mehr Licht!“ einen entsprechenden Artikel. Den schreibt der Berliner Verleger Ernst Valentin: „Ich muss gestehen, dieses wirklich vornehme Heftchen […] hat ganz gewiss etwas in die Augenspringendes, Nochniedagewesenes an sich“. Zwar lobt er: „Fahrenkrog und vor allem Paul Zech sind die entschieden stärkeren Talente“, kommt aber zur Auffassung: „Fahrenkrog ist leidenschaftlicher, bewegter.“66 Als Kommentar veröffentlicht Schriftleiter Kramer auf der gleichen Seite des Blattes Zechs Gedicht „Die Toten“.67 Die Leser sollen sich selbst ein Urteil bilden.
Zweig irrt sich
Zech hat Lasker-Schüler von der Anthologie zum Lob des Bergischen Landes berichtet und hofft, sie werde mitmachen. Durch jüngste Erfahrung misstrauisch geworden, fordert sie ihn auf: „Kommen Sie bald mit Herrn Vetter hier nach Berlin.“ Auch diesmal bestellt sie einen Gruß an Ehefrau Helene. Ihr Sohn Paul lässt den sechsjährigen Rudi grüßen.68 Der „Wupperfreund“ ist gestresst und beklagt sich bei Schattke: „Ich bin so überlastet mit geschäftlicher und privater Arbeit, dass ich bald verzweifle. Schon zweimal hatte ich einen Schwächeanfall.“ Das könnte wahr sein, wie der Briefkopf vermuten lässt. Der lautet: „Elberfeld, Neue Gerstenstraße 24, den 31. November 1910.“ Zech notiert ein Datum, das es nicht gibt. Er ist überfordert. Die jüngst erschienenen „Waldpastelle“ erwähnt er nur am Rande, so sehr nehmen ihn alltägliche Dinge in Beschlag. Er schickt Schattke zwei Exemplare und vermerkt dazu lediglich: „Die beiden Flugblätter sind für Ihren Gebrauch.“69 Seine Laune wird noch schlechter, als er erfährt, dass im „General-Anzeiger“ kein Artikel über die „Lyrischen Flugblätter“ erscheinen wird, weil Toelke nicht bereit ist, einen entsprechenden Text Wegeners zu veröffentlichen.
Aus Wien kommt eine Reaktion auf „Das frühe Geläut“. Zweig widmet den Beiträgen der Autoren jeweils einige Worte. Vorbehalte hat er gegen die Verse von Fahrenkrog, Vetter und Grünewald. Lob zollt er Zech, aber auch Kerst, was den Leser der Nachricht wenig freut. Insgesamt äußert sich der Kollege positiv über die erbrachten Leistungen und berichtet, er selbst habe früher aus der Zusammenarbeit mit anderen Schriftstellern Gewinn gezogen. Die „jungbergischen Dichter“ ermutigt er, ihre Ziele weiter zu verfolgen: „Sie erleben jetzt gerade den schönsten Moment: vor dem öffentlichen Debut der Bücher. Später mischen sich trotz aller innerlichen Bemühungen kleine Rivalitäten ein, die Ziele divergieren.“ Hier irrt Zweig. Ein harmonisches Miteinander hat es in dieser Gruppe von Anfang an nicht gegeben. Die Bestrebungen jedes einzelnen Mitglieds, Vetter ausgenommen, sind stets auf das eigene Fortkommen gerichtet gewesen. Deshalb bleibt auch das Projekt einer Anthologie mit Beiträgen zur Schönheit des Bergischen Landes in den Anfängen stecken, obwohl von Rudolf Herzog eine Zusage vorliegt und Zweig an Zech schreibt: „Nehmen Sie als Zeichen meiner aufrichtigen Teilnahme an Ihrem Verein das Gedicht ‚Die ferne Landschaft‘ wenn Sie wollen, auch das zweite ‚Bäume im Frühling‘ (allerdings vor Jahren in der ‚Zeit‘ erschienen).“70
Zech verspürt keine Lust mehr, sich um die Veröffentlichung von Texten zu bemühen, die er nicht selbst verfasst hat. In seiner Antwort an Zweig geht er auf das gespannte Verhältnis unter den „Jungbergischen Dichtern“ ein: „Sehr interessiert hat mich das Detail über Ihren Dichterkreis. Was Sie prophetisch voraussehen (die spätere Rivalität) kann ich schon heute wahrnehmen.“ Eine Ausnahme hebt er hervor: „Sehr erfreut hat es mich, dass Sie auch über Vetter eine gute Meinung haben. Ich sehe in ihm eine starke Hoffnung.“ Zweigs Urteil über die Verse der Kollegen kommentiert er wie folgt: „Trotz Ihrer feinen Umschreibung haben Sie Fahrenkrog und Grünewald-Bonn richtig erkannt. Ich weiß genau, wie Sie über diese Dichter denken.“ Dann aber heuchelt er: „Aber als Menschen, als Freunde möchte ich sie nicht missen“. Wahr ist: Grünewald-Bonn kann er nicht ausstehen und seine Bewunderung für Fahrenkrog schwindet. In der Autoren-Gemeinschaft harrt er aus, weil er sich davon Vorteile erhofft. Mittlerweile verfügt er über ein kritisches Urteilsvermögen: „Das literarische Leben ist hier im Allgemeinen sehr altfränkisch. Kein Wunder, der Schatten Emil Rittershaus‘ verfinstert noch das dämmernde Frührot. Aber ich denke, an uns Jungen liegt es, dass Licht in die Gassen bricht.“
Danach muss Zech Farbe bekennen: „Ich komme nun zu einer sehr heiklen Sache. Von meinem Freunde Vetter wurde ich aufmerksam gemacht, dass in meinem lyrischen Flugblatt ‚Waldpastelle‘ eine Wendung sich vorfindet, die an Ihr Wintergedicht mahnt.“ Beide Texte haben nicht nur das Motiv gemeinsam: ein erblühender Baum, auf den Schnee fällt. Darüber hinaus weisen sie zu Anfang Übereinstimmungen auf. Im sechsten „Waldpastell“ von Zech heißt es: „Die Bäume stehn mit hungerdürren Armen / Oh Gnade! Oh Erbarmen!“ Bei Zweig finden sich im Gedicht „Winter“ an entsprechender Stelle die Worte: „Zu Gott […] / Flehen die Äste mit frierenden Armen: / Erbarmen! Erbarmen!“ Zech beteuert: „Ich versichere, dass ich ganz unschuldig an der Sache bin“. Zweigs „Winter“ könne auf keinen Fall das Vorbild für sein Gedicht abgegeben haben. Das angebliche Vorbild sei erstmals 1906 in der Ausgabe „Die frühen Kränze“ erschienen, sein Werk dagegen schon 1905 im „Bergischen Türmer“. Weiter behauptet er: „Die ‚frühen Kränze‘ kenne ich erst seit 1908. Nun urteilen Sie.“71 Zweig ist viel zu diplomatisch, um dieser Aufforderung nachzukommen. Ob er dem Kollegen Glauben schenkt, steht dahin. Beim „Bergischen Türmer“ handelt es sich um eine Zeitung, die erstmals 1903 in Lindlar erschienen ist. Weder im Jahrgang 1905 noch in einem anderen ist Zechs „Winternacht“ zu finden. August Vetter hat seinen Kollegen beim Abschreiben erwischt.
Im Advent steht in der Barmer „Allgemeinen Zeitung“: „Ein lieblicher Sänger ist Paul Zech, dessen Gedichte seit kurzem in Zeitschriften auftauchen. Zwei Flugblätter sendet er jetzt aus. ‚Waldpastelle‘, das ihm ganz zu eigen ist, und ‚Das frühe Geläut‘, das er mit Christian Gruenewald verfasst hat.“ Der anonyme Rezensent glaubt den Ratschlag geben zu müssen: „Wenn sich Paul Zech von dem Einfluss der noch stark dominierenden blassen wiener Schule freimacht, kann er sich noch zu eigener herber Größe aufschwingen. Er verfügt über ganz prächtige poetische Bilder, die sich allerdings noch um einen engen Kreis bewegen.“72 Beim Rezensenten könnte es sich um einen Literaten aus dem Umkreis von Münchhausen handeln.
Vor Weihnachten möchte sich Zech nochmals mit Wegener zusammensetzen, da er für die Veröffentlichung von dessen Artikel über seine Gedichte eine Lösung gefunden hat. Als Treffpunkt schlägt er das „Café Holländer“ vor: „vielleicht bringen Sie mal die Besprechung der Flugblätter mit. Auf die Zeilenzahl kommt es gar nicht an. Der Redakteur will die Arbeit nicht vor Neujahr haben. Ich gebe Ihnen dann Adresse und genauen Zeitpunkt an.“ Zech bittet noch: „Wenn es Ihnen keine Mühe macht, können Sie mir vielleicht die Bücher: Carossa, Dauthendey, Ginzkey, Lennemann heute Abend mitbringen; Sie kommen doch?“73
An Heiligabend erscheint in der Barmer „Allgemeinen Zeitung“ Zechs Gedicht „Weihnacht“: „Verschneite Fachwerkhäuser entsteigen / Mit vielen Lichtern dem Dämmertrug. / Über Ambosruhe und Räderschweigen / Funkelt das große Sternenbilderbuch.“ Schenkt man den Versen Glauben, verbringt er diesen Abend mit der Familie und es gibt eine Bescherung: „Alle Mütter flüstern verstohlen, / Alle Kinder erwarten wen – // Bis mit einem Male / Irgendwo eine verriegelte Türe springt, / Und mein Herz wieder die alten Chorale / Der Weihnacht singt.“74 Außer der Beschreibung des Zechschen Familienlebens um 1910 vermittelt das Gedicht einen Eindruck vom Dialekt, den der Autor spricht. Er ergibt sich aus der zweiten und vierten Zeile der ersten Strophe. Es reimt sich „Dämmertrug“ auf „Sternenbilderbuch“. Es liegt die im Bergischen Land übliche Aussprache von „Buch“, die in Elberfeld „Buk“ lautet, zugrunde.
Ende des Jahres meldet sich Lasker-Schüler bei Zech. Auch ihr hat er „Das frühe Geläut“ und die „Waldpastelle“ geschickt. Sie schwärmt: „Herrliche Gedichte! Ich glaube Herwarth wird einige in den Sturm bringen“. Nach knapp einer Woche erscheint in der Zeitschrift Zechs „Gang in den Winterabend“, wieder in Nachbarschaft zu einem grafischen Beitrag Kokoschkas.75 Von sich berichtet die Freundin: „Es geht uns sehr schlecht. Bin verzweifelt.“ Ihre Ehe mit Walden steht vor dem Aus. Trotzdem denkt sie an das Fortkommen ihres Freundes, für dessen Wechsel in die deutsche Hauptstadt sie auch in diesem Silvester-Gruß wirbt: „Wir freuen uns sehr wenn Sie nach Berlin ziehn.“76
Zu Jahresbeginn verteilt Zech seine gedruckten Werke an Freunde und Bekannte. Von den „Waldpastellen“ ist eines „Ludwig Fahrenkrog in Freundschaft und Verehrung zugeeignet […]. Elberfeld, 27. Januar 1911“.77 Ein weiteres erhält Zweig. Der schreibt dem Absender daraufhin: „In ihren letzten Gedichten finde ich nun das, was den früheren noch abging: persönliche Note. Eine Silhouette formt sich.“ Dafür findet er einen Vergleich: „Alles Dichterische erinnert mich immer an den Process eines Entwickelns von Photografien – zuerst die leere Platte, dann setzen sich wie ein Schleier Linien an, werden deutlicher, sichtbarer, schärfer.“ Da er vom Talent seines Kollegen überzeugt ist, hat er ihm eine seiner Übersetzungen mit der Aufforderung zugeschickt, diese zu rezensieren: „Ich freue mich, dass Ihnen das Verhaeren-Werk etwas bot und Sie darüber schreiben wollen.“78
Zech bemüht sich weiter um eine Veröffentlichung von Wegeners Artikel über seine „Waldpastelle“. Dem Kollegen teilt er mit: „die Adresse der Zeitungsredaktion, an die Sie das Manuskript senden können, ist: Herrn Heinrich Kramer, Redakteur, Arolsen Waldeck.“ Aus der schriftlichen Einladung, wieder ins „Café Holländer“ zu kommen, ergibt sich, über welche Lektüre sich die beiden dort unterhalten: „Wenn es Ihnen recht ist, bringe ich am Samstag an Lyrik noch mit: Margarete Beutler, Ricarda Huch, Margarete Susman und Irene Forbes Mosse.“79
Ein weiteres Widmungsexemplar der „Waldpastelle“ schickt Zech an Dehmel und behauptet: „Ich verbinde mit der Zusendung keinerlei Hintergedanken. Es ist mir nicht darum zu tun, irgendwelche Beziehungen anzuknüpfen oder eine höfliche Kritik von hinten herum zu erlisten.“ Genau das jedoch möchte er erreichen. Am Schluss des Briefs fordert er den Empfänger auf: „So, nun schimpfen Sie, verehrter Dichter, über die Zudringlichkeit dichtender Jünglinge, denn obwohl ich bald in die Dreißig gehe, rechne ich mich noch zu diesem Gelichter.“80 Von der Gattin des Adressaten kommt eine knappe Antwort: „Dehmel wird Ihre Gedichte in einer freien Stunde lesen. Ihnen darüber schreiben wird er nicht, denn er ist mitten in einer Dichtung. Sie werden auch sagen, dass die vorgeht.“81 Zech bleibt nichts anderes übrig, als zu wiederholen: „Gewiß darf und kann ich nicht verlangen, dass sich Richard Dehmel über meine armseligen Verse äußert.“82
Emmy Schattke, bisher in Elberfeld und Vohwinkel als Lehrerin tätig, wird von der Schulbehörde in die mehr als dreißig Kilometer entfernte Stadt Essen versetzt. Der Beziehung mit dem platonischen Freund droht das Ende. Beider Briefwechsel stockt für Monate. Zechs Laune wird zunehmend schlechter. Zum Kummer über die Trennung kommt für ihn eine schlimme Erfahrung hinzu. Das Erscheinen eines Buches, so muss er zur Kenntnis nehmen, schließt dessen Kassenerfolg nicht von vorneherein mit ein. Es braucht Beharrungsvermögen und Geduld, bis eine Neuerscheinung die Leserschaft erreicht.
Diese Einsicht macht es Zech leichter, ein weiteres „lyrisches Flugblatt“ aus dem Verlag von Meyer stillschweigend zur Kenntnis zu nehmen. Es heißt „Die frühe Ernte“ und ähnelt zum Verwechseln dem „frühen Geläut“: Auch Grünewald-Bonn ist es gelungen, in Berlin eine eigenständige Publikation herauszubringen. Auf deren zweiter Seite teilt er mit: „Die in diesem Flugblatt enthaltenen Gedichte sind meinem demnächst erscheinenden Buche: ‘Denn ich bin Gott‘ entnommen“. Ebenso blasphemisch fährt er fort: „Der Titel des Buches erscheint vielen gewagt und übertrieben und doch ist er schlicht und einfach. Er ist das Resultat meines jahrelangen Suchens und Tastens nach Licht und Wahrheit. Treffender konnte ich meine Weltanschauung nicht ausdrücken.“
Die Gedichte der „frühen Ernte“ richten sich gegen das Christentum und weisen ihren Verfasser unübersehbar als Schüler Fahrenkrogs aus, obwohl er anmerkt: „Ich habe dieses Buch Stefan Zweig gewidmet, als eine Anerkennung seiner Verdienste um Emile Verhaeren.“83 Zech ist so unvorsichtig gewesen, Bücher des Wiener Kollegen ins „Café Holländer“ mitzunehmen, zwei Neuerscheinungen: Zweigs Übertragung ausgewählter Dramen von Verhaeren sowie seine Monographie über den belgischen Dichter.84 Bei der Zusammenkunft hat Grünewald-Bonn diese Ausgaben gesehen. Nun versucht er, seiner Veröffentlichung mittels der Widmung Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Vorbild Verhaeren
Im „General-Anzeiger“ erscheinen weitere Gedichte Zechs. Das freut ihn zwar, doch seine Stimmung wechselt häufig, da er von Emmy Schattke keine Post erhält. Ein Treffen mit ihr gestaltet sich schwieriger als bisher, denn womit soll er Helene gegenüber eine Bahnfahrt nach Essen begründen? Unproblematisch ist sein Briefwechsel mit Lasker-Schüler. Der beeinträchtigt den häuslichen Frieden nicht. Zum Geburtstag schickt er der Dichterin eine Bonbonière und ein weiteres Exemplar der „Waldpastelle“. Dieses Exemplar hat er selbst eingebunden und mit der Widmung versehen: „Else Lasker-Schüler, dem schwarzen Schwan Israels in aufrichtiger Verehrung. Paul Zech Elberfeld, im Februar 1911“.85 Die Beschenkte dankt ihm: „Ich bin wirklich gerührt über die schöne Überraschung! Der Seideneinband gehört wirklich zu den Gedichten. Die Bonbonière haben Paul und ich schon fast aufgenascht.“ Wie viel die Dichterin von den Versen hält, zeigt ihre Frage: „Schicken Sie nicht bald wieder dem Sturm?“86
Zech folgt der Aufforderung erst nach Wochen. Möglicherweise hält ihn die Arbeit an einem Artikel über „Emile Verhaeren“ für die Barmer „Allgemeine Zeitung“ davon ab. Diesem Text legt er zwei Studien von Johannes Schlaf und Julius Bab zugrunde. Deren „völkische“ Ausdeutung der Werke des Belgiers macht er sich teilweise zu eigen, indem er die germanische Herkunft des Stammes der Flamen betont. In der Einleitung nennt er den Schriftsteller Camille Lemonnier als Begründer der aktuellen „Sturm- und Drang-Periode“ in der belgischen Literatur, zu dessen Freunden Maeterlinck sowie Verhaeren zählen, und befindet: „Obwohl diese beiden Söhne des bretonischen Weltwinkels von Geburt Flamländer (also Germanen) waren, so sprachen sie doch die Sprache der Franzosen.“
An Maeterlincks frühen Gedichten missfällt ihm: „Die verschrobensten Bilder, die gewagtesten Situationen und Vergleiche wurden gewaltsam herangezerrt, um den Versen einen übergenialen Anstrich zu geben.“ Wenige Jahre später wird er sich selbst dieser Stilmittel bedienen. Noch befürchtet er, so zu schreiben müsse zum Wahnsinn führen, und äußert Genugtuung über eine Wende im Schaffen des Kollegen: „das Gesunde in Maeterlinck blieb Sieger. Er überwand diesen fiebernden Fäulnisprozeß.“ Es folgt eine Untersuchung der frühen Lyrik Verhaerens. Weniger kritisch angelegt als die über Maeterlinck, endet sie dennoch mit der Feststellung: „Das flämische Blut aber fließt nur sehr spärlich durch dieses unendlich kühle Geäder.“
Den Mittelpunkt von Zechs Artikel über Verhaeren bildet das Lob der Werke: „Les Soirs“, „Les Débâcles“ und „Les Flambeaux noirs“. Auf den ersten Blick scheint der Text nichts weiter zu sein als einer der vielen Beiträge in einer Provinzzeitung, mit denen der Verfasser Geld verdienen will. Bei genauer Lektüre erweist er sich als ein aufschlussreiches Dokument zu seinem eigenen Schaffen. Hier nennt er Stoffe und Themen, die ihm künftig wichtig sind, und erklärt, weshalb die neuen Inhalte einer anderen, bisher nicht da gewesenen literarischen Form bedürfen.
Der Beitrag in der Barmer „Allgemeinen Zeitung“ markiert Zechs Abkehr von der Literatur des 19. Jahrhunderts und seine Hinwendung zur Moderne. Damit liegt er im Trend der Zeit. Das „expressionistische Jahrzehnt“ hat begonnen und Zech entwickelt sich zu einem seiner führenden Vertreter. Vorbild ist ihm Verhaeren, über den er schreibt: „Sein durchbohrender Blick dringt bis in die verzwicktesten Geheimgänge des großen Labyrinthes moderner Fabrikstädte und erforscht und enträtselt alles. Auch nicht die unscheinbarsten Geschehnisse entgehen ihm.“ Die Thematik der Werke des Belgiers fasziniert ihn: „Woran bisher fast alle Dichter mit mehr oder weniger verängstigtem Schauern vorüber gegangen sind: die tumultuösen Geräusche der Großstadt mit ihren großen politischen und religiösen Versammlungen“. Diesen Stoffen wendet er sich nun selbst zu.
Bei Verhaeren findet Zech ein weiteres Thema, das ihm zu literarischem Erfolg verhilft: „die sozialen Abgründe verrußter Proletariergassen- und Höfe, die staubigen Fabriksäle, die angefüllt sind vom Gekreisch kreisender Spindeln und Transmissionen, alles, alles ward seiner dichterischen Bildkraft untertan.“ Zech schreibt über den belgischen Kollegen: „Er besuchte die Singspielhallen, deren erstickender Dunst von verschaltem Bier, schlechten Zigaretten und entblößten Leibern die Nerven zerrüttet und abtötet.“ Als Hilfsarbeiter im Bergbau von Charleroi ist er häufig selbst Gast in derartigen Etablissements gewesen. Auch weitere Schauplätze der Werke von Verhaeren kennt er gut: „Die aufregenden und gewaltigen Szenen der internationalen Handels- und Auswandererhäfen betrachtet er mit ekstatischer Inbrunst und ward des Schauens nicht müde.“ Das hat Zech auf der Fahrt von Westpreußen nach Holland und Belgien ebenso gemacht. Er entdeckt nun die eigene Biographie als Quelle für sein Schaffen. In besagtem Artikel heißt es: „Kein Wunder, dass dem Dichter die überlebten Formen des ‚Parnasses‘ nicht mehr zusagten, oder besser gesagt, genügten. Mit verächtlicher Gebärde warf er Ästhetizismus und Artistik beiseite und schuf sich eine neue Form.“ Bei Zech braucht es noch einige Zeit, bis er diesen Schritt nachvollzieht.
Am Schluss des Artikels steht ein Zitat aus der Verhaeren-Monographie von Zweig, dessen Auffassung nach der belgische Dichter „mit der Geste eines Meunierschen Bergarbeiters die überfüllt wankenden Formen allen Lebensrings zerschlägt, um […] eine neue Form, eine neue Religion, ein freudig klares Gefühl des Daseins zu bereiten“.87 Davon fühlt sich Zech persönlich angesprochen. Die Worte erinnern ihn an seine Erlebnisse in Belgien und dem Borinage. Von dieser Zeit hat er bis dahin nie jemandem etwas erzählt, doch Constantin Meuniers Plastik vor dem Bahnhof in Charleroi ist ihm noch immer vor Augen. Nun stellt er fest: die Welt der Arbeit, wie er sie erlebt hat, ist für Verhaeren als literarischer Stoff kein Tabu, sondern ein attraktives Thema. Auch Zweig sieht in der Gestalt des Bergmanns ein Symbol für die „Reform des Lebens“. Zech beginnt nun Novellen zu schreiben, deren Stoffe er seiner Biographie entnimmt und konstatiert: „Dem trägen krähwinkeligen Michel musste erst jenseits der Vogesen ein Zola erstehen, ein Verhaeren, ein Meunier, ehe er sich darauf besann, dass die romantischen Wälder und lieblich geschminkten Auen abgewirtschaftet haben.“88
Unter den Neuerscheinungen, die Zech besprechen soll, hat er ein Buch gefunden, das seine besondere Aufmerksamkeit erregt: „Was mir die Ruhr sang“.89 Es enthält Gedichte von Heinrich Kämpchen, dem Sohn eines Kohlenhauers, der, wie sein Vater, unter Tage gearbeitet hat. Sie heißen: „Das Grubenpferd“, „Bergmanns Los“ und „Das Bergmannselend“. Eine Totenklage, „Radbod“, ist den Opfern der Schlagwetterkatastrophe von Hamm gewidmet. Auch diese Lyrik bestärkt Zech darin, aus der eigenen Tätigkeit unter Tage kein Geheimnis mehr zu machen. Der Kohlebergbau ist ihm seit Kindertagen vertraut. Künftig, so nimmt er sich vor, soll dieses Thema sein literarisches Schaffen bestimmen.
Auf die gleiche Idee sind vor ihm außer Kämpchen auch noch andere Schriftsteller gekommen. 1909 hat Paul Grabein einen „Roman aus dem Bergmannsleben“ mit dem Titel „Die Herren der Erde“90 veröffentlicht und einen weiteren mit identischer Thematik nachgeschoben: „Dämonen der Tiefe“91. In einer Ausgabe der „Gartenlaube“ aus dem Jahre 1910 findet sich vom selben Autor die Novelle „Peter Scholtens Kostgänger. Eine Geschichte aus dem Bergmannsleben“.92 Sie ähnelt inhaltlich einer Erzählung, die Walden 1912 im „Sturm“ veröffentlicht: „Das Reiterliedchen“.93 Ihr Verfasser, Paul Zech, schreibt ab dieser Zeit in rascher Folge eine Reihe von Gedichten über „Das schwarze Revier“, ohne dabei sein angestammtes Thema „Natur und Umwelt“ aufzugeben.
Kramer kritisiert in „Mehr Licht!“ Schwaners rassistische Artikel im „Volkserzieher“. Der Angegriffene beschwert sich darüber bei Fahrenkrog, bekommt aber zur Antwort: „Du irrst dich doch auch sehr, wenn Du glaubst, alles, was Kramer macht, müsste unsere Zustimmung – aus Parteirücksichten – haben. […]. Ich habe aber an Kramer schon längst geschrieben, dass er die Spitzen gegen Dich unterlassen möge.“ Der Vorsitzende des „Bundes für Persönlichkeitskultur“ ist selbst unsicher, ob er damit Erfolg haben wird, und überlegt, was zu machen sei, falls die Angriffe weitergehen: „Ich habe, um mich zu entlasten, für eine Presse-Kommission: Dr. H. Göring, Langermann, Kramer, Zech gesorgt“.94 Mit Unterstützung dieses Gremiums glaubt er, mehr Einfluss auf den Inhalt der Vereinszeitschrift nehmen zu können.
Von einer Reise durch Amerika nach Wien zurückgekehrt, findet Zweig in der Post Zechs Beitrag über Verhaeren aus der Barmer „Allgemeinen Zeitung“ und bittet daraufhin den Verfasser: „Wenn Sie noch ein Exemplar des Artikels haben, so senden Sie ihn freundlichst direkt an Herrn Emile Verhaeren, Saint Cloud, rue de Montretout 5“.95 Das geschieht sofort. Der Belgier dankt dem Einsender: „Oh le pénétrant et précieux article de critique que vous avez bien voulu me consacrer dans l’Industrie Bezirk. Je l’ai lu et je l’ai aisément compris. Vos remarques sont nettes et justes et vôtre compréhension vous fait honneur.“96 („Oh, was für eine einfühlsame und wertvolle Kritik, die Sie mir mit dem Artikel ‚Industrie Bezirk‘ freundlicherweise gewidmet haben. Ich habe sie gelesen und gut verstanden. Ihre Bemerkungen sind klar und zutreffend, und Ihr Verständnis ehrt Sie.“)
Sturm und Gartenlaube
Zech schreibt an Wegener: „Im Auftrage von Herrn Dr. Hückinghaus soll ich Sie für die fällige Monatsversammlung der Jungbergischen Schriftsteller einladen. Dieselbe findet im Berliner Hof am 7. Mai des Jahres neun Uhr nachmittags [!] statt.“ Der neue Vorsitzende ist der Meinung, da er selbst dichte, sei er für dieses Amt geeignet. Vier Zeilen seines Gedichts „Sehnsucht“ schaffen Klarheit, wie talentiert er ist: „Mich fasst der Sehnsucht Fieber, / ich hebe mein Haupt vom Pfühl / Es geht durch die stille Kammer / Der Sommernacht Odem schwül“.97 Zech kann den Mann nicht ausstehen. Was ihn veranlasst, dennoch an der Versammlung teilzunehmen, ist die finanzielle Klemme, in der er steckt. Das Treffen will er nutzen, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie er mit seinem Schreiben Geld verdienen kann. Wegener drängt er: „ich würde mich freuen, wenn Sie erscheinen würden und hoffe, dass Sie nicht verhindert sein werden. Ich möchte Sie einiges fragen.“98 Bei diesem Kollegen holt er sich vor allem Rat zu fremdsprachigen Texten.
Von Emmy Schattke erreicht Zech der Brief, auf den er seit Monaten wartet. Trotzdem antwortet er ihr nicht sogleich, da ihn berufliche und private Sorgen umtreiben, dann aber verfasst er eine Liebeserklärung, die alle Beteuerungen gegenüber Helene, seine Gefühle für die Lehrerin seien rein platonisch, Lügen straft. Eifersüchtig erkundigt er sich, ob die Freundin an ihrem neuen Wirkungsort in Essen schon eine Bekanntschaft gemacht habe: „Ich bewundere Ihren Lebenshunger, nur verstehe ich nicht, wie die Einsamkeit, in die Sie sich zurückgezogen haben, die erwünschten Freuden gewähren soll. Sie werden doch nicht Männerherzen brechen wollen?“ Dann legt er los: „Wenn aber dem so ist, warum nehmen Sie nicht meins? Ich bot es Ihnen schon einmal lächelnd. Ich bin nun unzufriedener denn je. Eine Ohnmacht jagt die andere.“ Gegen weitere Anfälle dieser Art weiß er Rat: „Eine Aussprache mit Ihnen, irgendwo im Grünen bei Vogelgezwitscher und Kleeduft wäre mir Balsam. Aber nun sind Sie dort und ich bin hier. Und noch dazu jene Kluft, die Gesellschaft und Konvention zwischen uns gezogen haben.“ Dessen ungeachtet bittet er: „Aber wenn Sie mir trotzdem einen halben oder ganzen Sonntag schenken wollen – der Himmel wird mit Segen nicht kargen.“
Damit das Wiedersehen rasch zustande kommt, schlägt Zech vor: „Vielleicht treffen wir uns am Samstag, den 17. des nächsten Monats im Cafe Holländer. Ich bin um sieben bis halb acht Uhr dort.“ Diese Lösung hat für ihn mehrere Vorteile. Gegenüber seiner Frau muss er keine Ausrede erfinden, wohin er an diesem Wochenende verreisen wird, und bei einem Treffen in Elberfeld erübrigt sich der Kauf einer Fahrkarte nach Essen. Scherzend hat Schattke ihm geraten, er solle „die Dichterei an den Nagel hängen und in den Frühling wandern“. Darauf entgegnet er: „Liebste Freundin […] ich teile den Rausch gern mit einer gleichgestimmten Seele, jetzt fehlt sie mir. Darum muss ich mich weiter zerfasern und resignieren. Oder Verse schreiben.“99 Vor die Wahl gestellt, entscheidet er sich für die zweite Lösung, arbeitet sein Gedicht „Mittagsschwüle“ um, fügt unter dem Titel die Worte „Unfern Essen“ ein und schickt es an Walden. Der veröffentlicht die Verse im „Sturm“.100
Zweig bedankt sich bei Zech für dessen Artikel in der Barmer „Allgemeinen Zeitung“: „Es ist mir sehr lieb, dass inzwischen Ihnen Verhaeren schon den seinigen gesagt hat, denn ich komme wirklich sehr spät.“101 Von dieser Nachricht ermutigt, schickt Zech ein Exemplar der „Waldpastelle“ nach Caillou qui bique, versehen mit der Widmung: „Dem großen Dichter Emile Verhaeren in Ehrfurcht Paul Zech 12. Juni 1911“.102 Der Empfänger antwortet: „J’ai lu vos Waldpastelle. Ce sont des poèmes pleins de fraîcheur et qui sentent bon les bois. Mon appréciation n’est certes pas très solide, car je ne connais pas assez la langue allemande pour bien vous juger, mon sentiment avec sincérité.“ („Ich habe Ihre Waldpastelle gelesen. Es sind Gedichte voller Frische, die nach Wald duften. Mein Urteilsvermögen ist sicherlich nicht sehr solide, da ich nicht genügend Deutsch kann, um Sie zu beurteilen, mein Gefühl aufrichtig.“)103
Erneut wendet sich Zech an Münchhausen, mit dem er fast ein Jahr keine Verbindung mehr gehabt hat, und schickt ihm 15 Gedichte zur Begutachtung, in der Hoffnung, sie durch die Fürsprache des Barons veröffentlichen zu können. Seine Auswahl erläutert er so: „mögen Sie freundlich daraus ersehen, dass ich Ihre Vorwürfe, die Sie mir in Bezug auf meine [fehlende] Abschrankung zu den (wie Sie sagten) Wiener Juden-Ästheten gemacht haben, [ernst genommen habe].“ Im Gegensatz zu dem, was er wirklich denkt, betont er: „Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich mich von dem äußerlichen Glanz der Kunst eines Hofmannsthal oder Rilke und anderer habe blenden lassen. Mit der Zeit habe ich es selbst herausgefühlt und die Produkte jener Zeit vernichtet.“104 Das ist nicht geschehen und nach wie vor gehört er der „Jungbergischen Dichtergruppe“ an.
Der Bittsteller versucht, das Wohlwollen Münchhausens zu gewinnen, indem er sich verstellt. Rilke ist ihm weiter Vorbild und sein Schaffen hat mit den Ansichten des Barons von „teutscher Literatur“ wenig mehr gemein. Andererseits denkt dieser nicht daran, den lästigen „Schüler“ zu fördern, denn er hält ihn für einen Stümper. Doppelzüngig antwortet er: „Ihre Sendung ist mir eine wirkliche Freude gewesen […]. Sie haben einen tüchtigen Schritt vorwärts getan und können von jetzt ab getrost regelmäßig an Jugend, Fliegende Blätter, Gartenlaube, Daheim undsoweiter einsenden. Glück auf!“105 Er sieht in dem Kollegen demnach einen Schriftsteller, dessen Texte sich höchstens für die „Gartenlaube“ eignen. Zech kommentiert die Empfehlung nicht, legt seiner Antwort sogar weitere Manuskripte bei.106 Was er wirklich denkt, behält er für sich. Noch vor Wiederaufnahme des Briefwechsels mit Münchhausen hat er Zweig eingeladen, nach Elberfeld zu kommen, um bei der „Literarischen Gesellschaft“ aus eigenen Werken zu lesen. Die dem Baron als vollzogen gemeldete „Abschrankung zu den Wiener Juden-Ästheten“ hat nicht stattgefunden. Seine Verbindung zum österreichischen Kollegen wird sogar noch enger. Zweig ist bereit, auf einer seiner Reisen Station im Bergischen Land zu machen und erörtert Möglichkeiten für ein Treffen.107
Zech hat Lasker-Schüler gefragt, ob es eine Verstimmung zwischen ihnen beiden gäbe, und erhält zur Antwort: „ich habe nie heimlichen Groll ohne zu fragen. Nie so was denken! Ihre Freundin Else Lasker-Schüler. Meine Grüße an Ihre Frau und Ihre Kinder.“ Ein Umzug in die Hauptstadt scheint nicht mehr ausgeschlossen. Das geht aus einer Andeutung der Dichterin hervor: „dass Sie kommen, ist sehr nett und ich hoffe Sie finden etwas.“108 Damit reagiert sie auf Zechs Fragen nach einer Anstellung und Wohnung in Berlin. Als er sich nicht gleich meldet, schreibt sie ihm erneut: „Lieber Dichter, haben Sie meine Antwort erhalten?“109
Post von Georg Heym
Über Herwarth Walden erreicht Zech ein Brief von Georg Heym. Der gehört in Berlin dem „Neuen Club“ an, einer Autorenvereinigung, die „Neopathetisches Cabaret“ macht. Ihre Mitglieder wollen durch öffentliche Lesungen aus eigenen Werken bekannt werden. Auch bereiten sie die Herausgabe einer Zeitschrift vor, die den Titel „Neopathos“ tragen soll. Auf der Suche nach geeigneten Autoren haben sie im „Sturm“ die Beiträge des Kollegen aus Elberfeld gefunden. Heyms Briefe sind nicht erhalten, Zechs Antworten liegen vor. In der ersten steht: „Erschrecken Sie nicht, dass Sie nur einen simplen Provinzler vor sich haben. Aber wenn Ihnen meine Gedichte gefallen, gebe ich sie gern her für Ihr Unternehmen.“ Er behauptet: „Viel kann ich Ihnen nicht geben. Die letzten Jahre haben mir wenig an Lyrik gebracht“, und erklärt zusätzlich: „Meine frühen Verse, die Ostern unter dem Titel ‚Hinterm Pflug‘ erscheinen, sehe ich nicht gern in einer exklusiven Zeitschrift gedruckt.“ Zwar lässt er sie veröffentlichen, weist aber darauf hin: „Die ganze Art meines heutigen Schaffens ist eine andere und jene frühen Sachen sind eigentlich nur Versuche.“110 Den Titel der Sammlung ändert er wenig später ab in „Schollenbruch“. Georg Heym erhält eine Auswahl von zehn Gedichten, darunter „Weg in den Vorfrühling“, „Spätherbst“ und „Sommerabend im Park“. Verse mit industrieller und sozialer Thematik sind nicht dabei, aber Herwarth Walden veröffentlicht drei dieser neuen Arbeiten unter dem Titel „Zwischen Russ und Rauch“: „Die Einfahrt“, „Der Hauer“ und „Im Dämmer“.111 In ihnen sind Erlebnisse unter Tage sowie Berichte von Bergleuten verarbeitet, die Zech während seines Aufenthaltes als Kind in Müncheberg kennengelernt hat.
Ungeduldig wartet Zech auf Heyms Antwort, doch es kommt keine, weshalb er ihm nach zwei Wochen schreibt: „Auf Ihre freundliche Aufforderung sandte ich Ihnen einige Verse für die von Ihnen geplante Zeitschrift. Leider vermisse ich bis heute Ihre Empfangsanzeige und Ihre weiteren Aufschlüsse über das Unternehmen.“ Die Verbindung will er nutzen, um seine Bibliothek zu erweitern, ohne Geld ausgeben zu müssen: „Auch würde es mich sehr freuen, in den Besitz Ihres eigenen Versbuches zu gelangen. Ich kann Ihnen eventuell eine Besprechung in einem mir befreundeten Blatte ermöglichen.“112 Heym kommt dieser Aufforderung nach und bittet Ernst Rowohlt, ein Exemplar von „Der ewige Tag“ nach Elberfeld zu schicken. Zech bedankt sich für das Buch und kündigt eine Besprechung im „General-Anzeiger“ an. Er bedauert, den „Neopathetikern“ keinen Sponsor für ihre Zeitschrift nennen zu können. Das Schreiben enthält seinen oft zitierten Stoßseufzer: „Hier im Wuppertal wird für alles Mögliche Geld ausgegeben nur nicht für Gedichte.“ Es belegt einmal mehr den eigenwilligen Umgang des Verfassers mit Datierungen. Die erste Zeile lautet: „Elberfeld, Neue Gerstenstraße 24 den 3. Oktober 1911“.113 Wie sich aus dem Inhalt ergibt, schreibt er den Brief erst einen Monat später.
Am 11.11.1911 wird am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Dehmels Komödie „Michel Michael“ uraufgeführt. Die Titelgestalt ist von Beruf Bergmann. Zech erfährt von Stück und Inszenierung aus der Zeitung. Der Titel prägt sich ihm ein. Den Namen macht er zu einem seiner Pseudonyme.
Anlässlich von Kleists einhundertstem Todestag am 21. November 1911 gibt der Elberfelder „General-Anzeiger“ seinem Mitarbeiter Gelegenheit, mit einem Gedicht an dieses Ereignis zu erinnern, was ihm bares Geld sowie wachsendes Ansehen seitens der Leserschaft einbringt. Die erste Strophe lautet: „Heut müssen Rosen, purpurrote Rosen blühn / Auf deinem Grab, das blanker Morgenreif besternte. / Und die von regenschwerem Schwarzgewölk entfernte / Novembersonne müßte funkelnd niedersprühn.“ Zeitgleich veröffentlicht der zwanzigjährige Johannes R. Becher sein erstes Werk, die Kleist-Hymne „Der Ringende“.114
Schattke fragt Zech brieflich, ob er an Größenwahn leide, weil er sie im „Holländer“ geschnitten habe, als sie vor einigen Tagen dort gewesen sei. Der Adressat reagiert gereizt: „Im Café habe ich Sie nicht gesehen, sonst hätte ich dort bestimmt Ihnen die Hand gedrückt. Das wissen Sie doch auch. Von Größenwahn ist, auch nach Behauptung meiner Feinde, nichts zu erkennen, noch Anzeichen einer Verblödung.“115 Im Wissen um die Krankheit des Briesener Großvaters ist er bei diesem Thema dünnhäutig. Die verspätete Antwort auf ihr Schreiben begründet er mit dem Eingeständnis: „Ich bin seit Wochen so nervös überreizt, dass mir alles, was nach Tinte und Papier schmeckt, zuwider ist.“ Auf ein Wiedersehen mit der Freundin will er nicht verzichten: „Ich würde mich allerdings sehr gehoben fühlen, wenn ich Sie gelegentlich im Café begrüßen dürfte. Vielleicht am Samstagnachmittag um sieben Uhr, dann sind die Literaten noch nicht da.“ Seine Frau darf vom Wiederaufleben der Beziehung nichts erfahren: „ich kann Ihnen dann auch sagen, wie wir eine isolierte Korrespondenz in Szene setzen können.“
Ein Satz in diesem Brief belegt das Gespür des Schreibers für literarische Qualität: „Dass Ihnen Toni Schwabes ‚Tristan und Isolde‘ etwas geschenkt hat, freut mich“. Nach der Jahrhundertwende ist von Thomas Mann die Frage gestellt worden: „Wer kennt ‚Die Hochzeit der Esther Franzius‘ von Toni Schwabe?“116 Zech gehört zur kleinen Anzahl derer, die darauf mit „Ich!“ hätten antworten können. Er ist auf die Schriftstellerin durch Verse von ihr aufmerksam geworden, die A. R. Meyer als „Lyrisches Flugblatt“ herausgebracht hat.117 Schwabe besitzt nicht nur den Mut, ihre lesbische Veranlagung öffentlich zu machen, sondern tritt für gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen ein. Zech empfiehlt Schattke den Text auch deshalb, weil dessen Verfasserin mit deutlichen Worten erotische Phantasien beschreibt. Die Freundin fragt nach Schwabes Adresse, um mit ihr Verbindung aufzunehmen. Das verhindert Zech, indem er fabuliert: „Die Adresse der Dame kann ich Ihnen jedoch nicht sagen, da Toni Schwabe als Gattin eines Gesandten sich irgendwo im Ausland aufhält.“118 In Wirklichkeit lebt und arbeitet sie als Autorin und Verlegerin in Jena.
Ende November findet im Berliner „Architektenhaus“ die Premiere einer Reihe von „Vorleseabenden“ aus Neuerscheinungen des Verlags A. R. Meyer statt. Im Verlauf der Veranstaltung werden Zechs Gedichte erstmals öffentlich in der Hauptstadt vorgetragen. Ihr Verfasser ist nicht anwesend. Zwei Autoren bringen ihre Werke persönlich zu Gehör. Heinrich Lautensack rezitiert aus seiner „Pfarrhauskomödie“, liest dabei aber die Szenenanweisungen mit, was unfreiwillig komisch wirkt und beim Publikum zu Ermüdungserscheinungen führt. August Vetter trägt Verse aus seinem lyrischen Flugblatt „Das offene Buch“ vor, spricht aber zu leise. Das Publikum droht vollends einzuschlafen. Das ändert sich, als Resi Langer, Meyers Gattin, auftritt und mit Charme den Abend rettet. Zu den Autoren ihres Repertoires gehört auch Zech. Dieser bedankt sich im Nachhinein bei der Künstlerin, indem er ihr das Gedicht „Zum Abend“ widmet.119
Im „Sturm“ finden sich erneut drei Gedichte Zechs, was Waldens Wertschätzung für den Autor zeigt.120 Bestätigt wird ihm das durch Lasker-Schüler: „Herwarth hat Sie sehr gern. Und ich glaub es beruht auf Gegenseitigkeit.“ Weiter teilt sie ihm mit: „Wir freuen uns wenn Sie ganz in Berlin wohnen, Paul Zech. […] Wann ziehen Sie hierher?“121 Das weiß dieser selbst nicht. Ihn beschäftigt ein anderes Problem, das sein Schaffen betrifft. Mit den Gedichten aus jüngster Zeit ist ihm zwar der Anschluss an die Moderne gelungen, aber als freier Autor muss er möglichst viele Texte zu Geld machen. Das geht leichter mit seiner älteren Lyrik. Obwohl er außer im „Sturm“ auch Beiträge in progressiven Zeitschriften wie „Licht und Schatten“, „Arena“ und „Die Schaubühne“ veröffentlicht, kann er mit deren Honoraren den Lebensunterhalt für sich und seine Familie nicht bestreiten. Weiterhin muss er mit den Lokalblättern zusammenarbeiten, um Einnahmen zu erzielen.
Aus finanziellen Erwägungen nimmt Zech wieder Verbindung mit Münchhausen auf, legt ihm ältere Gedichte vor und erläutert, wie sein nächstes Buch aussehen soll: „Ich habe nun den schönen Winter zur Verfügung um aus dem vorhandenen Material das wertvollste herauszusuchen, damit eine kleine Sammlung zustande kommt. […] Die Quantität tuts ja nicht. Aber ich werde mich hüten, Gleichgültiges mit aufzunehmen.“122 Für diese Publikation stellt er Verse zusammen, die er gegenüber Heym als „Versuche“ bezeichnet hat. Einige davon sind schon von Münchhausen begutachtet worden. Dazu bemerkt der „Schüler“: „Wendungen, die Sie gerügt haben, und ich fühle es, wie berechtigt das war, habe ich umgearbeitet. Wo es nicht anging, ließ ich das ganze Gedicht fallen.“ Münchhausen antwortet ihm: „[…] einliegend die Verse zurück, auf die ich wie immer ein paar Notizen, – kurz, grob aber ehrlich! – schrieb, ich freue mich sehr auf Ihr Buch und denke, dass es hübsch werden kann. Allerdings: in zwei Jahren würde es vielleicht ein wirklich erstklassiges Buch werden!“123 Damit ist bei seinem Adepten die Schmerzgrenze erreicht. Das Urteil des Barons, er halte die Gedichte in ihrer jetzigen Form für zweitklassig sowie die kritischen Randbemerkungen machen ihn zornig. In Windischleuba fragt er nicht mehr um Rat.
Außer dem Erscheinen eines zweiten Lyrikbandes hat Zech Stefan Zweig auch sein Kommen angekündigt. Der Kollege antwortet: „Ich freu mich nun auf Ihr Gedichtbuch und Ihren Besuch in Wien: beides wird mir gute Gelegenheit bieten, Ihnen zu zeigen, wie sehr ich schlechter Briefschreiber Ihnen gut bin. Dass es doch bald wäre, ich bin schon ungeduldig, es Ihnen beweisen zu können.“124 Was er nicht weiß: Zech fehlt das Geld für eine solche Reise. Der Autor kann sich nicht einmal eine Fahrkarte nach Berlin leisten, um dort mit Lasker-Schüler über den geplanten Umzug in die Hauptstadt zu sprechen. Zudem muss er Tag für Tag viele Stunden an der Schreibmaschine sitzen, damit Honorar eingeht.
Einen Tag vor Heiligabend will Zech Wegener nochmals im „Café Holländer“ treffen: „Ich muss Ihnen mancherlei sagen und können Sie mir dann auch nicht die beiden Rilkebücher mitbringen?“125 Eine Abwendung vom Werk dieses Dichters, wie er sie Münchhausen angekündigt hat, ist nicht erfolgt. In seinem Schaffen findet er sich dieser Tage bestätigt: An Weihnachten steht in der Beilage des „Prager Tagblatts“ das erste seiner „Waldpastelle“.126
Im schwarzen Revier
Zech wirft Emmy Schattke scherzhaft vor: „Sie haben anscheinend vergessen, dass in Elberfeld jemand wohnt, der sich nach ein paar Zeilen seiner Freundin sehnt, zumal ihm gerade jetzt, unter dem Druck maßloser Enttäuschungen, ein liebes Wort willkommen wäre.“ Damit kommt er auf eine ihrer Spitzen gegen seine Person zurück: „Sehen Sie, dass der von Ihnen bei mir vermutete Größenwahn eine Utopie ist?“ Aber er übt auch Selbstkritik: „Vor einigen Wochen war ich ein paar Tage in Ihrer Nähe. In Hörde und Dortmund habe ich Studien gemacht für ein ungeborenes Drama. Ein paar schäbige Gedichte sind daraus geworden. Vielleicht langts auch noch zu einer Novelle.“ Der Pessimismus ist nicht angebracht, denn die Studien führen zu seinem ersten Drama, „Der Kuckucksknecht“, das er im Verlauf des Jahres niederschreibt.127
Dieser Tage steht Zech im Bann der Lektüre von Goethes „Faust“. Über die Besuche in Hörde und Dortmund formuliert er, auf seine Beziehung zu Schattke anspielend: „Aber das dreimal glühende Licht, das ich suche, sah ich fern durch einen düsteren Schleier ganz vage funkeln. Ich hätte gern Ihnen einen Besuch abgestattet, aber wußte ich, woran ich war[?]“ Am Wochenende soll im „Café Holländer“ ein Treffen stattfinden, von dem aber, wie immer, seine Frau nichts erfahren darf. Alternativ will er Schattke am Sonntag in Essen besuchen. Eine Antwort erwartet er „Hauptpostlagernd Elberfeld P.Z. 81“. Mit der Freundin möchte er über sein nächstes Buch sprechen, das nun endgültig „Schollenbruch“ heißt und in Kürze erscheinen wird. In ihrem Bekanntenkreis soll sie Abnehmer dafür suchen. Dann deutet er an: „Vielleicht kommt auch noch etwas anderes dazu, je nachdem Sie in Stimmung sind, denn die muss man schon bei Ihnen respektieren.“128
Wie das Rendezvous verlaufen sein könnte, ergibt sich andeutungsweise aus Zechs nächstem Brief, den er Schattke anlässlich ihres 26. Geburtstages schreibt. Zunächst bedauert er: „Schade dass ich Ihnen nicht persönlich die Hand drücken darf und Ihnen dabei alle meine Gefühle der Hochachtung und intimster Freundschaft beweisen kann.“ Danach heißt es: „Und nun drücke ich Ihnen vielmals die Hand, die ich einmal flüchtig küssen durfte und bin ganz der Ihre“. Zechs mehr oder minder geheime Wünsche sind also bisher nicht in Erfüllung gegangen. Dennoch argwöhnt Helene weiter, die Freundschaft zwischen Paul und „dieser Lehrerin“ könnte mehr als platonisch sein. Sie verübelt ihrem Mann auch die Armut, in der die Familie steckt. Schattke erfährt: „Mein Leben schleppt sich nun so zwischen Sorgen und Lichtblicken hin. Sorgen finanzieller Art und Erfolge auf künstlerischem Gebiet. Das bringt ja nur leider nichts ein!“ Der Freundin gelingt es, für „Schollenbruch“ Käufer zu finden, der Autor selbst hat damit wenig Erfolg: „Von 60 Karten, die ich an die Mitglieder des Persönlichkeitsbundes gehen ließ, ist nicht eine Bestellung eingelaufen. So sind Bundesbrüder!“ Als Anlage schickt er ihr: „Das schwarze Revier, aber nur leihweise, ich habe nur diese eine Abschrift. Das andere Gedicht ist das Geburtstagsgeschenk.“129 Erstmals erwähnt Zech den Titel des Werkes, das ihn berühmt machen wird.
Meyer liefert „Schollenbruch“ in einer Auflagenhöhe von 400 Stück an den Buchhandel aus. Das Bändchen enthält den Vermerk: „Die vorliegenden Gedichte sind das Wesentlichste von jenen Versen, die Paul Zech in den Jahren 1904 bis 1909 schrieb. Unabhängig von dieser Edition erschien im gleichen Verlag das lyrische Flugblatt ‚Waldpastelle‘“. Der Verfasser bekommt eine Anzahl Freiexemplare, die er signiert und an Freunde sowie Bekannte verschickt. Sechs Gedichte tragen eine Widmung: für Rudolf Zech, Stefan Zweig, Leo Grein, den Maler Leopold Stüven, Resi Langer und Ludwig Fahrenkrog. Den Versen vorangestellt ist das Goethe-Wort „Die Töpfe drunten, voll von Goldgewicht, zieh Deinen Pflug und ackre sie ans Licht.“ Lasker-Schüler reagiert auf das Büchlein enthusiastisch: „Lieber Dichter! Herrliche Gedichte – manche geradezu hervorragend!“ Dem Lob folgt eine neuerliche Aufforderung, seinen Wohnsitz zu wechseln: „ich und Herwarth freuen uns auf Ihr Kommen und Bleiben in Berlin.“130 Walden eröffnet in diesen Tagen eine Kunstgalerie, der er den Namen seiner erfolgreichen Zeitschrift gibt: „Der Sturm“.
Anfang März treten im Ruhrgebiet 117 000 Kumpel in den Ausstand, um eine Lohnerhöhung von fünfzehn Prozent durchzusetzen. Der „Dreibundstreik“, so genannt nach der Zahl der beteiligten Gewerkschaften, wird nach acht Tagen durch massiven Einsatz von Polizei und Militär beendet, die mit brutaler Waffengewalt bis hin zum Einsatz von Maschinengewehren gegen die Bergleute vorgehen, wenn sie arbeitswillige Kollegen am Betreten der Schachtanlagen hindern. Kurz vor Beginn des Konflikts hat am Elberfelder Theater die Uraufführung eines „sozialen Schauspiels“ von Benjamin Corda stattgefunden, das den Titel „Tiefen“ trägt. Den Mittelpunkt der Handlung bildet ein Bergarbeiterstreik. Zech ist bei der Premiere dabei gewesen. In der Zeitschrift „Der Niederrhein“ veröffentlicht er eine vernichtende Kritik des Stücks. Bei „Benjamin Corda“, so verrät er den Lesern, handele es sich um das Pseudonym von Alfred Knobloch, der bis vor kurzem Oberbürgermeister der Stadt Bromberg und zugleich Direktor des „Hansabundes für Gewerbe, Handel und Industrie“ gewesen ist. Dieser Bund mit Sitz in Berlin agiert seit 1910 als wirtschaftliche Interessenvertretung deutscher Kaufleute und Industrieller.
Den Inhalt von „Tiefen“ gibt Zech so wieder: „ein frischgebackener Regent […] wird von einem modern angehauchten Günstling getrieben, die Bewegung der Grubenarbeiter, die das Staatsgebäude zu erschüttern droht, an Ort und Stelle zu studieren, um sich so von beiden Parteien ein ungetrübtes Bild zu machen.“ Als Arbeiter verkleidet lebt der Adelige einige Zeit unter den streikenden Bergleuten und nimmt auf ihrer Seite an den Verhandlungen mit der Unternehmerschaft teil. Dann kehrt er auf seinen Thron zurück. Von dort aus beendet er den Arbeitskampf, so heißt es in Zechs Artikel weiter, mit dem Ratschlag: „Liebe Bergleute, nun geht ruhig nach Hause und bedenkt, wieviel ihr fordern dürft. Ihr kennt sehr gut die Grenzen. […] Und da ist, wie der Theaterzettel so schön sagt, die hoffnungslose Enttäuschung der Arbeiter […] mit einem Schlage geheilt und besiegt.“
Zech wettert: „Weit gefehlt, verehrter Herr Knobloch! Wir glauben wirklich nicht daran. Es gehört eine starke Naivität dazu, mit solchen armseligen Mitteln ein soziales Drama zimmern zu wollen.“ Seine Meinung zur Inszenierung: „Das Stellen beweglicher Bilder und das schöne Gerede ist ganz belanglos und hat mit dramatischer Gestaltung absolut nichts zu tun.“ Fazit des Kritikers: „Knobloch-Cordas Stück wird bewegt von politischen Predigten und sozialen Utopien.“131
Der „Dreibundstreik“ inspiriert Zech zu neuen Gedichten, die er in das Manuskript seiner Sammlung „Das schwarze Revier“ aufnimmt. Eines davon trägt den Titel „Streikbrecher“: „Der Trupp weithergereister Frongestalten / schwankt durch das Dorf wie eine Trauerprozession. / Die Ausgesperrten trommeln Rebellion / mit Fäusten, schwieligen und wutgeballten.“ In Form eines Sonetts kommentiert der Autor die dramatischen Vorgänge des Arbeitskampfes: „Fluchschauer hageln aus halboffnen Türen – / Doch die Sergeanten, die den Zug in die Gewerke führen, / reißen die Säbel abwehrhoch empor.“ Diese Verse schickt er nach Berlin an Herwarth Walden. Der druckt sie tagesaktuell im „Sturm“.132
Ein älteres Gedicht Zechs, „Märzbildchen“, das zeitgleich in „Arena“ erscheint, macht deutlich, welche Entwicklung der Autor während der letzten zwölf Jahre genommen hat: „Braune Schollen, die sich endlos dehnen, / Hier und dort ein winterkahler Zweig. / Einsam ragt ein Pflug am Ackerrain / Und vom braunen Haselnußgesträuch / Pfeift ein Fink sein helles Frühlingssehnen“.133
Zech kündigt Schattke an: „Nach Ostern verlasse ich Elberfeld und trete in den Redaktionsverband der [Berliner illustrierten Zeitung] ‚[Der] Tag‘ ein. Sie würden mich sehr zu Dank verpflichten, wenn Sie mir noch ein kleines Stündchen des Abschieds gewähren könnten. Wenn möglich noch vor Ostern.“ Da Helene die eingehende Post kontrolliert, darf Schattke weiterhin keinen Brief an die Adresse „Neue Gerstenstraße“ schicken: „Schreiben Sie mir bitte unter der bekannten Ziffer hauptpostlagernd“. Falls sie ihn nicht bei sich empfangen möchte, macht er den Vorschlag: „Ich könnte sie auch von der Bahn abholen, wenn Sie nach hier kommen.“134
Auch Stefan Zweig bedankt sich bei Zech für ein Exemplar von „Schollenbruch“ und lobt: „Ich liebe Ihr Buch sehr […] und glaube, ich werde einmal auch sehr den Menschen gern haben müssen, sobald unsere Wege einmal sich zusammenfinden.“135 Das heißt, beide Herren kennen sich noch nicht persönlich Der Dankesbrief trifft verspätet beim Empfänger ein, weil Zweig Verhaeren auf einer Vortragsreise begleitet hat. In Hamburg sind sie auch mit Dehmel zusammengekommen. Vermutlich aus Geldmangel ist Zech nicht dabei gewesen, obwohl alle drei Autoren für ihn besonders wichtig sind.
Im Rahmen einer literarischen Betrachtung „Von der Lyrik des Jahres“ löst Zech ein Versprechen ein, das er Georg Heym, der im Januar 1912 im Alter von nur 24 Jahren tödlich verunglückt ist, kurz vor dessen Tod gegeben hat, und rühmt dessen Anthologie „Der ewige Tag“: „Eine große, freilich noch in der Gärung steckende Kraft spricht aus diesen Versen […]. Einförmig und langgestreckt wie die grauen Fronten proletarischer Gassen ziehen sie dahin.“ Der folgende Satz erinnert an eine Zeile aus Goethes „Faust“: „Aber unter der äußeren Monotonie glüht ein dreimal heiliges Feuer lebendigster Gefühle und Erlebnisse.“ Zech hebt hervor: „gerade für die brutalsten Situationen fand Heym die glühendste Beredsamkeit. Ja, man kann sagen: die Lust, Grauenvolles und Abnormes darzustellen, ist das Charakteristische für Heym.“ Den Kollegen lässt er selbst zu Wort kommen, indem er mehrere Verse aus dessen Lyriksammlung „Der fliegende Holländer“ abdruckt.
Im gleichen Artikel weist Zech anerkennend auf Hugo von Hofmannsthals Anthologie „Gedichte und kleine Dramen“ hin. Gegen das Schaffen des österreichischen Dichters insgesamt äußert er jedoch Vorbehalte: „Wenn auch schon mancher Glanz von der schillernden Genialität des Lyrikers […] verblichen ist, wir werden ihn doch unter die besten Namen von heute zählen müssen. Und dieser Ruhm beschränkt auf ein knappes Dutzend von Gedichten.“ Um ein Zugeständnis an die Leserschaft der Lokalzeitung handelt es sich, wenn er zwei Autoren der Region, Erwin Vetter und Carl Robert Schmidt, erwähnt.136
Mit seinem eigenen lyrischen Schaffen kommt Zech gut voran. Die neueste Fassung des „Schwarzen Reviers“, erstmals mit der Maschine und nicht mehr mit der Hand geschrieben, widmet er „Emmy Schattke, der Vertrauten und Mitwisserin meiner Verse herzlichst Paul Zech 19.4.1912“. Das Exemplar enthält die Stücke „Gegen Morgen“, „Einfahrt“ und „Der Hauer“ sowie weitere Gedichte, die sich in der Erstausgabe von 1913 wiederfinden. Drei wichtige Titel fehlen hier noch: „Der Kohlenbaron“, „Der Agitator“ sowie „Streikbrecher“. Zech verarbeitet seine Eindrücke vom „Dreibundstreik“ erst allmählich, bringt sie Mitte des Jahres 1912 in lyrische Form und fügt sie erst dann in das Typoskript ein.
Im April ist Zech in zwei Ausgaben von Waldens Zeitschrift „Der Sturm“ mit je einem Gedicht vertreten. Eines, „Nächtlicher Marktplatz“, befindet sich im illustren Umfeld einer Zeichnung von Pablo Picasso.137
Da „Schollenbruch“ in den Buchhandlungen von Elberfeld und Barmen zum Verkauf ausliegt, kann der „Tägliche Anzeiger für Berg und Mark“ die Neuerscheinung nicht übergehen. Rezensiert wird sie von Kerst. Der ärgert Zech, indem er der Ausgabe keinen eigenen Artikel widmet, sondern sie zusammen mit Vetters „lyrischem Flugblatt“ „Das offene Buch“ bespricht: „Beide Dichter sind Grübler, die das Leben nicht nur von der Sonnenseite her kennen.“ Immerhin hat Kerst eines bemerkt: „Diese Gedichte […] sind so intim und eigenartig, dass sie als neue bergische Töne bezeichnet werden können.“138
Blumenspiele mit Adenauer
Uwe Eckardt schreibt: „Es gehört zu den vielen Widersprüchen, die Paul Zech kennzeichnen, dass er sich, obwohl er inzwischen die Sonette ‚Zwischen Ruß und Rauch‘ geschrieben […] hat, 1912 nochmals an den ‚Kölner Blumenspielen‘ beteiligt.“ Das scheinbar Unvereinbare erklärt der Stadtarchivar so: „Möglicherweise findet der Widerspruch in diesem Fall schlicht und einfach in der finanziellen Notlage des Schriftstellers seine Erklärung.“139 Tatsächlich werden bei diesem Wettbewerb wieder wertvolle Sachpreise vergeben. Zech schickt zwei Gedichtzyklen ein. Für „Einkehr“ erhält er in der Sparte „Religiöse Lyrik“ den „Johannes-Fastenrath-Preis“ und eine goldene Nelkennadel, für „Viola Mystica“ den „Außerordentlichen Preis der Prinzessin Maria von Bayern“ und eine silberne Blumenschale. Anlässlich der Preisverleihung Anfang Mai im „Gürzenich“ überbringt Kölns Erster Beigeordneter Konrad Adenauer den Festgästen Grüße von Oberbürgermeister Max Wallraf. Zech nimmt weder Nadel noch Schale persönlich in Empfang. Sein Gedicht „An E.[mmy]“ wird nun unter dem Titel „Aufblick“ durch den Abdruck im „14. Jahrbuch der Kölner Blumenspiele“ einer größeren Leserschaft bekannt.
Fahrenkrog genügt auch der „Bund für Persönlichkeitskultur“ nicht mehr für seine missionarischen Ziele. An Schwaner schreibt er: „Ich werde wohl hier eine gleiche Deutschreligiöse Gemeinde gründen […]. Mitunter möchte ich den Ranzen packen und als Reiseprediger gehn. Wer weiß was noch kommt. Unser Bund kommt demnächst zusammen und wird unter anderem auch die Organfrage behandeln.“140 Damit ist der Streit zwischen Kramer und Schwaner gemeint. In „Mehr Licht!“ sowie im „Volkserzieher“ befehden sich beide. Fahrenkrog gelingt es nicht, den Schriftleiter der Vereinszeitung mundtot zu machen. Als Dramatiker kann er dagegen einen Erfolg verbuchen: „Übrigens scheint‘s das Harzer Bergtheater mit meinem ‚Baldur‘ sehr ernst zu nehmen. Der Regisseur ist begeistert. Kostüme nach meinen Angaben nun. Schlussszene kann grandios werden […]. Am 20. Juli ist Uraufführung. Ich hoffe Dich dabei.“141
Als Zech von Fahrenkrog ebenfalls aufgefordert wird, die Premiere zu besuchen, fühlt er sich hin- und hergerissen. Mit seinem Idol möchte er weiterhin Freundschaft pflegen, zugleich aber das Wohlwollen Kramers nicht verlieren, um auch künftig Beiträge in „Mehr Licht!“ veröffentlichen zu können. Der Redakteur hat ihm durch den Abdruck eines Artikels über Strindberg zu Honorar verholfen.142 Die Aussicht, zusätzliches Geld verdienen zu können, gibt den Ausschlag für seinen Entschluss, die Einladung anzunehmen. Er schreibt an Eduard Zarncke, den Herausgeber der „Literarischen Wochenschrift“: „Für das Mannheimer Tageblatt und den hiesigen General-Anzeiger besuche ich das Harzer Bergtheater in Thale, daselbst finden drei Uraufführungen statt. Unter anderem ‚Die Bergschmiede‘ von Karl Hauptmann.“ Zech erkundigt sich: „Wäre Ihnen ein Bericht über diese drei Uraufführungen erwünscht und welches Zeilenhonorar würden Sie noch dafür auswerfen?“ Wie der Vermerk: „Abgelehnt“ auf der Anfrage erkennen lässt, will Zarncke nichts von dieser Offerte wissen.143
Zweig schreibt für die Wiener „Neue Freie Presse“ eine Besprechung von „Schollenbruch“. Darin heißt es zutreffend: „Manche der Gedichte Paul Zechs werden erst in den weit verbreiteten Anthologien zu ihrem Recht kommen“.144 Das geschieht schon bald. Richard Weißbach bringt die erste Sammlung expressionistischer Lyrik heraus, zusammengestellt von Kurt Hiller. Ihr Titel: „Der Kondor“. Wenig später folgt eine „Anthologie der jüngsten Belletristik“, expressionistische Prosa, herausgegeben von Hermann Meister, dem zweiundzwanzigjährigen Inhaber des „Saturn“-Verlags, der auch eine Zeitschrift gleichen Namens herausgibt. Beide Verleger sind in Heidelberg ansässig, das geographisch zur Provinz gehört, aber um 1912 ein geistig-kulturelles Zentrum Deutschlands bildet. Der „Kondor“ enthält sechs Gedichte von Zech, ein Zeichen seiner wachsenden Bekanntheit, da er im Gegensatz zu vielen anderen darin vertretenen Autoren weitab von Berlin lebt.
Hillers Anthologie findet bei ihrem Erscheinen nicht nur Zustimmung, sondern wird von der Presse und in Kollegenkreisen abgelehnt. Der Schriftsteller Georg Britting wettert: „Aha, Oberdichter, die Modernsten der Modernen, literarische Futuristen!“ Besonders lächerlich erscheinen ihm die Gedichte von Lasker-Schüler und Ludwig Rubiner: „Höher geht‘s nimmer. Dieser Volks-Kraftausdruck könnte auch dem ganzen Buch vorgesetzt sein.“145 Herwarth Walden urteilt: „Nun ist der Kondor schon deshalb eine schlechte Anthologie, weil er Gedichte von Personen enthält, die nicht einmal Dichter sind, und Gedichte von Dichtern, die keine Künstler sind.“146 Erich Mühsam notiert in sein Tagebuch: „Ich sollte schon vor Erscheinen für das Buch Reklame machen, was ich damals ablehnte, zum Teil, weil man mich nicht zur Mitarbeit aufgefordert hatte. Jetzt bin ich ganz froh, nicht darin vertreten zu sein. Das Buch ist miserabel.“147 Später bessert er nach: „Ein paar junge Dichter sind auch im ‚Kondor‘ vertreten, bei denen sich der ernsthafte Wille zu eignem Ausdruck findet. Da ist vor allem Franz Werfel […]. Er und Paul Zech scheinen unter den Allerjüngsten die meiste Anwartschaft zu haben, […] gute Dichtung aufzurichten.“148 Rückblickend schreibt Hiller: „Zech galt damals im Kreis meiner engeren literarischen Freunde als zu ‚konventio-nell‘, zu ‚konservativ‘; eine Meinung, die ich nicht teilte.“149
Ab Frühjahr 1912 erscheint in jeder Ausgabe des „Saturn“ entweder ein Beitrag von oder über Zech. Den Anfang macht ein Gedicht „Gefangene Mädchen“, in dem der Verfasser seinen erotischen Phantasien freien Lauf lässt: „wie sie den hag‘ren Leib entgegenbreiten / der goldnen Helle und wie sie den Wind / […] zur Spielerei verleiten! // […] dann überkommt sie wohl das sündhafte Verlangen, / all ihre Jugend einem hinzuschenken, / oh einmal nur zu lösen Gürtelband und Spangen“.150
Ein Artikel Zechs über das Werk von Lasker-Schüler endet mit der Feststellung: „Irgend ein sicherer Maßstab für diese lyrische Kunst wird sich kaum finden lassen. Der einzige Weg zu ihrem Verständnis heißt: Seele, viel Seele haben.“151 Die Gewürdigte meldet sich beim Verfasser: „Lieber Dichter. Wie wundervoll Ihre Kritik ist – der letzte Satz – der ist es ja eben. / Wie soll ich Ihnen danken! […] Wann ziehen Sie hierher? Ich habe Ihnen viel zu erzählen.“152
Der „General-Anzeiger für Elberfeld und Barmen“ veröffentlicht eine Rezension von „Schollenbruch“. Verfasser ist Anselm Ruest, 1878 als Ernst Samuel im westpreußischen Culm geboren, jetzt wohnhaft in Berlin. Ihm hat A. R. Meyer den Auftrag gegeben, in der auflagenstärksten Zeitung des Wuppertals Werbung für die Gedichte seines Landsmannes Zech zu treiben, was den Verkauf des Büchleins außerhalb der Hauptstadt fördern soll. Ruest interpretiert sie als „Mittlerversuch, das ältere Lenau – Storm – Mörike-Erbe mit der feierlichen Getragenheit Georges und Rilkes, der sinnlichen Üppigkeit Dauthendeys und der überquellenden Wildheit Dehmels zu verschmelzen und zu versöhnen“.153
Zech bespricht im „General-Anzeiger“ „Anton Reiser“ von Karl Philipp Moritz, Rousseaus „Bekenntnisse“ sowie Ellen Keys Biographie der Rahel Varnhagen und zeigt sich auf diese Weise vertraut mit wichtigen Werken europäischer Schriftsteller. Neueste Entwicklungen im deutschen Literaturbetrieb kennt er ebenfalls: „Von bibliophilen Grundsätzen getragen sind die Drugulindrucke des jungen tatkräftigen Verlegers Ernst Rowohlt in Leipzig. Es erscheint erstaunlich, dass solche vollendet ausgestatteten Werke in so billiger Preisnotierung möglich sind.“ Werbung in eigener Sache betreibt er, indem er auf „die Bücherei der exquisiten Zeitschrift Saturn (Saturnverlag, Hermann Meister, Heidelberg)“ verweist.154
In „Mehr Licht!“ verteidigt Kramer die christliche Religion gegen Anfeindungen von Schwaner und Konsorten: „Mag an dem Kirchentum früher und auch jetzt manches auszusetzen sein, das Christentum Jesu und dessen hoher ethischer Gehalt werden dadurch nicht um Haaresbreite herabgesetzt.“155 In der folgenden Ausgabe meldet sich Fahrenkrog zu Wort und erläutert weitschweifig die Religion der heidnischen Vereinigungen. Sein Beitrag endet mit dem Bekenntnis: „Wir können nicht mehr der christlichen Kirche angehören – wir sind zu uns selber gekommen. Wir: Schwaner, Rehse, Weißleder, […] und Fahrenkrog.“156
Kramer reagiert auf diesen Artikel mit einem Beitrag eines gewissen Alwin Menz zum Thema: „Paul Zech, ein neuer Vollblutlyriker“. Darin heißt es: „Rührend ist das religiöse Bekenntnis des Dichters. Er ist kein Sektierer oder in Dogmen Erstarrter. Sein Blick ist vielmehr ganz nach innen gerichtet und ohne kirchlichen Zwang.“157 Der Text stammt von Zech selbst. Auf dem Titelblatt druckt der Redakteur zusätzlich ein Gedicht von ihm, hier unter richtigen Namen. Es heißt: „Klare Lösung“. Der Verfasser stellt die Frage nach dem Jenseits und prophezeit: „Es wird ein Tag erscheinen / der über Jahre thront; / dann endet alles Weinen und ist wie Meer bewohnt. // Und was auf Erdenwegen / wildfragend und gebannt / strömt wie ein Sommerregen / in die weit offne Hand.“158 Kein Wort von Christus, aber auch keine Erwähnung Wotans oder anderer germanischer Götter. Worin aber, so muss sich der Leser fragen, besteht die in der Überschrift angekündigte Lösung?
Fahrenkrog schmeißt den Vorsitz des „Bundes für Persönlichkeitskultur“ hin, beendet seine Mitgliedschaft und gründet einen „Ortsverband für Barmen/Elberfeld“ der „Deutsch-Religiösen Gemeinschaft“.159 Die Anhänger folgen ihm in Scharen. Über einen Fall teilt er Schwaner mit: „Soeben schreibt mir der Schriftsteller Zech, dass er sich uns auch anschließe, andere werden folgen. Es ist derselbe eine gute Kraft, Redakteur am General-Anzeiger und Berichterstatter für andere noch.“ Der Vereinsvorsitzende überlegt, wie er das neue Mitglied fest an die Deutsch-Religiösen binden kann und schlägt dem Herausgeber der Lehrerzeitschrift vor: „Ich schrieb […] über sein ‚Schollenbruch‘ einen Bericht. Möchtest Du diesen nicht bringen? Für Kramer […] darf er keinesfalls mehr schreiben. Ich möchte wohl, dass Du ihn aufmuntertest für den ‚Volkserzieher‘ mal was zu bringen – oder soll ich‘s?“160
Ein Namensverzeichnis der „Deutsch-Religiösen Gemeinschaft, Ortsgruppe Elberfeld-Barmen“ vom Juni 1912 belegt, dass Zech zumindest ab dieser Zeit Fahrenkrogs Sekte als zahlendes Mitglied angehört.161 Trotzdem versucht er weiterhin, die Verbindung mit Kramer nicht abreißen zu lassen und schickt ihm Verse für „Mehr Licht!“, in denen er bedauert: „So sehr hat Gleißnerisches uns zersplittert, / dass wir einen Rundgang führen ohne Ziel, / indeß das Herz in Einsamkeit verbittert.“ Der Titel des Gedichts lautet: „Wir müßten so wie Kinder sein!“162 Die Mahnung zeigt keine Wirkung. Der allgemeine Streit wird noch heftiger. Nicht zuletzt deshalb geht Zech nun auf Lasker-Schülers Vorschlag ein, nach Berlin zu ziehen, weil ihm das die einfachste Lösung seiner Probleme zu sein scheint.
Heimlich regelt er, was in Elberfeld unerledigt geblieben ist. Anstehende Aufträge für Artikel von Zeitungen und Zeitschriften packt er in seinen Koffer. Aus Heidelberg erreicht ihn noch die neueste Nummer des „Saturn“. Darin bespricht Hermann Meister „Schollenbruch“. Der Rezensent ist der Überzeugung, „dass in ihm [Zech] eine dichterische Kraft heranreift, die ein reines, von allen Schlacken überlieferter Empfindsamkeit befreites Empfängnis der Naturvorgänge darzustellen vermag“.163