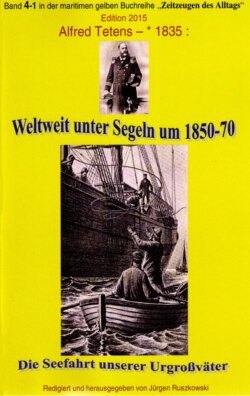Читать книгу Weltweit unter Segeln um 1850-70 – Die Seefahrt unserer Urgroßväter - Alfred Tetens - Страница 4
Hinaus auf das weite Meer
ОглавлениеNun schienen mir die Sohlen unter den Füßen zu brennen; es litt mich nicht länger auf dem festen Boden, die verzehrende Sehnsucht: „Hinaus auf das weite Meer“ beherrschte all mein Denken und Fühlen.
Ohne viel Überlegung ergriff ich jetzt die erste Gelegenheit beim Schopfe und ließ mich als Schiffsjunge auf dem Blankeneser Schoner „ODIN“ des Kapitän Brekwoldt einstellen.
In dieser wenig beneidenswerten Stellung sah ich sehr bald all meine Illusionen über Bord gespült. Wohl empfand ich die unbeschreibliche Großartigkeit des Meeres, sah das entzückende Bild des klaren Wasserspiegels, den ätherblauen unermesslichen Himmelsdom, aber das allzu regsame Tauende meines Steuermannes störte meine Betrachtungen mit einer unangenehmen Hartnäckigkeit, das ich nur noch sehr selten und auch dann nur in unbewachten Momenten all die Herrlichkeiten bemerkte. Und was etwa das ominöse Stückchen gedrehten Hanfes des poesielosen Steuermanns versäumte, das wurde von meinen recht prosaischen Obliegenheiten, die aufzuzählen meine Feder sich weigert, reichlich nachgeholt. Ja wahrhaftig, mein Los als Schiffsjunge während der ersten Reise war kein beneidenswertes. Die vielseitigen körperlichen Anstrengungen wären wohl noch zu ertragen gewesen, wenn ich nur nicht so jäh aus meinem wolkenlosen Himmel geschleudert worden wäre.
Nach acht Tagen war auch die letzte Spur meiner kindlichen Eitelkeit, welche die seemännische Landtoilette, besonders die bis zum Nacken reichende Mütze, wach gerufen, total verwischt. Manche heiße Träne, – meine damaligen Schiffsgenossen mögen es mir verzeihen, – sank bei Gelegenheit des Kartoffelschälens in unseren kleinen Eimer.
Der erfahrene Seemann wird solch’ reichlichen Tränenvorrat nicht sehr hoch schätzen, noch weniger ein besonderes Mitgefühl dafür hegen. Auch der geehrte Leser darf sich beruhigen. Wo die Neigung zum Seeleben wahr und echt ist, da werden diese salzwässerigen Überschüsse sehr bald aufhören und verschmerzt sein, wo aber nur eine momentane Laune, kindliche Unbesonnenheit oder gar ein Vergehen das Motiv zur Wahl des Berufes bildet, da sind diese Tränen recht gesund. Was weder der Autorität des Vaters noch den Bitten der Mutter gelingt, hier auf dem einsamen Meere bringen es ein paar Tränen zu Stande. Sie führen zum Nachdenken, zur Reue und damit zur Besserung.
Meine erste besondere Tätigkeit, die große Stenge mit Fett einzuschmieren, fand auf Befehl des Steuermannes bei stürmischem Wetter in der Nordsee statt. Ich flog hier oben – ein Spiel des Windes – wie ein Wimpel hin und her und musste meine ganze Kraft auf das Festklammern verwenden. Es war schier unmöglich, die mir aufgetragene Arbeit auszuführen, aber ich wollte wenigstens, vom Zuruf des schikanösen Steuermannes angefeuert, den Versuch wagen, der Großen Stenge das wohltätige Fett zuzuführen. Bei meiner ersten Bewegung stürzte leider die Fettpütze hinunter aufs Deck.
Das war nicht schlimm und konnte nur dazu führen, meinen unerquicklichen Aufenthalt zu beenden. Jawohl! Schön gedacht, wenn nicht in demselben Augenblicke der minutenlange Fluch meines Steuermannes all meine Hoffnungen zertrümmert hätte. Der ganze, wenig appetitliche Inhalt meiner entwichenen Fettpütze hatte sich über den wütenden Steuermann ergossen und statt der großen Stenge hatte ich meinen gefürchteten Vorgesetzten eingeschmiert. Die Vorsehung war zwar für den gequälten Schiffsjungen eingetreten, aber einen Gefallen hatte sie mir damit nicht erwiesen, denn nun erhielt auch ich meine Schmiere. Von all meinen Obliegenheiten war das Auswaschen der aus Segeltuch gefertigten Tischtücher am unangenehmsten; zu dieser unbehaglichen Arbeit wurde mir kein Süßwasser verabreicht, sondern ich musste es mit Seewasser und käsender Salzwasserseife bewerkstelligen. – Jede Hausfrau wird meinen Schmerz begreifen. Dieses Reinigungswerk wurde so lange wie möglich von mir hinausgeschoben. So war meine mir unsympathische Eichenholzbalje samt ihrem seit acht Tagen eingeweichten Inhalt aus meinem Gedächtnis gekommen und harrte in ihrem Versteck unter dem Großboot der recht notwendigen Entleerung. Die intensiven Sonnenstrahlen hatten sich mit meinen eingeweichten Tischtüchern sehr lebhaft beschäftigt und ihnen einen Geruch verliehen, der zwar nicht salonfähig war, aber trotzdem die Aufmerksamkeit aller Riechorgane an Bord beschäftigte.
Natürlich war es dem scharfen Spürsinne meines Steuermanns vergönnt, den Urheber zu entdecken. Ich wurde sogleich zur Betrachtung der vom Eichenholz blau gewordenen, marmoriert aussehenden Tischtücher gezwungen und bevor ich noch meine Bewunderung über die sonderbare Wirkung der tropischen Hitze aussprechen konnte, klatschten mir die unzart duftenden, nassen Tücher unausgesetzt um die Ohren, als könnte nur dadurch die ursprüngliche Farbe hervorgezaubert werden.
Trotz dieser oft wiederholten „nassen Umschläge“ und sonstiger unzarter Behandlung von Seiten meines Steuermanns erhielt ich auf dem ODIN eine vorzügliche seemännische Ausbildung. Nebenbei wurde ich mit allen Matrosenarbeiten sowie mit Kochen und Brotbacken ausreichend vertraut; konnte Fußzeug flicken, Segeltuch-Beinkleider sowie Segel zuschneiden, nähen, Farbe reiben, malen und – oh, welche Wonne! – sailors hornpipe tanzen wie der erfahrenste Seemann. Sogar von der wenig erfreulichen Seekrankheit blieb ich nicht nur jetzt, sondern auch stets verschont. Das war alles recht schön, nur meine Koje machte mir unendlich viel Verdruss; für diesen entsetzlichen Behälter die Bezeichnung Koje anzuwenden, ist ganz gewiss eine unerhörte Übertreibung; für einen kleinen Knaben wäre der tintenfassartige Raum vielleicht groß genug gewesen, aber für einen ausgewachsenen Jüngling meiner Körperlänge war er mindestens drei Fuß zu kurz geraten; wollte ich in meinem Schmollwinkel längere Zeit verweilen oder gar schlafen, so konnte das nur in der sogenannten Taschenmesserart geschehen, ich musste zuklappen. Aber selbst diese gewaltsame Körperverrenkung war bei ruhigem Wetter noch ein großartiges Vergnügen. Man war wenigsten allein, konnte schlafen und träumen. Ach ja! Der Schlaf eines ermüdeten Schiffsjungen! Wer könnte die Herrlichkeit beschreiben? Wem meine Koje angewiesen wäre, hätte es unter keinen Umständen können. Dieser undichte, vorn im Steven querschiffs befindliche Rattenwinkel hatte die eigentümliche Gewohnheit, bei jedesmaligem Untertauchen des Schiffsbugs so viel Wasser einzunehmen, dass mein Bettzeug eigentlich niemals trocken wurde.
Von allen Qualen, die ein solches Aquarium verursacht, werde ich nur die eine nennen und bin überzeugt, der geehrte Leser wird gern auf die Anführung der übrigen verzichten. Sobald nämlich die andauernde tropische Luftwärme ihren Einzug in diesen entsetzlichen Behälter gehalten, versucht es die vom Seewasser erzeugte Atmosphäre, den penetranten Eindringling wieder zu vertreiben. Die um die Herrschaft streitenden Dunstmassen scheinen nun die einfache aber fürchterliche Taktik zu verfolgen, dass eine der anderen den Aufenthalt in dem Raum zu verleiden sucht. Luft und Wohlgeruch sind längst verschwunden, unheimliche Düfte, abscheuliche Gase beherrschen die Wahlstatt und „da unten ist’s fürchterlich!“
Konnte ich hier den begehrenswerten Schlaf finden? War es nicht erklärlich, dass sich während meines dienstlichen Ausgucks vorne auf Deck in frischer, gesunder Luft oftmals meine Augen schlossen?
Musste aber nun gerade, wenn ich so wonniglich vom Elternhause, von Heimat und Jugendgespielen träumte, wenn all die herrlichen Bilder an meinem traumerfüllten Blick vorüberflogen, der ruhelose Steuermann herbeischleichen und den wassergefüllten Eimer über mich ergießen? Musste mir dieses Erwachen bereitet werden? Ich weiß es nicht.
Heute darf ich ja offen bekennen, dass ich dieser Radikalkur unendlich viel verdanke, dass sie es war, welche mich die gefahrvolle menschliche Schwäche überwinden half. Von jenem Augenblicke an war ich im Stande, die größte Müdigkeit zu bekämpfen, sobald es sich um Dienst, um die Sicherheit des Schiffes handelte.
Nach einer ziemlich guten Fahrt waren wir in die Nähe des Äquators gekommen, wo kein angehender Seemann der hergebrachten Taufe entgehen kann. Es möge mir gestattet sein, diesen im Leben eines jeden Schiffsjungen bedeutsamen Abschnitt ausführlich zu schildern. Leider gerät der seemännische Gebrauch auf deutschen Kauffahrern immer mehr in Vergessenheit. Ich bedauere es! Die Taufe unter der Linie gibt dem Seemanne eine willkommene Gelegenheit, seinen kernigen Humor und seine frohe Laune zum Ausdruck zu bringen.
In aller Stille wurden großartige Vorbereitungen getroffen. Die ganze Besatzung, außer Kapitän und Steuermann freilich nur aus sieben Mann bestehend, begann zunächst mit selbstgefertigten Gegenständen eine höchst belustigenden Umkleidung, bei welcher die meterlangen Papphüte und buntbemalten Masken eine wichtige Rolle spielten. Der älteste Matrose übernahm die Darstellung des Meergottes Neptun.
Ein riesiger, bis zum Boden reichender Vollbart aus aufgedrehtem Tauwerk umrahmte das bunt bemalte Antlitz. Grellfarbene Zeuglappen zierten das mantelartige Gewand. Neptun schien für großkarierte Muster zu schwärmen. In der einen Hand die aufgestielte Harpune, in der anderen einen mächtigen Dreizack, so erwartete der Gott des Meeres den Augenblick, in welchem die Feierlichkeit beginnen würde.
Neptuns Sekretär erschien in voller Amtstracht; mit großem Register unterm Arm und übernatürlicher Brille auf der Nase, wollte er an der Seite seines Vorgesetzten Aufstellung nehmen, aber die drei Fuß lange Schreibfeder, welche mit vieler Geschicklichkeit hinter seiner linken Ohrmuschel balancierte, widersetzte sich hartnäckig diesem berechtigten Verlangen.
Der dritte Träger eines ferneren Machtzeichens erschien im Frack, dessen flatternde Rückenflossen bis zum Boden reichten und sehr wohltätig die entblößten Füße seines Trägers zu bedecken suchten. In der Rechten dieses sonderbaren Beamten blinkte das meterlange aus Tonnenbandeisen verfertigte gefahrdrohende Rasiermesser. Die Beschreibung des am fragwürdigsten geschmückten Gefolges will ich lieber aus Rücksicht für den Beherrscher des Meeres unterlassen.
Endlich war der große Augenblick gekommen. Das Meerfest konnte beginnen. Beim Passieren der Linie erscholl am Bug des Schiffes der scheinbar vom Meere kommende Ruf: „Schipp ahoi!“
„Hallo, hallo,“ antwortete vom Achterdeck aus der Kapitän. – „Wie heet dat Schipp?“ begann mit kräftiger Stimme der Frager. – „ODIN.“ – „Wo koomt Ji her?“ – „Von Hamborg.“ – „Wo wüll Ji hen?“ – „Na Bahia.“ – „Wie lang sind Ji op de Reis?“ – „Tweeunveertig Dag.“ – „Kann ick an Bord koomen?“ – „Versteiht sick, Herr Neptun!“
Für mich war es besonders interessant zu hören, dass sich Herr Neptun ausschließlich der plattdeutschen Sprache bediente und einen recht gemütlichen Umgangston anschlug. Neptun, an der Spitze seines Hofstaates, kam zur Inspektion an Bord. Auf dem Hinterteile des Schiffes stand der Kapitän mit dem duftenden Willkommentrunk bereit. Unter fortwährenden zeremoniellen Verbeugungen nahm Neptun das Glas Grog huldvoll entgegen und goss es zum Zeichen seiner besonderen Gunst in einem Zug durch die anscheinend gepichte Kehle.
Der ob dieser Gunstbezeugung betroffene Sekretär blickte betrübt auf den Boden des Glases, harpunierte aber mit seinem buntbemalten Zeigefinger die Überreste des nicht geschmolzenen Zuckers glücklich empor. Die nachfolgenden Würdenträger begnügten sich damit, das leere Glas zu beriechen, während ein Angehöriger des gewöhnlichen Gefolges seine Zunge sekundenlang auf dem Grunde des leeren Glases ruhen ließ, als könne er nur auf diese Weise seine Verehrung für den herrlichen Grog ausdrücken.
Als die Aussicht auf ein zweites Glas dieses Göttertranks verschwunden war, ergriff Neptun das Wort und gab seinem etwas gekränkt scheinenden Sekretär die Weisung, nunmehr seines Amtes zu walten. Gehorsam wurde das ungeheure Protokoll aufgeschlagen; der Sekretär griff zur Brille, putzte mit einer Handvoll Werg die Stellen, wo die Gläser hätten sitzen können, und begann in den Registern aufmerksam zu suchen.
Endlich hatte er amtlich festgestellt, dass sich an Bord des ODIN noch jemand befände, der noch nicht die Linie passiert hätte und getauft sei, demnach dem Gott des Meeres den herkömmlichen Tribut schulde. Dieser unglückliche Jemand war ich natürlich. Auf einen Wink des kühl dreinschauenden Meergottes lag ich willenlos in den Händen seines Gefolges. Zunächst wurde mein Gesicht mit Fett überzogen, dann mit Teer eingerieben; so vorbereitet ging es unter Anstimmung eines ernst klingenden Gesanges nach der großen mit Wasser gefüllten Balje. Nachdem ich auf dem Sitzbrett Platz genommen, welches quer über den Kübel gebreitet war, begann Neptun seine feierliche Ansprache, die in der Ermahnung gipfelte, alles daran zu setzen, um ein tüchtiger Seemann zu werden, niemals die Pflicht zu verletzen und in jeder Lebenslage den schönen Beruf hoch zu halten. „Wenn du dat nich deihst“, schloss der eifrige Meeresgott drohend, „dann geiht et di en Stünn slecht.“
Sobald dieser Warnungsruf verklungen, ergriff der Sekretär das einem Schlachtschwert ähnliche Rasiermesser, schabte damit die Fett- und Teerkruste so emsig aus meinem Gesichte, dass sofort einige Dutzend heißer Tränen von mir vergossen wurden. Endlich war die Gerberei beendet. Sechs kräftige Matrosenhände drückten plötzlich auf meine Schulter. Diesem Drucke konnte das vorher bis über die Hälfte eingesägte Brett nicht widerstehen. Es bracht mitten durch und ich lag mit einem Male bis über die Ohren in dem spritzenden und zischenden Wasser des Kübels.
Bis hierher hatte ich alles geduldig über mich ergehen lassen. Nun aber sprang ich eiligst aus meinem Bassin, umarmte meine Paten mit solchem Ungestüm, dass auch ein Teil meiner teerfettigen Feuchtigkeit an ihren Kleidern haften blieb. Damit war der regelrechte Taufakt beendet. Zum Nachspiel des seemännischen Faschings ließ der Kapitän einige Flaschen Wein, Rum und Bier verteilen, es wurde nach Herzenslust gejubelt, gesungen und getanzt.
Schließlich ward die Hälfte einer Teertonne in Brand gesetzt und lodernd dem Meere übergeben. In diesen Flammen nimmt Neptun nach eingebürgerter Meinung der Seeleute Abschied vom Schiffe. Lange noch konnten wir den hell schimmernden Feuerball auf dem leicht bewegten Meere beobachten. Ein frischer, fröhlicher Zug durchzieht die Herzen der Leute. Sie vergessen bei dieser harmlosen Fröhlichkeit die schwere, gefahrvolle Arbeit, welche der Beruf jeden Augenblick von ihnen beansprucht.
Wenn mir auch für die ausführliche Beschreibung meiner Fahrten nur ein bescheidener Raum bleibt, so muss ich doch an dieser Stelle des Augenblicks gedenken, an welchem mein tränenfeuchtes Auge zum ersten Male auf der empor tauchenden brasilianischen Küste ruhte. Welch ein herrliches, unbeschreibliches Bild! Welch’ mannigfache, lebhafte Eindrücke für den Schiffsjungen, der sich im Wunderlande wähnt, die üppige Vegetation der Tropen, das bunte Treiben einer dunkelfarbenen Menschenmasse, alles, alles weit schöner als die Phantasie des Knaben es je ausgemalt.
Kapitän Brekwoldt war natürlich über diesen Zauber erhaben. So schnell wie möglich wurde Bahia verlassen und der Kurs auf die Kapverdischen Inseln gerichtet. „Eben mol röber föhrn“, so wurde die wochenlange Fahrt nach der afrikanischen Küste vom Kapitän bezeichnet.
In den viereckigen Salzgruben der Kapverdischen Inseln begrub ich den Rest meiner poetischen Stimmung. Allein die jetzt beginnende Arbeit verlieh mir den schönsten Trost. Die Gewinnung des Salzes wurde sehr einfach bewerkstelligt. Unweit des Meeresstrandes befinden sich in den Ebenen sehr viele, ziemlich große viereckige Gruben, die sich mit Grundwasser füllen. Auf der Oberfläche dieses Wassers bilden sich dicke Salzkrusten, die von der Mannschaft täglich abgeschöpft und an Bord geschafft wurden. Nach wochenlangem Abrahmen dieser viereckigen „Salzwasserfetten“ war die Ausbeute beendet. Der ODIN nahm seine ursprüngliche Fahrt wieder auf und erreichte nach rascher Fahrt den schönsten Hafen der Welt: Rio de Janeiro. Dann ging es weiter nach Buenos Aires, dem Bestimmungsorte unserer Salzladung.
Vor der La-Plata-Mündung hatten wir einen sehr schweren Pampero zu bestehen. Noch annähernd 50 Meilen vom Lande entfernt drang uns ein wunderbarer Blumen- und Honigduft entgegen. Allein dieser verführerische Geruch erweckte nur bei dem Uneingeweihten die Sehnsucht nach dem Lande. Der erfahrene Schiffer traut den duftenden Grüßen in dieser Region nicht allzu sehr. Diese Wohlgerüche werden auch keineswegs gratis verabreicht, nur die Einziehung des Kostenpreises geschieht etwas später; das ist aber auch das einzig freundliche Entgegenkommen des aufbrausenden Pampero. –
Es war eine tiefdunkle Nacht; unter Donner und Blitzen zog das Unwetter herauf, schwüle dicke Luft erschwerte das Atmen, immer rascher folgten die elektrischen Entladungen. Ergriffen von der Macht dieses grausig schönen Anblicks stand ich auf meinem Posten am Steuerruder. Plötzlich fiel der Wind von der anderen Seite ein; mit Blitzesschnelle brach der Sturm los.
Das bereits früher gereffte Großsegel und mit diesem der große Baum schlugen nach der entgegengesetzten Richtung hinüber. Die Kompasslampe erlosch; eine gewaltige Sturzsee ergoss sich über das in seinen Fugen zitternde Schiff; vom wuchtigen Schlage der Schooten getroffen, verlor ich plötzlich den Boden unter den Füßen. Instinktiv klammerte ich mich an ein Tauende und flog nach Lee über Bord.
Es waren fürchterliche Sekunden, in denen ich hier zwischen Himmel und der sturmgepeitschten See hin- und herschwankte. Mit der Macht der Verzweiflung hielt ich das rettende Tau krampfhaft fest. Ein wahnsinniger, brennender Schmerz erhöhte meine Todesqual. Im unausgesetzten Schwingen waren die Innenseiten meiner Hände vom Tau durchschnitten. Ich fühlte das Blut über meine Arme rinnen, fühlte den Angstschweiß auf meiner Stirne; dennoch hielt ich fest, wohl wissend, dass es sich um Leben und Tod handle. Trotz aller Energie war meine Kraft bald erschöpft. Die Entscheidung nahte. Es blieb nur eine Möglichkeit, der dräuenden Gefahr zu entgehen. In dem Moment, in welchem ich abermals von See nach der Schiffsseite geschleudert wurde und nach meinem Darfürhalten gerade über der Mitte des Schiffsdecks schwebte, ließ ich entschlossen los. Die harten Holzstücke, auf die ich niederstürzte, erschienen mir wie ein Federbett – ich war gerettet!
Auf Deck herrschte ein wildes Getümmel, die Kajüte war voll Wasser gelaufen. Die Vorstenge war gebrochen und hing zur Hälfte über Bord. Der Kapitän wetterte mit dem Steuermann, der beim Ausbruch des Pampero geschlafen, seine Pflicht aufs Gröblichste verletzt hatte. Schadenfreude ist mir zwar eine unbekannte Regung, aber ich kann doch wohl sagen, dass mir dieses Wettern als die herrlichste Musik erschien. An diesen Pampero, der mir fast mein zartes Lebenslicht ausgeblasen, denke ich noch heute mit großem Vergnügen.
Am nächsten Tage erreichten wir die Reede von Buenos Aires. Welch entsetzliche Verheerung hatte hier der Pampero verursacht. Sechsunddreißig Schiffe, teils zertrümmert, teils vom Anker losgerissen, waren auf den Strand geschleudert. Ein spanisches Schiff wurde sogar tief ins Gehölz hineingetrieben und gewährte einen dem Seemann ins Herz schneidenden Anblick. Der damalige Präsident Rosas erstand dieses zwischen Bäumen eingekeilte Fahrzeug für eine geringe Summe, ließ es von geschickten Arbeitern als Lusthaus einrichten und hat dort während vieler Sommer seine Villeggiatur genommen.
Zu den derzeitigen interessantesten Sehenswürdigkeiten von Buenos Aires gehörte das Einfangen und Schlachten von Ochsen. In unmittelbarer Nähe der Stadt, auf den unermesslichen Pampas weideten diese kräftigen Tiere in großen Herden. Zu jener Zeit waren die nach Millionen zählenden Ochsen fast herrenloses Gut, nur der Gaucho, dessen geschickter Lassowurf das wilde Tier einfing, erhielt einen geringfügigen Lohn.
Auf derselben Stelle, so man den Ochsen erlegte, wurde er auch geschlachtet, von seinem Fleische aber nur die sehnenfreien, ausgesuchtesten Stücke zum Carne secco benutzt. Die Zubereitung dieser vorzugsweise für die Neger Brasiliens bestimmten Nahrung geschah folgendermaßen: Das sehnenfreie Fleisch wurde in Scheiben zerlegt, blieb während 36 Stunden in einer Salzlake liegen, wurde von der Sonne getrocknet und ohne Embalage in Schiffen verladen. Außer diesem Fleisch wurde nur noch die Haut des Tieres geborgen, die Knochen, wie der ganze übrige Fleischrest blieb ungenutzt liegen.
Damals kostete der größte Ochse nach unserer deutschen Währung zwölf Mark. Ich glaube aber, dass der Preis inzwischen wesentlich gestiegen ist, obwohl dort noch immer genügend Ochsen vorhanden sind.
Das Heranschaffen großer Fleischmassen an Bord des Schiffes gehörte zu den Obliegenheiten des Schiffsjungen.
Diese Arbeit war nicht zu unterschätzen. Man musste das erstandene Viertel eines Ochsen längere Zeit auf den Buckel laden, um watend das Boot erreichen zu können. Bei dem schlüpfrigen Boden und den unsichtbaren Vertiefungen war es als kein Wunder zu betrachten, wenn man einige Male samt der Bürde auf Sekunden in dem fußhohen Schlamme verschwand. Das bei diesem durch den mangelhaften Landungsplatz hervorgerufenen Transport die Appetitlichkeit des Ochsenfleisches nicht erhöht wurde, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.
Dennoch machte mir gerade diese Arbeit viel Vergnügen. Ich hatte dadurch Gelegenheit, die hochinteressanten Gauchos bei der Ausübung ihres Berufes zu beobachten. Die Geschicklichkeit dieser muskulösen, malerisch gekleideten Indianergestalten im Reiten wie im Lassowerfen ist wahrhaft bewunderungswürdig. Beim Anblick dieses Treibens erwuchsen in mir die sonderbarsten Wünsche. Die Phantasie des zur Romantik geneigten Schiffsjungen wurde lebhaft erregt, und wenn er nicht bereits Seemann gewesen wäre, wäre er ganz bestimmt Gaucho geworden.
Wie vieles könnte ich von diesem für mich so inhaltsvollen zweijährigen Aufenthalte auf dem Schiffe erzählen, von wie manchem unvergesslichen Eindruck berichten, überwältigende Naturschönheiten schildern, allein Raum und Zeit sind zu kostbar, als dass ich sie für derartige Dinge benutzen dürfte. Da aber der Leser berechtigten Anspruch auf die Vollständigkeit meiner Mitteilungen erheben darf, und doch nicht Gefahr laufen soll, allgemein Bekanntem, oft Erzähltem hier zu begegnen, so werde ich mir nur eine chronologische Aufzählung derselben erlauben. Die zwei Jahre sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Meine körperliche Entwicklung schritt sehr rasch vonstatten. Infolge meiner Beobachtungsgabe für alles Seemännische war ich sehr bald in der angenehmen Lage, den praktischen Dienst eines Matrosen zur vollen Zufriedenheit meines Kapitäns versehen zu können.
In diesem angenehmen Bewusstsein entwickelte sich auch mein Selbstgefühl in so hohem Grade, dass ich auch meine physischen Kräfte zu verwerten gedachte, für den Fall, dass mein unliebenswürdiger Steuermann seine eigenartigen, durchaus unmotivierten Liebkosungen fortsetzen sollte. Dieser Augenblick kam wie der Blitz aus heiterem Himmel. Der Befehl des Steuermannes rief mich unter Deck. Ahnungslos folgte ich diesem Rufe. Doch kaum war das verhasste Tauende in Folge eines wuchtigen Schlages in meinen Gesichtskreis gekommen, so erhielt der tatenlustige Däne eine so gründliche deutsche Widerlegung, dass ich nach einer minutenlangen heftigen Debatte die Wahlstatt siegreich behauptete und von nun an jenes gefürchtete Tauende als meine höchste Trophäe in Besitz nahm.
Von diesem denkwürdigen Augenblicke an war ein ehrenvoller Waffenstillstand zwischen uns geschlossen, und ich durfte nun bald auch die Segnungen des Friedens voll und ganz genießen. Ich hatte mir eine würdige Lebensstellung im wahren Sinne des Wortes erkämpft.
Nachdem unser Schoner seine vorläufige Fahrt vollendet, im Hafen von New York Anker geworfen, hatte auch ich die erste Station meiner selbst gewählten Lebensbahn erreicht und betrat als neugebackener Matrose den amerikanischen Boden. Allein Amerika ist ein sehr praktisches Land. Mit einem erhebenden Bewusstsein und sehr dürftigen Portemonnaie kann man dort nicht weit kommen.