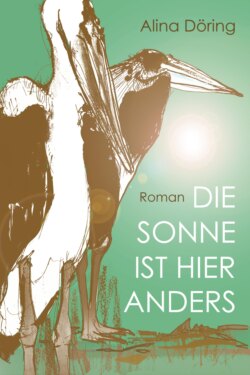Читать книгу Die Sonne ist hier anders - Alina Döring - Страница 6
04 – Marabu
ОглавлениеEs ist Sonntag, der Zoo ist laut. Auf dem Balkon nippt Martha abwesend an ihrem zweiten Kaffee. Durch die Bäume auf der Freianlage der Bisons lässt sich schon so früh am Morgen ein nicht enden wollender Besucherstrom erkennen. Die Geräuschkulisse ähnelt der eines Freibades, bei der sich die Stimmen zu einem beruhigenden Hintergrundrauschen mischen. Eine Lautsprecherdurchsage hallt blechern zu uns herüber. Irgendein Kind hat seine Eltern verloren und will im Zoo-Shop abgeholt werden. Wir schweigen. Es will kein Gespräch entstehen. Fühle mich fehl am Platz, fast unerwünscht.
In den kommenden Wochen werde ich Martha helfen. Mama hatte das vorgeschlagen. Damit sei ich wenigstens sinnvoll beschäftigt, bis ich mir einen neuen Job gesucht hätte. Mir war das recht: raus aus Passau, Zeit nachzudenken. Außerdem ist es Martha, seit jeher mehr Freundin als Oma. Aber jetzt gerade ist sie mir fremd. So verschlossen. Vielleicht liegt es am Alter. Irgendwann muss die Zeit uns trennen. Dann wird sie nicht mehr verstehen können, dass die Begegnung mit einem Mann im Zug mich vollkommen einnimmt, weil ihre Gedanken sich um Elementarstes, den körperlichen Verfall, drehen. Dann werden wir uns fremd gegenübersitzen, sie krumm und sabbernd und ich … Wie erträgt man das, wenn ein geliebter Mensch, ein Idol, unaufhaltsam verfällt? Meine Eingeweide ziehen sich zusammen. Mir wird übel. Aber dann sehe ich, wie sie für einen Moment die Fliege auf der Tischkante direkt vor sich fokussiert, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Fliege tot. Sie lächelt und schnippt das leblose Insekt geschickt vom Balkon. Und das alles mit links – als Rechtshänderin. Der Krampf in meinem Bauch löst sich wieder. Noch muss ich mir keine Sorgen machen.
Die Sonne steht schon voll auf dem Balkon. Ich strecke die Beine und schiebe die nackten Füße durch die senkrechten Stäbe des Geländers. Irgendein Vogel macht im Hintergrund wahnsinnigen Lärm.
«Ich gehe jetzt in den Zoo», sage ich, stehe auf und nehme die beiden Tassen vom Tisch.
«Alma, pass auf, mir gefällt das gar nicht, so auf euch angewiesen zu sein, aber es ist jetzt so und vorübergehend muss ich mich wohl damit abfinden. Aber alles, was einarmig geht, mache ich selbst, verstanden?»
Ich nicke, stelle die Tassen wieder ab. Das ist also das Problem.
Am Haupteingang des Zoos wird für den Jahresausweis ein Foto von mir gemacht. Werde wohl täglich hierherkommen. Aus Ermangelung an Alternativen. Ich beginne meinen Rundgang mit dem Strom der Menge rechts herum. Vieles haben sie neu gemacht, großzügiger, artgerechter und dennoch erscheint mir der Zoo kleiner und übersichtlicher.
Bei den Marabus, fast am Ende des Rundgangs, bin ich der einzige Besucher. Sie bewohnen eine große Wiese mit Wasserlauf, zweiseitig umrahmt von Bäumen, der Zaun nicht mehr als eine Reihe senkrechter Stäbe bis auf Brüstungshöhe mit einem davor gebundenem Kaninchendraht, damit die Kinder nicht ihre Arme durchstecken.
«Wie geht es euch?», frage ich leise in die Gruppe, die sich auf dem sonnenbeschienen Fleck des Rasens versammelt hat. Ich käme so gerne mit ihnen ins Gespräch. Aber sie ziehen die kahlen Köpfe noch tiefer zwischen die Schultern. Einer hebt genervt das rechte Bein, spreizt die Krallen und setzt es anschließend langsam an derselben Stelle wieder ab.
Ich rede noch leiser, will sie für mich gewinnen, doch sie bleiben skeptisch, rücken näher zueinander. Einer, der mit dem Rücken zu mir steht, wendet leicht den Kopf, um mich in sein Blickfeld zu bekommen. Er klappert leise mit dem Schnabel. Sie machen es richtig, lassen sich nicht gleich verführen, nur weil jemand nett zu ihnen ist. Sie brauchen ihn nicht, den Applaus, leben genügsam, unabhängig, frei – auch in Gefangenschaft. Der Sonne zu- und den Schaulustigen abgewandt, bleiben sie gelassen, behalten die Ruhe. Bewundernswert.
Schräg hinter mir ruft plötzlich jemand nach Daniel. Mir stockt der Atem, ich drehe mich hastig um. Dann Ernüchterung – es war nicht Daniel, es war nur ein Daniel.
Brandopfer. Das war meine erste Assoziation. Der Kopf der Marabus ist fast kahl und überzogen mit einer entzündet rot wirkenden Haut. Einige haben am Hinterkopf gräulichen Flaum. Rund um den Schnabelansatz und die Augen bis hinauf auf die Stirn sieht man mehr oder weniger stark ausgeprägten Schorf. Von Nahem betrachtet zugegebenermaßen äußerst abstoßend. Die Augen, farblich ein mittleres Braun, stehen leicht vor. Hinzu kommt, dass sie immer stinken, denn zur Kühlung scheißen sie sich die Beine selber an.
Die Köpfe sind aus hygienischen Gründen kahl. Haben sie einen Tierkadaver ausgeräumt, dessen Bauchdecke zuvor mit dem Schnabel aufgehackt wurde, lässt er sich so einfacher reinigen.
Und dennoch sind es meine Tiere.
In einer dieser Zoosendungen, die nachmittags auf den Öffentlich-Rechtlichen laufen, entließ der Pfleger das neu angekommene Marabuweibchen nach der Quarantäne endlich zu dem Männchen auf die Wiese, für das es als Partner bestimmt war. Zaghaft betrat der neue Vogel das Grün. Der Pfleger ging andächtig in die Hocke. «Ein wunderschönes, starkes Weibchen», sagte er schwärmend. Damals war ich vollkommen überrascht, konnte nicht verstehen, was schön sein sollte an diesem Tier. Von da an habe ich ihn eingehend studiert, den Marabu, und irgendwann sah ich es auch: die stoische Gelassenheit, die unaufdringliche Eleganz. Sie stehen über den Dingen, ihre Schönheit ist nicht offenkundig, sie ist subtil. Ich wäre gerne wie sie.
Ein Blick auf die Uhr. 12:30 Uhr.
Hebe zum Gruß die Hand, bevor ich mich umdrehe, um zu gehen. Überrascht, fast erschrocken, muss ich einen Schlenker zur Seite machen, um einem älteren Herrn auszuweichen, der mir lächelnd zunickt und ebenfalls grüßend die Hand hebt. Wie lange stand er schon hinter mir? Hat er mitbekommen, dass ich mit den Vögeln gesprochen habe? Ich drehe mich nochmal nach ihm um. Er bemerkt meinen Blick und wendet ebenfalls den Kopf. Er lächelt noch immer.
Still steht der Mann vor mir, mild blicken seine quecksilberfarbenen Augen mich aus dem gebräunten Gesicht an, das fast vollständig von dem kurzen, hellgrauen Bart überwuchert ist, der nahtlos in das genauso kurze, dichte, graue Haar übergeht. Zügig verlasse ich den Zoo.
Paradieskranich und Fischreiher
Die Paradieskraniche teilen sich die Fläche mit ein paar Entenvögeln und dem Chinesischen Muntjak. Der künstlich angelegte Tümpel in der Mitte kommt in erster Linie den Enten zugute. Der Paradieskranich interessiert sich nur mäßig für Wasser, auch wenn er gerne in dessen Nähe seine Nistmulden im Gras anlegt. Obwohl man sich sehr bemüht hat, dem Vogel Gras zu bieten, muss er doch darauf verzichten, weil der Boden der intensiven Nutzung durch die Anlagenbewohner wortwörtlich nicht gewachsen ist. Jeden Tag zur selben Zeit erwartet der Paradieskranich sein Futter, wohlportioniert und ausgewogen. Sämereien, Gräser, Getreide und Insekten werden ihm in einem fest montierten Eimer serviert. Wenn er frisst, verschwindet er bis zum Rumpf darin. Das lustige Bild vom kopflosen Vogel dürfte mittlerweile unzählige Kameradisplays zieren und auf diese Art und Weise um die Welt gegangen sein. Digital ist er also viel gereist.
Wenn Paarungszeit ist, paart er sich, wenn Brutzeit ist, brütet er. Die Nachzucht in Gefangenschaft ist allerdings schwierig. Durch das Stutzen der Flugfedern fehlt ihm die Balance, sodass der Zeugungsakt unmöglich wurde. Das Weibchen wird künstlich befruchtet. Das Leben des Paradieskranichs ist beschaulich, unaufgeregt, vorhersehbar. Nur die Jahreszeiten, Tierarztbesuche und die unterschiedlichen Tierpfleger bringen Abwechslung in seinen Alltag.
Auf dem Gelände des Paradieskranichs stehen einige hohe Bäume, in deren Kronen heimische Fischreiher brüten. Aus den oberen Etagen kann man ihre Nester sehen. Wenn der Fischreiher sein Nest verlässt, bleiben die gelegten Eier ungeschützt zurück. Er muss damit rechnen, dass Krähen die Schalen seines Geleges aufhacken und ihren Hunger an dem ungeborenen Leben stillen. Ungefähr 70 % des Nachwuchses fallen im ersten Jahr Fressfeinden, dem Wetter und dem Menschen zum Opfer.
Obwohl die Lebensmittelpunkte von Paradieskranich und Fischreiher dieselben Koordinaten haben, verbindet sie nichts. Wie in Paralleluniversen existieren sie nebeneinander, ohne wirklich Kenntnis voneinander zu haben. Der Fischreiher zieht täglich weite Kreise, um Futterquellen aufzutun. Dafür steigt er von seinem Nest auf und gleitet anmutig über sein Territorium. Er ist ein überlegter Jäger. Bei sogenannten Ansitzjagden verharrt er erst regungslos, um sich dann blitzschnell auf seine Beute zu stürzen. Zugegebenermaßen bedient er sich auch gerne mal am reich gedeckten Tisch der Zootiere. Bei den Pelikanen und den Pinguinen z. B. steht er dann unauffällig wie ein Statist am Rand und wartet darauf, dass etwas für ihn abfällt. Er hat Glück: Sein Image ist besser als das der Krähen. Er ist nicht so laut, nicht so aufdringlich und er kommt alleine. Und so lässt man ihn gewähren, anstatt ihn zu vertreiben, lässt die Freien auf die Gefangenen treffen, die nicht mehr füreinander übrig haben als ein bisschen Verwunderung.
Wie wäre das wohl, den Käfig zu verlassen, das Paradies nicht nur im Traum, sondern in der Wirklichkeit zu suchen?
Wind kommt auf, ein Wunder, dass die losen Nester auf den hohen Bäumen halten. Der Fischreiher, von der Baumkrone aus konzentriert das Terrain überblickend, wiegt seinen Körper ganz selbstverständlich im Takt der Naturgewalt.
Man braucht so viel Mut. Oder, nein, die Neugier muss nur größer sein als die Angst.
Ich schließe die Wohnungstür auf und gehe direkt durch zur Küche. Martha sitzt bei geöffneter Tür auf dem Balkon und telefoniert, die Anstrengung von heute Morgen ist weitgehend aus ihrem Gesicht verschwunden. Während ich das Essen zubereite, spiegelt sich ihr Bild im Silbertablett, das senkrecht auf der Arbeitsplatte steht. Sie telefoniert über Kopfhörer. Ich habe ihr die geschenkt. Unter den grauen Haaren schauen rechts und links nur weiße Kabel hervor, die sich vor der Brust verbinden und dann in dem Audio-Anschluss des Smartphones verschwinden. Richtige Kopfhörer wollte sie nicht, die sollte ich umtauschen. Die ließen sich nicht mit der Frisur vereinbaren. Einem kurzen, akkuraten Bob aus mittelgrauen Haaren, aus vielen, kräftigen Haaren, die schwungvoll beim Lachen vor und zurück wippen und am Ende wieder ordentlich in die Ausgangsposition zurückkehren. Sie trägt ein hochgeschlossenes, schwarzes T-Shirt, darüber eine lange, grobmaschige, silbergraue Strickjacke und eine Art Hosenrock, der bis Mitte der Wade reicht. Wie warm es auch ist, welkes Fleisch bleibt verdeckt. Ästhetik vor Ventilation – anders als bei den Marabus. Sie ist über siebzig, aber das Alter scheint keine Auswirkungen auf die Eitelkeit zu haben. Das Kinn ist immer noch fast grade als Resultat lebenslanger Disziplin. Jeden Tag Sport oder Gymnastik, aufrechte Haltung, gesunde Ernährung und genügend Schlaf.
Warum sie immer noch so streng mit sich selbst sei, habe ich mal gefragt. Sei das nicht der einzige Vorteil, den das Älterwerden mit sich bringe? Dass man sich seine eigenen Regeln machen könne, jenseits der allgegenwärtigen Erwartung? Dass man das gesellschaftliche Korsett endlich ablegen könne?
Eine Lebenshaltung lege man nicht ab, nur weil man älter werde, und ihre Regeln mache sie sich seit jeher selbst. Dabei drückte sie demonstrativ den Rücken durch und verschränkte die Arme feierlich.
«Und abgesehen davon», fügte sie nach einer kurzen Pause noch hinzu, «bist du schon halb tot, wenn niemand mehr etwas von dir erwartet.» Und so ein Korsett, richtig eingesetzt, hätte auch durchaus seine Vorteile. Ihr Blick dabei fest.
Warum ich mir über diese Dinge überhaupt schon Sorgen mache, fragte sie dann. In meinem Alter hätte sie sich noch für unsterblich gehalten.
Glücklicherweise konnte ich vom Thema ablenken und eine Antwort vermeiden, denn unsterblich habe ich mich noch nie gefühlt. Noch nie. Es verhält sich eher umgekehrt: peu á peu fühle ich mich weniger verwundbar.
Den Nachmittag verbringe ich mit dem Laptop auf meinem Bett. Ich gebe seinen Namen in die Suchmaschine ein und tatsächlich erscheint Daniels Bild bei unterschiedlichen sozialen Netzwerken. Es ist fast immer das gleiche Foto – ein professionelles Porträt, auf dem die blauen Augen geradezu unnatürlich leuchten.
Ich soll ihn anrufen, für ihn arbeiten. Unmöglich. Ich zögere einen Moment, lade dann die Datei mit seinem Bild auf meine Festplatte hinunter und öffne sie erneut. Mit dem Zoom vergrößere ich das Foto auf Bildschirmmaße. Lange starre ich ungeniert darauf, stelle mir vor, er starre zurück und errege mich unter seinem digitalen Blick. Dann kippt das Gefühl. Was tue ich da? Ich komme mir feige und erbärmlich vor. Ich werde ihn nicht anrufen. Kann es nicht. Also wozu dieses einseitige Geflirte mit ein paar Pixeln? Als es plötzlich an meine Tür klopft, klappe ich reflexartig den Rechner zu. Durch die geschlossene Tür fragt Martha, ob ich mit ihr eine Runde im botanischen Garten drehen würde. Ihr Tonfall lockend. Sie will mit mir reden.
Bitte schön. Ich könnte zwar nicht weniger bereit dafür sein, aber zumindest lenkt mich das von Daniel ab. Im Schatten der Bäume steuern wir den neuen Biergarten in der Flora an. Die meisten Plätze sind belegt, denn das umgebende Grün kühlt angenehm. Wir finden einen freien Tisch am Rand der Terrasse. Martha atmet tief ein. Die Luft riecht süßlich schwer nach dem Blumenmeer in dem Beet vor uns.
«Und, was hast du jetzt vor?»
Da ist sie auch schon, die Frage der Fragen. Kein Small Talk vorab, nein, sie kommt direkt zum Punkt, ihre Worte wirken wie ein dumpfer Schlag zwischen die Schulterblätter, bringen mich ins Straucheln. Ich ärgere mich über meine Schwäche und ihre Gnadenlosigkeit, wage aber nicht, mich zu beschweren, sondern suche stattdessen verzweifelt den Boden nach einem Loch ab, in dem ich verschwinden kann.
Die Sekunden rasen, immer ungeduldiger ihr Wippen mit dem übergeschlagenen Bein. Dann presse ich endlich, ein wenig zu laut, die Wahrheit heraus.
«Ich weiß es nicht!»
Demonstrativ weicht sie mit dem Oberkörper zurück und lächelt dabei diabolisch. Auf meinem T-Shirt zeichnen sich jetzt Schweißflecken ab. Ihr Blick ist feste auf meine Augen gerichtet. Das ist ihre Methode. Motivation durch Schmerz und Demütigung. Nur wer ernsthaft leidet, ist bemüht, Veränderung herbeizuführen.
«In den nächsten Wochen wird mir schon etwas einfallen. Zum Wintersemester will ich mich noch irgendwo einschreiben.» Ich bemühe mich um Optimismus, aber sie ahnt, dass ich noch unendlich weit entfernt von dem bin, was man ein Ziel nennt. Sie nickt als Zeichen der Kenntnisnahme. Ihr Mund bleibt still, aber ich spüre, dass sie mit sich ringt. Wie gerne würde sie mir jetzt die unzähligen Möglichkeiten darlegen, die ich hätte, würde mir gerne erklären, dass ich doch tun könne, was ich wolle. Ich müsste nur endlich mal etwas wollen. Und dann würde sie mit der flachen Hand auf den Tisch schlagen, sagen, dass sie mich nicht verstehe. Den Tränen nahe würde ich erwidern, dass ich mich selbst nicht verstünde und dann … Ich sehe ihr erregtes Gesicht genau vor mir, spüre ihre Hände um meinen Hals. Sie würde mich packen und würgen und das Wollen aus mir herauszwingen. Und all das tatsächlich nur mit den besten Absichten.
Sie ringt immer noch mit sich, obwohl sie längst begriffen hat, dass ihre Art der Konfrontation mich nur noch mehr lähmt. Schließlich entspannt sich ihr mahlender Kiefer.
«Gut, dann schauen wir mal, was bei deinen Überlegungen herauskommt. Noch ein Kölsch?»
Als es dunkel wird, machen wir uns auf den Heimweg. Eine Nachbarin war im richtigen Moment dazugestoßen, hatte unsere Konversation unwissentlich beendet und damit für einen einigermaßen entspannten Abend gesorgt.