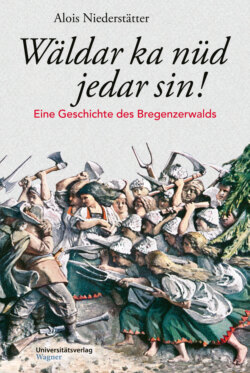Читать книгу Wäldar ka nüd jedar sin! - Alois Niederstätter - Страница 9
Zugänge
Оглавление1841 vermerkte der Geograph Johann Georg Staffler: »Als eine Alpengegend hatte der Bregenzerwald vor ungefähr 50 Jahren noch keine fahrbare Straße, und seine Verbindung mit den Nachbarbezirken mußte mühesam auf Saumwegen unterhalten werden«. Der wichtigste Zugang aus dem Rheintal führte von Schwarzach aus über Linzenberg sowie Farnach nach Alberschwende und weiter über die Lorena nach Schwarzenberg. Von Dornbirn aus gelangten Fußgänger, Reiter und Saumtiere über Winsau nach Alberschwende sowie über die Lose – das heutige Bödele – nach Schwarzenberg. 1546 scheinen die »sömer [Säumer], die die straß über die Losen« benutzten, erstmals urkundlich auf. Im ausgehenden 18. Jahrhundert entstand eine Verbindung von Bregenz aus über Fluh, Langen und Doren bis nach Krumbach.
Säumer mit ihren Tragtieren im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Erst 1836 wurde der Bau einer für den Fuhrverkehr geeigneten »Kommerzialstraße« von Schwarzach durch das Schwarzachtobel nach Alberschwende in Angriff genommen. Geplant hatte sie Alois Negrelli (1799–1858, 1850 nobilitiert als »Ritter von Moldelbe«), der »geistige Vater« des Suezkanals. Die Weiterführung von Alberschwende nach Egg erfolgte 1844/45 sowie in den folgenden Jahren über Egg-Tuppen und Bersbuch nach Bezau. Gleichfalls nach Negrellis Plänen wurde 1833 zur Verbesserung der Route ins Allgäu die Gschwendtobelstraße mit der noch bestehenden Gschwendtobelbrücke zwischen Lingenau und Großdorf erbaut. 1886 eröffnete man die Fahrstraße von Dornbirn-Haselstauden über den Achrain nach Alberschwende. Wer nicht zu Fuß gehen wollte, dem stand von der Mitte des 19. Jahrhunderts an eine in der Regel alle zwei Tage zwischen Bregenz und Bezau verkehrende Postkutsche zur Verfügung. Sie benötigte für diese Strecke etwa sechs Stunden.
Die Gschwendtobelbrücke über die Subersach zwischen Lingenau und Großdorf entstand nach einem Plan von Alois Negrelli, dem »geistigen Vater des Suezkanals«.
Noch heute ist Alberschwende das Tor zum Bregenzerwald.
Der Hochtannbergpass wurde erst 1954 von Schröcken aus mit einer Autostraße erschlossen.
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert machten der rasch an Bedeutung gewinnende Fremdenverkehr und das Einsetzen der Motorisierung einen weiteren Ausbau des Straßennetzes erforderlich. Die Maßnahmen betrafen vor allem die Verbindungen von Au nach Damüls, von Bregenz über Langen zur Staatsgrenze, von Lingenau über Hittisau und Sibratsgfäll zur Staatsgrenze sowie von Bezau nach Schröcken. Erst 1954 wurde von dort aus der Hochtannbergpass mit einer Straße erschlossen.
Schon im Jahr 1870 waren die Gemeindevertretungen der Bregenzerwälder Ortschaften übereingekommen, die Planung einer Bahntrasse von Bregenz nach Bezau in Auftrag zu geben. Sie sollte die Talschaft wirtschaftlich besser erschließen sowie an das überregionale Eisenbahnnetz und an die Bodenseeschifffahrt anbinden.
Allein bis zum Ansuchen an das Handelsministerium, die technischen Vorarbeiten in Angriff nehmen zu dürfen, vergingen aber noch 21 Jahre. Der Vorarlberger Landtag stimmte dem Vorhaben im Januar 1894 zu, obwohl zahlreiche Gemeinden vor allem im Süden des Landes, die Nachteile für ihre Region befürchteten, dagegen Einspruch erhoben hatten. 1899 genehmigte das Ministerium den Bau einer Schmalspurbahn (Spurweite 760 Millimeter) durch das Tal der Bregenzerach mit einer Streckenlänge von etwa 35 Kilometern, mit 18 Bahnhöfen und Haltstellen, 28 Brücken und drei Tunnels.
Rechte Seite: Mit der Eröffnung der Bregenzerwaldbahn im Jahr 1902 brach eine neue Zeit an.
Von da an ging alles sehr schnell: Nur drei Jahre nach der Konzessionierung hatten überwiegend italienischsprachige Arbeiter trotz des schwierigen Geländes das Werk vollendet. Am 15. September 1902 konnte die »Bregenzerwaldbahn« – so der offizielle Name, der Volksmund sprach sogleich vom »Wälderbähnle« – in Dienst gestellt werden. »Und Zuokumpft rumplot mit Gwault daher«, dichtete Gebhard Wölf le aus diesem Anlass.
Seit 1989 verkehrt das »Wälderbähnle« zwischen Andelsbuch-Bersbuch und Bezau als Museumsbahn.
Als Privatbahn gegründet, ging sie 1932 in das Eigentum des Bundes über. Aufgrund negativer Betriebsbilanzen wurde bereits 1936 ihre Einstellung erwogen. Zur stetig wachsenden Konkurrenz durch den Straßenverkehr und der ungünstigen Lage der Stationen im Achtal teils fernab der Siedlungen kam, dass die schwierigen geologischen Verhältnisse und die häufigen Hochwässer der Bregenzerach den Erhalt der Strecke sehr aufwändig machten. 1983 besiegelten Hangrutschungen und Unterspülungen das Schicksal des »Wälderbähnles«. Seit 1989 verkehrt auf der etwa sechs Kilometer langen Strecke zwischen Bezau und Andelsbuch-Bersbuch eine Museumsbahn.
Was einst für die wirtschaftliche Entwicklung der Talschaft von großer Bedeutung war, wird heute zunehmend auch als Belastung empfunden. So passieren derzeit jeden Werktag zwischen 12.400 und 14.200 Kraftfahrzeuge allein die Ortschaft Alberschwende. Besonders dramatisch ist die Situation infolge des Ausbaus der Schigebiete an Winterwochenenden, nicht selten bilden sich auf der Bregenzerwaldstraße – der L 200 – Staus von Alberschwende bis Mellau.