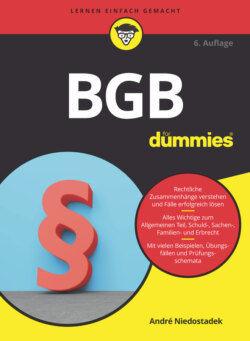Читать книгу BGB für Dummies - André Niedostadek - Страница 57
Der Kauf, praktisch einfach – juristisch kompliziert
ОглавлениеDer Unterschied zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sowie das Trennungs- und Abstraktionsprinzip lässt sich am Beispiel eines einfachen Vorgangs illustrieren: der Kauf einer Sache.
Der 14-jährige Felix kauft gegen den Willen seiner Eltern im Elektroladen von Edgar eine Spielekonsole für 400 EUR. Felix bezahlt gleich und erhält dafür im Gegenzug von Edgar die Konsole.
Betrachten Sie erst einmal das Verpflichtungsgeschäft. Was gilt in dieser Hinsicht? Zunächst hat der Fall insofern eine Besonderheit, da ein 14-jähriger die Konsole gekauft hat. Wie Sie noch sehen werden, sind Verträge von Minderjährigen (also Personen, die noch keine 18 Jahre alt sind) regelmäßig unwirksam, wenn die Zustimmung der Eltern fehlt und es sich nicht um ein sogenanntes lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft handelt. Das ergibt sich aus § 107 BGB. Diese Regelung hat Konsequenzen für den Kaufvertrag, der damit hinfällig ist (denn weder haben die Eltern zugestimmt noch ist der Kaufvertrag für Felix lediglich rechtlich vorteilhaft – im Gegenteil hat er einen rechtlichen Nachteil, da Felix aufgrund der synallagmatischen Verbindung seinerseits verpflichtet ist, den Kaufpreis zu zahlen!).
Gilt das auch für das Verfügungsgeschäft – oder genauer: die Verfügungsgeschäfte (also die Erfüllung des Kaufvertrags durch die Übergabe der Konsole an Felix und die Eigentumsverschaffung daran einerseits und das Begleichen des Kaufpreises durch die Übergabe des Geldes an Edgar)? Hier ist zu unterscheiden: Isoliert betrachtet ist die Verfügung über die Konsole für Felix durchaus vorteilhaft (er bekommt ja etwas, nämlich Eigentum). Die Tatsache, dass der Kaufvertrag unwirksam ist, lässt die Wirksamkeit der Eigentumsverschaffung unberührt (Abstraktionsprinzip!). Die Konsequenz: Felix erwirbt Eigentum an der Konsole, obwohl der Kaufvertrag mit Edgar selbst unwirksam ist (wenn die Eltern nicht zugestimmt haben). Anders verhält es sich dagegen bei der Übereignung des Geldes. Hier gibt Felix etwas aus der Hand. Das ist für ihn rechtlich nicht vorteilhaft. Und da es wiederum an der Zustimmung der Eltern fehlt, ist die Übereignung des Geldes an Edgar unwirksam.
Sie finden das Ergebnis ungerecht? Felix hat wirksam etwas bekommen (Eigentum an der Konsole) und die Zahlung war letztlich unwirksam? Gemach, das BGB kennt dafür eine Lösung. In den Fällen, in denen nämlich Leistungen ausgetauscht wurden, obwohl das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft unwirksam war, können die Leistungen wieder »zurückgeholt« werden. Das geschieht über die bereicherungsrechtliche Vorschrift des § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB. Aber dazu später mehr in Kapitel 8.
Im BGB steht zwar das Allgemeine vor dem Speziellen. In der Rechtsanwendung ist es aber genau umgekehrt: Hier sind die speziellen Regelungen vor den allgemeinen zu beachten. Lassen Sie sich nicht verwirren!