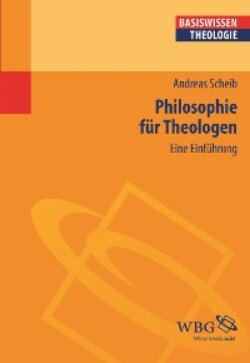Читать книгу Philosophie für Theologen - Andreas Scheib - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Einleitende Überlegungen. Zur Philosophie in der Theologie und zur Gestalt dieses Buches 1. Philosophie in der Theologie? Zur Aufgabenstellung
ОглавлениеEine Einführung in die Philosophie für Theologen? Es ist auf den ersten Blick überraschend, dass sich angehende Theologen im Rahmen ihrer universitären Ausbildung überhaupt mit einer scheinbar fachfremden Wissenschaftsdisziplin, nämlich der Philosophie, zu befassen haben. Schließlich müssen sie keine Veranstaltungen in Rechtsoder Wirtschaftswissenschaften, Medizin oder Biologie besuchen, obwohl es durchaus Aspekte gibt, in denen sich diese Wissenschaften mit der Theologie berühren können. Zur Auseinandersetzung mit der Philosophie sind sie aber verpflichtet – zum einen durch Studienordnungen, die, abhängig von Konfession, Studienort und Studienziel, in ziemlich unterschiedlichem Ausmaß den Besuch fachphilosophischer Lehrveranstaltungen vorschreiben. Zum anderen durch inhaltliche Gründe, sofern, pointiert ausgedrückt, christliche Theologie – oder sollte man besser von den christlichen Theologien sprechen? – immer schon (auch) Philosophie war und ist. Dies ansatzweise deutlich und greifbar zu machen, gehört, unter anderem, zu den Absichten des vorliegenden Bandes.
Zu definieren, was Philosophie ist, ist kein einfaches Unterfangen, weil sich das Verständnis dessen, was wir mit dem Begriff verbinden, im Laufe der Geschichte gewandelt hat und immer weiter wandeln wird. Die Geschichte der Philosophie ist so in hohem Maße auch die Geschichte der Bestimmung des Philosophiebegriffs selbst, und zu definieren, was denn Philosophie überhaupt sei oder was sie sein solle, gehört selbst immer schon zu ihrem eigentlichen Vollzug. Das „Historische Wörterbuch der Philosophie“, das umfangreichste begriffsgeschichtliche Nachschlagewerk zur Philosophie im deutschen Sprachraum, das die Bedeutungsvarianzen dessen darlegt, was man im Lauf der Philosophiegeschichte unter dem Begriff ‚Philosophie‘ verstanden und von der Beschäftigung mit Philosophie erwartet hat, verwendet allein für dieses Lemma insgesamt mehr als 300 Spalten.
Der Begriff, der vermutlich aus dem Umkreis von Pythagoras (ca. 575–500 v. Chr.) stammt, ist eine Zusammensetzung aus philein, Streben nach, und sophia, Weisheit. Wörtlich bedeutet der Begriff also etwa Streben nach beziehungsweise Liebe zur Weisheit – nicht zur Wahrheit, wie gerne angenommen wird. Philosophie bezeichnet, als Suche und Streben, damit ursprünglich so etwas wie eine Defizienz, einen Mangel, sowie die uns natürliche Neigung, diesen Mangel auszugleichen, indem wir nach Weisheit streben, die kein bloßes Verfügen über Wissen ist, sondern eine existentielle Haltung, die, unter anderem, auch die Kompetenz zur gelingenden Lebensführung auf der Basis gerechtfertigter Überzeugungen mit einschließt. Philosophie ist, wenigstens in ihren antiken Anfängen, so immer auch eine praktische Wissenschaft. Für Platon ist sie ein Streben nach dem Wissen des Guten und hat daher immer auch mit dem Auffinden jener Prinzipien zu tun, nach denen wir unsere Handlungen und unser Leben auszurichten haben. Daher hat im 20. Jahrhundert der französische Forscher Pierre Hadot die Formel von der „Philosophie als Lebensform“ („La Philosophie comme manière de vivre“)1 geprägt, die zeigt, dass zumindest die antike Philosophie mehr oder zumindest etwas anderes ist als bloße Suche nach Erkenntnis von Wahrheit, indem sie immer auch existentielle Relevanz besitzt.
Das Verständnis der Philosophie als existentielle Haltung wird im 20. Jahrhundert beispielsweise von Karl Jaspers (1883–1969) betont. Im letzten seiner zwölf Radiovorträge zur „Einführung in die Philosophie“ unterscheidet er Philosophie von den Religionen. Während Religion über so etwas wie ein soziologisches Gerüst verfügt, das in Form von Kirchen oder zumindest als Glaubensgemeinschaft auftritt, ist Philosophie immer die Sache des Einzelnen.2 Jaspers sagt hier zweierlei: Zunächst, dass Philosophie ebenso alt sei wie Religion. Diese Aussage über den Entstehungszusammenhang der Philosophie wird im zweiten Vortrag, „Ursprünge der Philosophie“, näher ausgeführt. Dort heißt es: „Die Geschichte der Philosophie als methodisches Denken hat ihre Anfänge vor zweieinhalb Jahrtausenden, als mythisches Denken aber viel früher.“3 Der Anfang des methodischen Denkens ist dabei von seinen Ursprüngen, die im Mythischen liegen, zu unterscheiden; denn, so Jaspers weiter: „Anfang ist etwas anderes als Ursprung. Der Anfang ist historisch und bringt für die Nachfolgenden eine wachsende Menge von Voraussetzungen durch die nun schon geleistete Denkarbeit. Ursprung ist aber jederzeit die Quelle, aus der der Antrieb zum Philosophieren kommt.“4
Diese Quelle beschreibt Jaspers, ganz in Übereinstimmung mit der antiken Tradition, als existentielles Staunen, Zweifel und Erschütterung: „Aus dem Staunen folgt die Frage und die Erkenntnis, aus dem Zweifel am Erkannten die kritische Prüfung und die klare Gewißheit, aus der Erschütterung des Menschen und dem Bewußtsein seiner Verlorenheit die Frage nach sich selbst.“5
Ebenso wie die Anfänge der Religion, die im Versuch einer Orientierung des Menschen über sich selbst und seine Rolle in der Welt liegen, ist auch Philosophie also ein ursprüngliches Fragen danach, wer ich selbst sei und in welchem Verhältnis ich zu meiner Umgebung stehe, und sie ist zugleich ein Suchen nach jenem Sinnzusammenhang, der meine Existenz und das mich Umgebende umspannt; gerade auch immer dann, wenn ich „erschüttert“ bin, mich also vor existentielle Grenzsituationen wie den eigenen Tod, den Tod mir Nahestehender, eigene oder fremde Schuld, Zufall und, wie Jaspers sagt, „die Unzuverlässigkeit der Welt“ gestellt sehe. Das Fragen ist natürlich, weil es so etwas wie das mir als Denkendem inhärente Korrelat bildet zu der von außen auf mich einwirkenden Welt, die mich mit Herausforderungen unterschiedlicher Art konfrontiert.
Der zweite erwähnenswerte Punkt in Jaspers Ausführungen lautet: „Kirchen sind für alle, Philosophie für Einzelne.“ Das Fragen als die dem Denkenden natürliche philosophische Haltung kann zwar in bestimmter Hinsicht zu Gewissheiten finden; seine drei Grundmotive, Staunen, Zweifel und Erschütterung, bleiben jedoch als dynamische Momente menschlicher Existenz unausgesetzt vorhanden. Anders ausgedrückt und in die hier leicht entfremdeten Worte gekleidet, die Wilhelm von Humboldt für die Sprache fand: Philosophie ist immer energeia und niemals ergon, das heißt, sie ist stets Tätigkeit, also Streben nach, niemals aber ein Fertiges, ein Werk, das es dem Suchenden erlauben würde, seine Tätigkeit einzustellen.
Diesen Gedanken drückt auch Immanuel Kant (1724–1804) in der Ankündigung seiner Vorlesungen im Wintersemester 1765/66 aus, indem er feststellt, Philosophie ließe sich nicht erlernen, weil sie niemals im Sinne eines Fertigen vorliege, es ließe sich daher immer nur das Philosophieren lernen, womit eben jenes Verfahren des methodisch geregelten Nachdenkens gemeint ist, das wir hier als fragende Haltung im Sinne der drei genannten Motive bezeichnen.
Religion in ihrer kirchlich gebundenen „soziologischen Gestalt“, wie Jaspers sagt, also als dogmatische Lehre, macht zumindest zunächst den Eindruck eines solchen ergon; denn die Verbindlichkeit des zu Glaubenden liegt ja in einer weitgehend starren Form im Rahmen der kirchlich-theologisch vorgegebenen Dogmatiken vor. Dem steht Philosophie eben als fragende, staunende und zweifelnde Haltung gegenüber, weil sie immer die Haltung des Einzelnen ist und nur sein kann; gemeinsam lässt sich nicht staunen und zweifeln, außer im Diskurs, das heißt der Kommunikation.
Hieraus leitet sich freilich sofort die Frage ab, ob denn die kirchlich-dogmatische Bindung der religiösen Überzeugung zwingend un- oder gar anti-philosophisch sei und ob im Umkehrschluss Philosophie Kirche ausschließe. Wenn dem so wäre, und wenn wir dennoch Philosophie als natürliche – und damit ist auch gemeint: notwendige – Haltung verstünden, dann würde dies nur bedeuten können: Religiöse Überzeugungen können nicht in verbindlichen Dogmen formuliert werden. Das wäre eine Kampfansage der Philosophie an Kirche und überhaupt an jede Art von Religionsgemeinschaft.
Diese Auffassung wurde und wird immer wieder vertreten. Sie lässt sich auch, soweit wir sehen, nicht als unmöglich entkräften. Zumindest aber lässt sich, nicht zuletzt historisch, zeigen, dass sie nicht notwendig und damit zwingend zu sein scheint, weil sich beide, Philosophie und Religion als gemeinschaftliche Überzeugung, über Jahrhunderte haben durchaus vereinbaren lassen; denn die nachdenkende, staunende und zweifelnde Haltung bedeutet ja nur und insbesondere, den Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, fragend zu begreifen und kritisch zu hinterfragen. Genau dies ist es aber, was auch Theologie tut, wenn sie als Wissenschaft auftritt. Als Theologie, also als methodisch geregeltes Nachdenken über Gott, ist sie nichts anderes als ein Zugang zum Gegenstand des Glaubens, Gott, den wir, als spezifischen Zugang, philosophisch nennen können. Damit haben wir zum einen das Verhältnis bestimmt, in dem Philosophie und Theologie zueinander stehen, indem Philosophie die Methodenlehre und Kriterienwissenschaft darstellt, mittels derer wir uns den theologischen Gegenständen nähern; zum anderen haben wir jenen Aspekt betont, der deutlich macht, dass Philosophie eben nicht in erster Linie oder gar ausschließlich eine akademische Wissenschaftsdisziplin ist, sondern eine Haltung. Jaspers urteilt: „Für einen wissenschaftsgläubigen Menschen ist das Schlimmste, daß die Philosophie gar keine allgemeingültigen Ergebnisse hat, etwas, das man wissen und damit besitzen kann. Während die Wissenschaften auf ihren Gebieten zwingend gewisse und allgemein anerkannte Erkenntnisse gewonnen haben, hat die Philosophie dies trotz der Bemühungen der Jahrtausende nicht erreicht. … In der Philosophie gibt es keine Einmütigkeit des endgültig Erkannten. … Das philosophische Denken hat auch nicht, wie die Wissenschaften, den Charakter eines Fortschrittsprozesses. Wir sind [in der Medizin; Vf.) gewiß viel weiter als Hippokrates, der griechische Arzt. Wir dürfen [aber] kaum sagen, daß wir [in der Philosophie; Vf.] weiter seien als Plato.… Im Philosophieren selbst sind wir vielleicht noch kaum wieder bei ihm angelangt. Daß jede Gestalt der Philosophie … der einmütigen Anerkennung aller entbehrt, das muß in der Natur ihrer Sache liegen. Die Art der in ihr zu gewinnenden Gewißheit ist … eine Vergewisserung, bei deren Gelingen das ganze Wesen des Menschen mitspricht. … [Es handelt sich] um das Ganze des Seins, das den Menschen als Menschen angeht.“6
Die Suche nach den Kriterien und Voraussetzungen gesicherter Erkenntnis beziehungsweise begründeter und begründbarer Überzeugungen besitzt so immer schon Aspekte, die mit der individuellen Lebensführung zu tun haben. Dabei ist die Wahrheitssuche, oder inzwischen wohl eher: die Suche nach den Kriterien dessen, was Wahrheit je sein, und ob beziehungsweise auf welche Weise sie argumentativ angestrebt und mit ihr umgegangen werden kann, nicht nur Voraussetzung für begründbare Handlungen, sondern zugleich immer schon der zentrale Kern der Philosophie, um den herum ihre übrigen Aufgabenbereiche gruppiert sind; zumal eben auch das Gelingen menschlicher Existenz im philosophischen Sinne immer mit Erkenntnis zu tun hat – zuvörderst mit der Erkenntnis unser selbst und unserer Relation zu dem, was unsere Erfahrungswelt ausmacht. Das gegenwärtige Verständnis von Philosophie ist dabei allerdings häufig deutlich technischer als beispielsweise das antike, und es konzentriert sich in hohem Maße auf formale und methodische Fragen zum Umgang mit plausiblen, gerechtfertigten Aussagen sowohl im alltäglichen wie im spezifisch wissenschaftlichen Kontext. Auch der heutige Begriff von Philosophie bezeichnet indes eine Wissenschaftsdisziplin, die einen Kanon von Teildisziplinen umfasst, die wir, durchaus in Anlehnung an antike Vorbilder, gemeinhin in theoretische und praktische unterscheiden. Theoretisch sind dabei jene Disziplinen, die primär auf Erkenntnis ausgelegt sind, wie beispielsweise Erkenntnistheorie, Logik, Metaphysik, philosophische Anthropologie und dergleichen, während die praktische Philosophie, die ursprünglich den gesamten Bereich der Gestaltung unseres alltäglichen Lebens betroffen hatte und heute im Wesentlichen die Ethik und ihre Spezialfelder (wie Bioethik, Wirtschaftsethik etc.) umfasst, etwas mit der handelnden Umsetzung von Erkenntnis zu tun hat.7
∗
Sofern Theologie auch heute mit dem Anspruch wissenschaftlicher Systematizität ihre Grundlagen reflektieren und die Elemente ihrer Lehrauffassungen kritisch beleuchten sowie weiterentwickeln will, ist sie darauf angewiesen, Gründe für die Aufrechterhaltung eines Systemanspruchs vorzulegen, der nicht im selben Sinne der Dynamik und Wandelbarkeit des Staunens und Zweifelns ausgesetzt sein kann, wie dies in der Philosophie der Fall ist, zumal wenigstens die Grundannahme der Theologie, die Existenz Gottes, nicht verhandelbar sein darf. In einem klassisch gewordenen Passus der „Architektonik der reinen Vernunft“ bestimmt Kant in seinem theoretischen Hauptwerk, der „Kritik der reinen Vernunft“ aus dem Jahre 1781/87, als System „die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee, die sowohl die Form eines Ganzen“ als auch „die Stelle der Teile untereinander“ bestimmt.8 Die Einheit eines Systems zeigt sich darin, dass jeder Teil aus dem Übrigen erschlossen werden kann.9 Ein System ist in diesem Sinne eine Erkenntnis, die „aus Prinzipien geschöpft worden“ sein muss, die zugleich allgemein und individuell erkannt sind10, die also für jeden Menschen, weil und sofern er Mensch ist, auf gleiche Weise als Grundlagen seiner Erkenntnis überhaupt fungieren. Einfacher ausgedrückt: Nur wenn und weil alle Menschen auf die gleiche Weise zu Erkenntnis gelangen, ist Wissenschaft ebenso wie Kommunikation überhaupt möglich.
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), einer der Hauptvertreter des sogenannten Deutschen Idealismus, erläutert in seinen „Aphorismen“, dass im Systemzusammenhang „das Mannigfaltige durch eine … Ableitung aus dem Einen zu erschöpfen sei, sodass die Philosophie aus Einem, völlig construirbaren Punkte das ganze … in seiner Mannigfaltigkeit ableite“.11
Die Überzeugung, alle Erkenntnis mit einheitlichen Verfahrensregeln aus einem einheitlichen Erkenntnisprinzip ableiten zu können, wird heute nicht nur philosophisch, sondern in allen Wissenschaften kaum mehr vertreten, und die Frage ob und in welchem Sinne so etwas wie wissenschaftliche Systematizität in dem eben beschriebenen Sinne überhaupt erreicht werden kann, und wie sie im Falle der Wissenschaftsdisziplin Philosophie zu denken ist, gehört zu den Gegenständen der heutigen Forschungsdiskussion, in denen die Philosophie eingebettet ist in allgemeine Überlegungen der Erkenntnistheorie, also der Auseinandersetzung mit der Frage, was Erkenntnis ist, was sie zu Tage bringen kann, welches ihre Bedingungen sind und welchen Verfahrensweisen sie zu folgen hat. Vor allem im 20. Jahrhundert wurde, unter anderem ausgehend von systemkritischen Positionen, wie sie beispielsweise von Friedrich Nietzsche (1844–1900) formuliert wurden, der Anspruch fragwürdig, vollständige philosophische Systeme zu gestalten, die auf der Basis einheitlicher Grundlagen und Prinzipien eine möglichst umfängliche Beschreibung unserer Erfahrungswelt beziehungsweise ihr zugrunde liegender Strukturen anstreben.
Während die Philosophie (die aus diesen Veränderungen in ihrem Selbstverständnis massive und signifikante Veränderungen sowohl in ihren Verfahrensweisen als auch in den Zielsetzungen ableitet, auf die hin sie sich ausrichtet) durchaus in der Lage ist, von ihrer systematischen Nähe zur Theologie abzusehen oder zumindest doch auf ihre Thematisierung zu verzichten, wird das enge Verhältnis, in dem beide Disziplinen zueinander stehen, und das sich als Verhältnis der gegenseitigen Durchdringung, konstitutionellen Abhängigkeit und gegenseitigen Begrenzung verstehen lässt, von der Seite der Theologie aus deutlicher offenbar. Die von dem Münsteraner Theologen und Religionsphilosophen Klaus Müller12 aufgelisteten propositionalen Gehalte eines so basalen theologischen Statements wie: „Ich bin davon überzeugt, dass Gott sich den Menschen offenbart oder geoffenbart hat“, zeigen, dass bereits die Hinwendung zur Theologie als Wissenschaftsdisziplin überhaupt eminent philosophische Implikationen in sich birgt, innerhalb derer Müller zumindest vier „philosophische Hintergrundannahmen“ katalogisiert, nämlich die einer verlässlichen Wirklichkeit, die erkannt und beschrieben werden kann, und deren Gehalte wahr und mittels der natürlichen Vernunft nachvollziehbar sein können: Wenn ich davon ausgehe, dass göttliche Offenbarung etwas Sachhaltiges mitteilt, dann bin ich davon überzeugt, „dass [uns] (a) in menschlicher Erfahrung eine verlässliche Wirklichkeit begegnet, die in ihrer Verfasstheit (b) erkannt und (c) beschrieben werden kann, und dass das, was Gott mitteilt, (d) wahr ist und sich als solches kraft der Vernunft nachvollziehen lässt. Bereits der Ausgangspunkt des christlichen Denkens“, so Müller, „impliziert also die philosophischen Begriffe der Wirklichkeit, der Vernunft, der Kommunikation und der Wahrheit.“13
Setzen wir diesen Gedanken fort, so können wir darüber hinaus noch zumindest einen weiteren philosophischen Gehalt mit der genannten ursprünglichen Glaubensaussage verbinden: nämlich den einer inhaltlichen Bestimmung dessen, was wir mit dem Begriff Gott auf theologisch sinnvolle Weise verbinden, oder, anders ausgedrückt, was wir unter ihm überhaupt zu denken haben. Zu den Aufgaben der Philosophie innerhalb einer theologischen Ausbildung gehört damit auch die formale Bestimmung dessen, was wir unter allgemeinen Begriffen denken, zu denen auch der Begriff Gott als Gegenstand der Theologie gehört, eben der Lehre von Gott also, die eben nicht bloßes Glauben ist, sondern die rationale und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit all jenen Gehalten, die sich aus dem Glauben an einen Gott ergeben, wie er sich nach christlich-theistischer Überzeugung selbst offenbart.
Wie Kant14 gezeigt hat, kann die formale Bestimmung dessen, was wir unter Gott verstehen, unabhängig davon sein, ob wir ihn als seiend annehmen oder nicht. Hierin unterscheidet sich die Offenbarungs- von der ausschließlich rational verfahrenden Theologie, indem die erste zunächst von der sich selbst offenbarenden Existenz Gottes ausgeht, um dann zu ergründen, was dieser Gott sei, während die zweite aus dem Begriff Gottes, seinen Implikationen und seiner Verknüpfung mit anderen Begriffen die Annahme seiner Existenz abzuleiten versucht.15 Diese sogenannte natürliche Theologie, wie sie insbesondere von Vertretern der Aufklärungsphilosophien16 vertreten wurde, scheitert jedoch grundsätzlich am Entwurf eines theistischen Gottesbildes und bleibt daher vor dem Hintergrund der theistischen Offenbarungsansprüche beziehungsweise der theistischen Offenbarungstheologie immer unbefriedigend; denn zu den Überzeugungen des Theismus gehört, dass der Gottesbegriff personal verstanden wird, also im Sinne eines personalen Schöpfers, der um seine Schöpfung weiß. Inwieweit dies ein Argument gegen natürliche Theologie ist oder nicht, kann hier nicht entschieden werden.
Neben der formalen Bestimmung des begrifflichen Instrumentariums unseres Denkens ist Philosophie immer auch und nicht zuletzt Methodenlehre, das heißt ein Kanon der methodisch geregelten Verfahrensweisen, mit denen wir uns Problemen und Fragestellungen auf wissenschaftliche Weise nähern. Philosophie hat damit, allgemein gesprochen, auch die Funktion einer grundlegenden Wissenschaftspropädeutik, ohne sich auf sie zu beschränken. Dies entspricht unter anderem ihrer historischen Genese und dem Umstand, dass der Begriff Philosophie lange als Oberbegriff für wissenschaftliches Arbeiten überhaupt diente.17 Dass also davon auszugehen ist, dass zumindest Teile des definitorischen Regelwerks und der verfahrenstechnischen Anweisungen zum Umgang mit Themen der Theologie Philosophie sind und nicht einfach selbst als Theologie bestimmt werden, ist historischen Zusammenhängen geschuldet, die zeigen, dass Philosophie und Theologie im rationalen Sinne gemeinsam, in gegenseitiger Abhängigkeit und durch wechselseitige Konstitution entstehen, indem sich der die Welt erklärende Mythos zur rationalen Theorie wandelt, sodass das Nachdenken über Gott, das wir Theologie nennen, einen integralen Bestandteil der frühen Systeme der Philosophie bezeichnet. Hans-Georg Gadamer urteilt entsprechend über die Rolle der philosophischen Theologie im Werk des paganen Philosophen Aristoteles, auf den wir später ausführlicher einzugehen haben, indem er feststellt: „Die Lehre vom höchsten Seienden, von Gott [ist] die Krönung der aristotelischen Philosophie.“18
Philosophie und Theologie sind, so verstanden und entgegen unserer üblichen Redeweise, im eigentlichen Sinne nicht zwei voneinander unabhängig existierende und sich entwickelnde Einzeldisziplinen, die sich gelegentlich treffen, überschneiden oder in Konkurrenz zueinander treten. Tatsächlich sind sie, zumindest sofern wir sie als Teilbereiche einer theologischen Ausbildung auffassen, vielmehr zwei Seiten ein und desselben, nämlich der Bemühung darum, jene Inhalte zu verstehen, die mit dem Gottesgedanken im weitesten Sinne verbunden sind und mittels derer die Theologie darum ringt, das Bild eines von Sinn erfüllten Kosmos dem der Absurdität bloßer Zufälligkeit entgegenzusetzen.19 Philosophie liefert hierzu die Terminologie und die Beschreibungsmodelle, mit denen theologische Annahmen – also solche, die sich aus der Offenbarung speisen – ihrer rationalen Be- und Umschreibung zugeführt werden sollen und können.
Zur Verdeutlichung bieten sich zwei für den christlichen – beziehungsweise im einen Fall besonders für den katholischen – Glauben essentielle Annahmen an: zunächst die der göttlichen Trinität, also dreier Personen in einer Substanz, die zu den Signaturen des Christentums gegenüber den beiden monotheistischen Schwesterreligionen gehört und die sich einer Klärung entzieht, wenn wir nicht ihren eminent philosophischen Gehalt mitbedenken; und daneben die eines Substanzwandels im Moment der eucharistischen Konsekration von Brot und Wein, der vermutlich seit Mitte des 12. Jahrhunderts mit dem Begriff Transsubstantiation bezeichnet wird.20 Dieser Begriff fließt in die Formulierungen des Vierten Laterankonzils von 1215 ein, das von „transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina“ spricht, also vom „durch die göttliche Macht in Leib verwandelten Brot und in Blut verwandelten Wein“.21
Thomas von Aquin, ein Denker des 13. Jahrhunderts, der für die Entwicklung sowohl der Philosophie wie auch der Theologie große Bedeutung besitzt, hat durch seine Analyse des Transsubstantiationsvorgangs, den katholische Gläubige im Moment der Wandlung annehmen, das Eucharistieproblem „auf der Höhe der Physik seiner Zeit diskutiert“22, einer rationalen Physik, die auf der Metaphysik des Aristoteles fußt, eines paganen, vorchristlichen Autors, der mit Offenbarungen und Glaubensüberzeugungen wenig im Sinn hat, und er verweist damit auf die Bedeutung jener Begriffe, die Produkte eben jener philosophischen Traditionen sind, deren Ursprung weiter zurückliegt als die christliche Offenbarung und die Einsetzung der Sakramente, und auf die bereits die Kirchenväter der Spätantike zurückgreifen, um einige der grundlegenden Glaubensüberzeugungen so zu formulieren, dass sie rational greifbar und einer konsistenten Lehre zugeführt werden können.
Glauben aus dem Dunkel der Ahnung herauszuführen, ohne damit zu behaupten, alle Glaubensmysterien aufgrund ihrer Formulierung in philosophischen Metaphern vollständig zu durchschauen, gelingt der Theologie, wenn überhaupt, nur über rationales Denken und dessen Instrument, die Sprache, sodass, in einer weiteren Annäherung, Philosophie die Form ist, in der theologische Gedanken nur erst gedacht werden können. Und zugleich damit sind eben jene Konzepte und Vorstellungen, die diese Form geprägt haben, mitverantwortlich dafür, in welcher Weise wir Geoffenbartes verstehen und als etwas erkennen, das der menschlichen Ratio nicht zuwiderläuft. Das Gewand, in dem das Geglaubte zu Gewusstem zu werden versucht, ist daher das der Philosophie, zunächst einer paganen Philosophie, die lange vor die christliche Offenbarung des Neuen Testamentes zurückgreift und die im Hintergrund des Weltverständnisses jenes Denkenden steht, der sich und anderen verständlich zu machen versucht, was genau er denn glaubt und wie er das Geoffenbarte zu begreifen hat.
Die Leistungsfähigkeit einer solchen Philosophie, das heißt jenes natürlichen Fragens nach und Nachdenkens über bestimmte Inhalte – und nichts anderes ist Philosophie –, ist freilich, weil sie eben natürlich ist, begrenzt. In der philosophischen Literatur nimmt daher die Bestimmung der Zuständigkeiten des „lumen naturale“, des „natürlichen Lichts“ des menschlichen Denkens – der Philosophie also – und des „lumen supranaturale“, das heißt des „übernatürlichen Lichts“ der Offenbarung, die, so die Überzeugung des Glaubenden, von Gott kommt, breiten Raum ein. Anselm von Canterburys (ca. 1033–1109) als ontologisches Argument bekannt gewordene Argumentation des zweiten und dritten Kapitels des Proslogion lässt sich in diesem Sinne als Untersuchung über die Leistungsfähigkeit des endlichen, menschlichen Geistes deuten, die danach beurteilt wird, ob wir auf natürlichem Wege in der Lage sind, den modalen Status göttlicher Existenz zu beweisen.23
Das natürliche Licht findet seine Grenzen in der Endlichkeit des menschlichen Intellekts, der Unendliches nicht adäquat zu denken vermag und der auch die Glaubensmysterien nicht vollständig erhellen kann. Ob und inwiefern dies ein Argument gegen Theologie ist, wurde und wird von philosophischer Seite immer wieder diskutiert. Und damit haben wir den vierten Aspekt der Rolle, welche die Philosophie – nicht nur für die Theologie – spielt: Sie ist so etwas wie eine Kriterienwissenschaft, die uns zeigt, unter welchen Voraussetzungen es sinnvoll und vertretbar ist, eine Annahme für plausibel zu halten und ihr zu glauben. Der Begriff der Kriterien verweist auf den der Kritik, die zu den zentralen Aufgaben von Philosophie gehört. Müller fährt nach der oben zitierten Stelle fort: „Auch Judentum und Islam erheben vergleichbare Geltungsansprüche. Das spezifisch Christliche besteht aber darin, eben diese Geltungsansprüche einer Gültigkeitsprüfung auf dem Forum der Philosophie zu unterziehen und damit dem Kriterium einer universalen Vernunft auszusetzen – in der Überzeugung, dass Religion und Philosophie der Versöhnung fähig und bedürftig sind.“24 Dies ist nichts anderes als philosophische Kritik, ohne die jede Theologie zum Fideismus wird und dazu tendiert, fundamentalistische Züge anzunehmen.
Das Grundproblem, das hier deutlich wird, wird besonders in der Philosophie der Aufklärung diskutiert, also jener philosophischen Strömung, die nichts für wahr hält als das, was sie selbst durch eigenes Nachdenken als bewiesen ansieht. Kant, ein Hauptvertreter der deutschen Aufklärung und der Auffassung, Philosophie habe eine kritische Wissenschaft zu sein, hat hierfür jene prominente Formel gefunden, die jeder noch aus seiner Schulzeit kennt (oder kennen sollte): Er spricht bei der Beantwortung der Frage, was Aufklärung sei, vom „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“, den wir nur im kritisch prüfenden, autonomen Denken finden. Rationale natürliche Theologie, die vor allem im Zusammenhang mit der Philosophie der Aufklärung aufkommt, versteht sich so als extreme Form einer Umsetzung der aufklärerischen Maxime, nur das glauben und als glaubhaft vertreten zu dürfen, was ich selbst für bewiesen oder aus anderen Gründen für plausibel und intersubjektiv vermittelbar halte. Die Frage, wie ich vor dem Hintergrund einer solchen Forderung mit Offenbarung umzugehen habe und wie ich das Verhältnis von argumentativ begründetem Wissen zu dem durch andere Quellen legitimierten Für-wahr-Halten des Glaubens auffasse, gehört zu den zentralen Fragen, denen sich ein philosophisch geschultes kritisches Bewusstsein daher unausgesetzt zu stellen hat. Seine erste Stufe, in der es sich nicht erschöpft, ist dabei der Beleg der widerspruchsfreien Vereinbarkeit von Glauben und Vernunft. Die Inhalte des Glaubens sind indes keineswegs dadurch bereits bewiesen, dass sie widerspruchsfrei sind. Auch wenn der christliche Gottesbegriff sich ohne inneren logischen Widerspruch denken lassen sollte – was bei einem personalen trinitarischen Seienden, dem dreifaltigen Gott des Christentums also, keineswegs ausgemacht ist –, ist damit noch nichts darüber gesagt, ob der hierdurch beschriebene Gott auch wirklich existiert. Und die Annahme, dass es Beweisgänge im philosophischen Sinne für die Inhalte eines theistischen Glaubens wie den christlichen gibt, wird zumindest innerhalb der heutigen Philosophie, vorsichtig ausgedrückt, keineswegs mehrheitlich akzeptiert. Anders formuliert: Die Zahl derjenigen Philosophen, die es für beweisbar halten, das Gott existiert, ist heute eher gering.
Der rationale Umgang mit Glaubensgegenständen, der Theologie ist, impliziert somit immer zugleich auch die philosophische Auseinandersetzung mit jenen allgemeinen Voraussetzungen von Aussagen, die eminent philosophisch sind. Sobald wir über die Inhalte des Glaubens nachdenken, befinden wir uns daher bereits auf dem Terrain der Philosophie, die sich damit nicht als Nachbar- oder Hilfsdisziplin, sondern als fester Bestandteil des theologischen Diskurses selbst ausweist. In ihrer Verknüpfung von historischen Aspekten, die beispielsweise die Abhängigkeit der Gestaltung theologischer Modellvorstellungen von ihrem philosophischen Material offenlegen, mit den systematischen Ansätzen einer epistemologischen (erkenntnistheoretischen) Fundierung des theologischen Diskurses, bildet Philosophie damit so etwas wie ein strukturierendes Prinzip der Theologie, ohne das diese nicht möglich ist.
Wenn wir von der Rolle der Philosophie in der Theologie sprechen, und insbesondere wenn wir das Bild einer homogenen Verschränkung von Philosophie und Theologie als integralen Bestandteilen eines philosophisch-theologischen Projekts zweier quasi gleichberechtigter konstitutiver Größen des lógos vom theós zu zeichnen scheinen, dann ist dies selbstverständlich irreführend; denn abgesehen von der völlig unterschiedlichen Bedeutung, die philosophische Überlegungen in nicht-christlichen Theologien haben, auf die wir im vorliegenden Band nicht eingehen können, sind einerseits die katholische und die evangelische Theologie auch hinsichtlich ihrer Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen durchaus verschieden – wenn auch nicht so inhomogen wie die philosophischen Strömungen, die in theologische Überzeugungen Einzug gefunden und diese bestimmt haben. Und andererseits ist das Verhältnis beider zur Philosophie immer wieder Gegenstand neuer Grenzziehungen und Positionsbestimmungen, die zuweilen von einer schroffen Ablehnung der Philosophie durch Vertreter der Theologie ebenso gekennzeichnet sind wie von der mittlerweile deutlich überwiegenden Ablehnung theologischer Themenfelder durch die zeitgenössische Philosophie.
Christlich-theologische Gehalte treten seit der Antike im Gewand philosophischer Begriffe auf. Erste Tendenzen zu einer allmählichen Verschmelzung christlicher Glaubenspositionen mit philosophischen Ansätzen sind ab dem 2. Jahrhundert zu beobachten.
Über den inhaltlichen Einfluss, den diese sogenannte „Hellenisierung des Glaubens“, also die Formulierung von Glaubensinhalten in der Sprache der Philosophie, auf Glaubensinhalte und die allmähliche Ausgestaltung von Glaubensdogmen ausübt, wurde lange und wird auch heute noch diskutiert. Polemisch bringt Nietzsche die Nähe des Christentums zum Platonismus der frühchristlichen Zeit in seinem bekannten Diktum zum Ausdruck, Christentum sei Platonismus für das Volk. Wir werden auf Nietzsche im weiteren Verlauf im Zusammenhang seiner Metaphysikkritik zurückkommen, aber bereits hier sei angemerkt, dass er im Christentum eine vereinfachte, popularisierte Form der platonischen beziehungsweise nachplatonischen Philosophie erkennt.
Die Grundfrage der Hellenisierungs-Diskussion lautet, stark verkürzt, ob die Philosophie auf unangemessene Weise auf die Gestaltung religiöser Überzeugungen Einfluss genommen habe. Auf katholischer Seite wird die Auseinandersetzung exemplarisch im 12. Jahrhundert mit den Namen Petrus Abaelardus und Bernhard von Clairveaux verknüpft: Abaelard ist ein prominenter Vertreter der neuen, in Universitäten betriebenen philosophisch-diskursiven Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten, der einen hermeneutischen, das bedeutet: interpretativen Umgang mit den christlichen Glaubenstexten fordert, weil sie sonst widersprüchlich sind, und der auf diese Weise die rationale, also philosophische Diskussion von Glaubensgehalten als wichtiges Erfordernis einer textkritischen Theologie lehrt, ohne dies mit einer grundsätzlichen Kritik an Offenbarung zu verbinden. Dem steht der Zisterzienser Bernhard gegenüber, dessen eher kontemplativ-mystische Haltung und textgebundene Glaubenstreue ihn zum scharfen Kritiker der Ansprüche einer natürlichen Rationalität machen, die als Korrektiv für die richtige Auslegung der Offenbarungstexte fungieren will.
Diese wie gesagt exemplarische Gegenüberstellung steht symbolhaft für einen Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt und in dessen Rahmen immer und immer wieder die Frage nach der Zuständigkeit der natürlichen, philosophischen Rationalität für theologische Themenfelder erörtert wird. Insbesondere immer dann, wenn die Ergebnisse des natürlichen Nachdenkens in Konflikt mit Glaubensinhalten oder theologischen Lehrmeinungen geraten oder diesen direkt zuwiderlaufen, entstehen Konflikte, in denen auch allgemein grundlegende Fragen nach dem Geltungsanspruch theologischer und philosophischer Aussagen sowie die Frage, welche Disziplin der anderen übergeordnet ist und als deren Korrektiv zu fungieren hat, akut werden.
Besonders gut sichtbar werden diese Konflikte an einem Ereignis des 13. Jahrhunderts: 1277 verurteilt der Pariser Bischof Etienne Tempier über 200 Thesen, die, tatsächlich oder vermeintlich, von Professoren der Pariser Universität vertreten werden. Es handelt sich um Thesen, die den theologischen Überzeugungen der Zeit zuwiderlaufen und die mutmaßlich aus der intensiven Auseinandersetzung dieser Professoren mit Aristoteles und seiner vorchristlich-paganen Philosophie resultieren: Der antike Autor Aristoteles (384–322 v. Chr.), mit dem wir uns im weiteren Verlauf ausführlicher zu befassen haben, ist, nachdem seine Schriften jahrhundertelang im lateinischen Europa kaum gelesen wurden, im 13. Jahrhundert für viele zu dem zentralen philosophischen Bezugsautor geworden, dessen formale Qualitäten ihn unter anderem zum Vorbild für korrektes wissenschaftliches Arbeiten machen. Lateinische Texte der Zeit verzichten häufig darauf, ihn beim Namen zu nennen, und beschränken sich auf den Titel philosophus, bei dem jeder weiß, wer gemeint ist. Nun vertritt Aristoteles Auffassungen, die mit christlichen Glaubenssätzen nicht kompatibel sind. So kennt er beispielsweise keine Schöpfung, sondern geht von einer unerschaffenen, seit Ewigkeit existierenden Welt aus. Ebenso kennt er keine individuelle Unsterblichkeit beziehungsweise Auferstehung, und sein Gottesbegriff unterscheidet sich signifikant von dem christlichen Gott, der trinitarisch strukturiert ist und sich handelnd mit dem Universum befasst. Der aristotelische Gott ist stattdessen nicht-trinitarisch, vollständig reflexiv und handelt nicht aktiv in der Welt. Hieraus entstehen Konflikte, und immer wieder vertreten Wissenschaftler der Zeit die Auffassung, dass die formal korrekt hergeleiteten Annahmen des Aristoteles zumindest keinen geringeren Gültigkeitsstatus haben können als theologische. 1277 klagt Bischof Tempier, es gebe Magister an der Pariser Universität, die Meinungen verträten, die sie für „nota et vera secundum Philosophum sed non secundum fidem catholicam“ hielten, die also offenkundig wahr seien gemäß dem, was der Philosoph – gemeint ist wie erwähnt Aristoteles – lehrt, nicht aber gemäß dem katholischen Glauben.25
Die Thesen, die im Sinne des Aristoteles formuliert und nicht mit kirchlichen Lehrmeinungen kompatibel sind, werden verurteilt, um das Primat der Theologie sicherzustellen. Dieses eher kirchenpolitisch als inhaltlich zu begründende Machtgefälle zwischen theologischem und philosophischem Lehranspruch ist es noch, das Mitte des 14. Jahrhunderts Johannes Buridan in seiner Vorlesung über (die aristotelische) Physik davon berichten lässt, dass die Magister der Pariser Fakultät der Freien Künste26 zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit zu schwören haben, dass sie keine Themen diskutieren, die zum Gebiet der Theologie gehören, und dass sie bei Fragen, die den Glauben und die Theologie zumindest berühren, stets für den Glauben zu argumentieren und glaubenskritische Argumente zu widerlegen haben.27 Sobald eine philosophische Argumentation Glaubenssätze in Frage zu stellen scheint, ist sie zu bekämpfen.28 Gleichzeitig mit seinem Bedauern über die so erzwungene Einschränkung seiner Lehrthemen29, weist Buridan indes darauf hin, dass naturphilosophische Fragen, wie die nach der Möglichkeit des Vakuums, also des vollständig leeren und auch nicht lufterfüllten Raumes, gar nicht behandelt werden können, ohne den Bereich der Theologie zumindest zu berühren, sofern sie beispielsweise die Möglichkeiten der göttlichen Allmacht diskutieren.30
Zu den Vorwürfen, die Tempier vorbringt, gehört daher unter anderem auch, „dass einige Lehrer der freien Künste zu Paris die Grenzen ihrer eigenen Fakultät überschreiten“.31 Die „offensichtlichen und verabscheuungswürdigen Irrlehren, Eitelkeiten und Hirngespinste“32 (also die Ergebnisse einer natürlichen Rationalität, die sich nicht auf Offenbarung stützt und daher Annahmen wie die einer Erschaffung der Welt aus dem Nichts durch einen personalen Schöpfergott oder die persönliche Wiederauferstehung jedes Einzelnen in Frage stellt), die hieraus resultieren, sind, so ist Tempier zu verstehen, nicht nur auf die fehlerhafte Einschätzung des Geltungsgefüges von Theologie und Philosophie zurückzuführen, sondern sie resultieren bereits aus der fehlerhaften Anwendung der Philosophie auf Gegenstände, die eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Theologie liegen, also daraus, theologische Themen überhaupt philosophisch zu betrachten: Magister der Artesfakultät haben sich daher der Diskussion theologischer Fragen vollständig zu enthalten, um die zulässigen Grenzen der natürlichen Rationalität nicht regelwidrig zu verlassen. Die Eindeutigkeit der Dominanz, die dem Theologischen von theologischer Seite eingeräumt wird, fußt, vereinfachend gesagt, auf einem prinzipiellen Misstrauen gegenüber der natürlichen Rationalität, wie es bereits bei Paulus besteht. Wir werden im Zusammenhang mit Aristoteles sehen, dass die natürliche Rationalität im Verständnis der antiken Philosophie tatsächlich keine endgültige, unumstößlich gewisse Erkenntnis anstrebt, wie sie Paulus in der Offenbarung sieht – sofern und weil er voraussetzt, dass sie eben jene göttliche Quelle hat, die sich in ihr offenbart, und aus der sich die Verlässlichkeit dieser Offenbarung überhaupt ableitet, ohne freilich den offenkundigen Zirkel umgehen zu können, der in dieser Argumentationsfigur liegt.
Eine philosophische Basis findet die Überzeugung von der Schwäche des lumen naturale, die bei Autoren wie Petrus Damianus im 11. Jahrhundert zum geflügelten Wort der philosophia als ancilla theologiae wird, also der Philosophie als Magd der Theologie33, bei der Unterscheidung natürlich und übernatürlich begründeten und begründbaren Wissens durch den spätantiken Kirchenlehrer und Philosophen Augustinus (354–430), der eine grundsätzliche Begrenzung der Leistungsfähigkeit des natürlichen Lichtes bei der Suche nach Wahrheit vermutet, die weite Verbreitung findet: Wie Gregor von Nyssa (ca. 335–394) annimmt, dass Gott zu denken gleichbedeutend damit ist Wahrheit zu denken34, geht Augustinus, in Umkehrung dieser Figur35, davon aus, dass jede Erkenntnis von Wahrheit nur möglich ist aufgrund der vorgängigen Gegenwart eines von Gott herkommenden Wissens im Menschen. Wahrheit zu denken bedeutet daher, das (oder im) göttliche(n) Licht zu denken.36 Beobachtungen der physikalischen Welt können keine Wahrheit zu Tage fördern, weil Körperliches veränderlich ist, Wahrheit aber unveränderlich sein muss.37 Die Philosophie (der Antike) muss aber bei der empirischen Beobachtung der physikalischen Welt ansetzen, um zu Erkenntnissen zu gelangen, das heißt, sie muss induktiv und von der empirischen Einzelerfahrung durch Abstraktion zur Einsicht in allgemeine Sachverhalte kommen, die auf dieser Basis immer nur mit Wahrscheinlichkeit erkannt werden können, niemals aber mit derjenigen Gewissheit, die wir in der Mathematik besitzen oder die uns durch unmittelbare Einsicht in Wesensmerkmale von Gegenständen zugänglich wäre.38 Augustinus’ Auffassung unterscheidet einerseits die induktiven Überlegungen der natürlichen Rationalität, die nur zum Wahrscheinlichen gelangt, von der sincera veritas, die ausschließlich in der Offenbarung zugänglich sein kann; und sie zeigt uns andererseits, dass auch in der eingeschränkten, natürlichen Erkenntnis stets das Urbild der eigentlichen Wahrheit als vorgängig gegeben zu denken ist; denn so wie wir nur lieben können was wir kennen, wie Augustinus in seinem Buch „Über die Trinität“ („De Trinitate“) die Voraussetzungen für die introspektive Einsicht in die Abbildrelation unseres Geistes gegenüber dem Göttlichen beschreibt, können wir auch dann nur etwas für wahrscheinlich halten, wenn wir über ein Bild des Wahren verfügen. Dies lehrt die Höhervalenz des theologischen Wissens, das, für Augustinus, einzig Wissen im eigentlichen Sinne sein kann.39
Die rationalitässkeptische Grundhaltung, die sowohl in der Verurteilung von 1277 als auch in der von Buridan berichteten Regelung zum Ausdruck kommt, und die auch Bernhard zu seiner Geringschätzung menschlicher Erkenntniskraft inspiriert haben dürfte, ist, wie angedeutet, die des Paulus, der im 1. Korintherbrief des Neuen Testamentes die pagane Suche nach Weisheit und die Befassung mit unserer natürlichen Rationalität als bloße Torheit deutet und nur das geoffenbarte Wort für zuverlässig hält.40 Wie auch der spätantike Philosoph und Theologe Augustinus, wird im 16. Jahrhundert der Reformator Martin Luther (1483–1546), ähnlich wie Bernhard, davon ausgehen, dass das zunehmende Gewicht, das die philosophische Durchleuchtung und Explikation im Laufe vor allem der mittelalterlichen Theologie, die wir wegen der Gründung der europäischen Universitäten auch „scholastisch“ nennen, erhalten hat, eine Fehlentwicklung ist. Für ihn ist gerade die katholische Eucharistieauffassung, die wir eben kurz angesprochen haben und auf die wir im weiteren Verlauf ausführlicher eingehen werden, ein exemplarischer Fall der Verstellung des Glaubens durch die Sprache der Philosophie, in der die Theologie im Mittelalter formuliert wird. Eine Vielzahl zentraler Überzeugungen und Lehrgehalte des christlichen Denkens ist bereits lange vor der Reformation festgelegt worden, sodass diese zumindest für die christlichen Konfessionen als gleichartig angesehen werden können. Und einige der Fragen, die später als Differenzen zwischen katholischen und evangelischen Glaubensüberzeugungen auftreten, werden bereits im 13. Jahrhundert diskutiert. Letzteres gilt eben besonders für die Eucharistie- beziehungsweise Abendmahlsthematik, die zusammen mit dem Verständnis des Priester- oder des Pastorenamts zu den Hauptdivergenzen katholischer und evangelischer Theologien gehört. Dass Luther die spezifisch philosophischen Aspekte dieser Entwicklung ablehnt, ist die eine Seite. Dass er sie, als Hochschullehrer, selbstverständlich kennt, um sie aufgrund sachlicher Einwände ablehnen zu können, ist die andere, die zeigt, dass das Verständnis auch der theologischen Philosophiekritik ohne Kenntnisse der Philosophie nicht möglich ist.
Die Entwicklung der Philosophie vom Mittelalter bis heute lässt sich, stark vergröbernd, insgesamt auch als Geschichte ihrer Emanzipation von der Theologie lesen. Bereits in der Renaissance, insbesondere aber seit dem 17. Jahrhundert lässt sich eine Entwicklung beobachten, innerhalb derer die Philosophie immer mehr ihre Autonomie betont und ihre Ergebnisse überwiegend nicht mehr danach bewerten lässt, ob sie mit Glaubensannahmen kompatibel sind oder nicht. Das hat unter anderem mit der sich verändernden Funktion der Philosophie zu tun, die sich etwa ab dem 15. Jahrhundert andere Aufgaben stellt, als dies zuvor der Fall war. Vereinfachend gesagt, lassen sich die Philosophien der Antike und des Mittelalters im Sinne von Hadots oben eingeführter Formulierung als Lebensform kennzeichnen, das heißt als kontemplative Haltung, die keine anderen als kontemplative Funktionen oder solche der Regelung des gesellschaftlichen Miteinanders kennt und verfolgt. Die Erkenntnis der Welt, Gottes und der Relation des Menschen zu Gott ist für mittelalterliche Autoren, stark vereinfachend gesagt, ein Weg der kontemplativen Nachschöpfung des göttlichen Werks und damit eine Form des Gottesdienstes, der uns dem Schöpfer näherbringt und damit allenfalls eschatologische Funktionen erfüllt, also der Sicherstellung meines Seelenheils nach meinem Tode dient.
Die antike Philosophie ist hinsichtlich der existentiellen Relevanz ihrer philosophischen Haltung häufig dem Sinnspruch verpflichtet, der über der Eingangspforte zum Orakel von Delphi angebracht war, dem berühmten „Erkenne dich selbst!“ (gnothi seauton), das meist in den Dienst einer philosophischen Selbsterkenntnis gestellt wird. Wenn ich mich durch das Nachdenken über mich selbst, meine spezifischen Eigenarten und meine Rolle in der Welt, besser erkenne, dann kann mich dies von den Entfremdungen entfernen, die ich durch die alltäglichen Geschäfte erfahre, und mich zu dem werden lassen, der ich eigentlich bin. Christliche Philosophien werden dies als Besinnung auf meine Verwiesenheit auf Gott deuten und die reflexive Selbsterkenntnis als Annäherung an ihn: Wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, so argumentiert Thomas von Aquin, dann komme ich, wenn ich zu mir selbst komme, meinem durch Gott erschaffenen eigentlichen Wesen, meiner essentia, näher. In diesem Sinne, so Thomas, kann ich davon sprechen, dass ich, sofern ich die Relation meines eigenen Wesens zu Gott als dessen Schöpfer erkenne, mehr und auf wahrere Weise Mensch bin, als wenn ich mich durch die Ablenkungen des Alltags vom Blick auf mein eigenes, wahres Wesen entferne. Wir werden später kurz zeigen, dass dies ein durchaus platonischer Gedanke ist, den Thomas hier christlich wendet.
Die katholisch orientierte Philosophie, so lässt sich insgesamt konstatieren, weist nicht die Kontinuität auf, die ihr vermutlich aus Homogenisierungsgründen lange zugeschrieben wurde. Das gilt besonders vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Verurteilung von 1277. Die Frage nach einer solchen Kontinuität ist oftmals gleichbedeutend mit der Frage nach der Rezeption aristotelischer Positionen. Die Auseinandersetzung mit dem antiken Großautor findet lange Zeit überwiegend in Form einer spezifischen Kommentar-Literatur statt, und Autoren wie Thomas verfassen Kommentare zu einem Großteil der wichtigen Lehrtexte von Aristoteles. Spätestens im 17. Jahrhundert ist der Umgang mit Aristoteles dahingehend modifiziert, dass an die Stelle der Aristoteleskommentare selbständige Metaphysiklehrbücher treten, die ihr Vorbild bei dem spanischen Jesuiten Francisco Suárez (1548–1617) finden41, wobei inhaltlich für die Auseinandersetzung mit Logik, Naturphilosophie und Ethik im 17. Jahrhundert nach wie vor überwiegend aristotelische Maßgaben bestimmend bleiben.42 Die Lage bei protestantischen Schulphilosophien der Zeit ist wegen des Bruchs der Reformation mit Aristoteles indes eine andere. Zwar „nahm Melanchthon den Stagiriten [= Aristoteles; Vf.] auf und empfahl dessen Studium“43; die offene Wendung der protestantischen Schulphilosophie zum Aristotelismus als einem zentralen philosophischen Lehrgegenstand findet aber, nach der massiven Kritik Luthers an der Orientierung an Aristoteles, erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts statt. Sie geschieht dann jedoch ebenfalls in Form der Etablierung der Metaphysik als Teil des Hochschulunterrichts.44 In dem vor allem an Philipp Melanchthons (1497–1560) Vorgaben45 ausgerichteten protestantischen Kanon universitärer Disziplinen ist zunächst „eine eigene Professur der Metaphysik nicht vorgesehen“46. Bedingt durch die orthodox-lutherische Zurückhaltung gegenüber den ontologischen Aspekten der Metaphysik, werden in lutherisch-protestantischen Philosophien genuin metaphysische Fragestellungen daher auch zunächst der Logik zugerechnet47, bevor der in Helmstedt lehrende Cornelius Martini (1568–1621) mit seinem „Compendium metaphysicum“ das erste protestantische Metaphysiklehrbuch in Druck gibt und damit der Metaphysik wieder einen eigenen Platz in der Hochschulausbildung zuweist.48 Martini nutzt seine Metaphysik nicht zuletzt dazu, die Bedeutung der Philosophie für die Theologie zu dokumentieren, und damit greift er in die Diskussion um das Verhältnis von Glaube und Vernunft ein, die besonders an niederländischen Hochschulen der Zeit großes Interesse hervorruft.49 Denn Martini wendet sich hier gegen die besonders von Daniel Hoffmann (1538–1621) vertretene Strömung, die eine Fokussierung des Schulbetriebs auf theologische Fragen auf Kosten der Philosophie anstrebt. Hoffmann (oder Hofmann) scheint die 1277 diskutierte Theorie von zwei Wahrheiten, einer philosophischen und einer theologischen, wieder aufzugreifen. Er verweigert dabei der Philosophie das Mitspracherecht in theologischen Fragen und rechtfertigt die Vernachlässigung der Philosophie zugunsten der Theologie50. Die Literatur spricht hier von „philosophiefeindlichen Auswüchsen“, die das Klima an protestantischen Hochschulen des späten 16. Jahrhunderts prägen.51 Martini tritt so mit seiner Konzeption nicht nur in Konkurrenz zum aristotelischen Katholizismus der in weiten Teilen Deutschlands und in den katholischen Provinzen der Niederlande einflussreichen Jesuiten52; sondern seine Begründung einer peripatetisch (= aristotelisch) geprägten Schulmetaphysik ist zugleich auch ein Weggang protestantischer Philosophie von der lutherischen Wendung nach innen (wie sie sich beispielsweise in Luthers Rezeption vorreformatorischer Mystiken äußert) zugunsten der Hinwendung zur sachorientierten Ontologie als Schuldisziplin. Diese „neue Etappe der protestantischen Philosophie“ bedeutet, dass „der lutherische Ausschluß der Metaphysik aus der Theologie und der humanistische Ausschluß der Metaphysik aus der Philosophie beendet“ wird53.
Die ebenfalls im 17. Jahrhundert auftretende Philosophie des französischen Privatgelehrten René Descartes (1594–1650) wird hingegen zur allmählichen Trennung philosophischer von theologischen Überlegungen beitragen; denn Descartes (lateinisch Cartesius, daher sprechen wir von seiner Philosophie als dem Cartesianismus) verfolgt ein philosophisches Programm, das im Wesentlichen mit einer drastischen Vereinfachung vor allem der Naturphilosophie zu tun hat. Diese ist, vor Descartes, noch immer stark aristotelisch geprägt, und das bedeutet: Sie ist durchdrungen von aristotelischen metaphysischen Begriffen, allen voran dem der Substanz, welche dazu führen, dass die Beschreibung natürlicher Phänomene hochkomplex und nicht geeignet für technische Anwendungen ist. Ebendiese gehören aber zu Descartes’ Hauptinteresse. Seine methodische Verfahrensweise impliziert den strengen Ausschluss all jener Annahmen und Behauptungen, die nicht mit absoluter Gewissheit bewiesen werden können, was ihn zu einem der frühen Hauptvertreter der europäischen Aufklärung macht. Zugleich bedeutet die Reduktion zulässiger philosophischer Aussagen auf eindeutig bewiesene oder evidente Sätze, dass praktisch sämtliche Themenfelder der Theologie aus dem Bereich zulässiger philosophischer Untersuchungen ausgeschlossen werden müssen. Dieser Vorgang bedeutet aber nicht weniger als die Ausklammerung der Theologie aus dem Zuständigkeitsbereich der natürlichen Rationalität, was besagt, dass dem theologischen Diskurs die Möglichkeit einer rationalen Bestätigung oder Überprüfung vor dem Gerichtshof der Philosophie entzogen wird.
∗
All dies betrifft indes jene Phase des klassischen Philosophierens, das bedeutet insbesondere der vorkantischen Philosophie, die davon ausgeht, die mehr oder weniger adäquate Abbildung einer Wirklichkeit leisten zu können, die, unabhängig von Beobachtung beziehungsweise von den Wahrnehmungs- und Erfahrungsstrukturen ihrer Beobachter, eben so ist, wie wir sie beschreiben. Diese Annahme, die Kant als „dogmatischen Realismus“ klassifizieren wird, also als die apodiktische Behauptung, zutreffende Aussagen über die Realität und Beschaffenheit der Welt selbst formulieren zu können, wird mit dem kantischen Kritizismus zumindest problematisch werden. Dieser Kritizismus lehrt, aus Gründen, auf die wir im weiteren Verlauf eingehen werden, dass es nicht Aufgabe von Philosophie sein kann, die Realität unabhängig von unserer Erfahrung beschreiben zu wollen, sondern dass wir uns darauf beschränken müssen, die Strukturen unserer Erkenntnisvorgänge zu analysieren. Diese Aufgabe ist es, die Kant transzendental nennt: die Untersuchung der Voraussetzungen und Bedingungen von Erkenntnis. Das kantische Programm ist insbesondere für den philosophischen Zugang zur Theologie ausgesprochen wirkungsvoll; denn in der theoretischen Philosophie lehrt Kant, dass es nicht nur unzulässig, sondern schlichtweg unmöglich ist, Aussagen über die Existenz Gottes formulieren zu wollen, während er in der praktischen Philosophie diese Existenz als notwendiges Postulat ansieht, das sich jedoch, eben als apodiktisches Postulat, jeder Beweisfähigkeit entzieht und seine Geltung nur aus pragmatischen Gründen herleiten kann: Wir müssen in der Ethik so tun, als ob es ganz gewiss wäre, dass es Gott gibt, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, Güter und Werte als unveränderlich, überzeitlich und allgemein gültig zu setzen. Ähnlich argumentiert Kant in seiner späten Schrift zur Religionsphilosophie, der „Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft“ aus dem Jahre 1793.
Brüche wie der von Kant verursachte finden in der Philosophie immer wieder statt. Zu den wirkungsvollsten gehört die allgemeine Metaphysik- und Sprachkritik, die beispielsweise von Nietzsche im Zusammenhang einer umfassenden Religionskritik vorgetragen wird. Theologie und ihre basale Annahme der Existenz eines theistischen Gottes werden hier als Sprachmissbrauch gedeutet, der zu einer fehlerhaften Metaphysik führt. Die Konsequenz ist die Forderung einer Sprachhygiene, der sich auch Autoren wie Gottlob Frege (1848–1925) und der junge Ludwig Wittgenstein (1889–1951) anschließen. In Folge der Bemühungen um eine Reinigung der Sprache entstehen Programme zur Entwicklung idealer Sprachen, die jene Scheinprobleme auflösen sollen, die nur durch fehlerhafte Verwendung unserer natürlichen Sprachen entstanden sind. Hierzu gehören vor allem metaphysische Sätze sowie Sätze der Theologie. Die Haltung, Philosophie als Instrument der Analyse unserer Sprache beziehungsweise ihrer Verwendungsweise zu betrachten, ist die Gründungsidee der sogenannten Analytischen Philosophie, die bis heute ausgesprochen wirkungsvoll ist. Sie ist, zunächst und in ihrem Kern, theologiekritisch. Diese Haltung gipfelt in den Überzeugungen des sogenannten Wiener Kreises, einer philosophischen Schule im Wien der 1920er und frühen 1930er Jahre, zu deren prominentesten Mitgliedern Rudolf Carnap (1891–1970) gehört. Er lehrt, wie viele seiner Kollegen, dass metaphysische Sätze sinnlos sind, weil sie sich nicht überprüfen lassen. Hierzu gehören selbstverständlich auch für ihn an vorderster Front Sätze der Theologie. In jüngster Zeit gibt es allerdings Bemühungen, theologische Ansätze mit denen des Analytischen Philosophierens zu harmonisieren54, die allerdings das zentrale philosophische Problem der Theologie, die Frage nach der Begründbarkeit der Existenzannahme des theistischen Gottes, nicht lösen können.