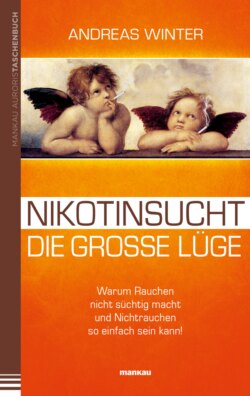Читать книгу Nikotinsucht - die große Lüge - Andreas Winter - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von der Macht der Symbole
ОглавлениеWas verstehen wir überhaupt unter einem Symbol? Das Wort leitet sich vom griechischen „symballein“ ab und bedeutet „zusammenwerfen“.
Ein Symbol besteht aus mindestens zwei Informationen, die in einen gemeinsamen Zusammenhang gebracht (verknüpft) wurden und mit ihrer Bedeutung aufeinander verweisen. Je nach Anwendungsgebiet steht die eine Bedeutung dabei stellvertretend für die andere und löst entsprechende Reaktionen aus. Meist erhalten Symbole aber einen Bedeutungsüberschuss, der auf tiefer liegende oder verborgene Zusammenhänge hindeutet.
Interessanterweise gibt es in unserer modernen Welt der Industrienationen ein Vielfaches mehr an Symbolen als in der Welt etwa der vorchristlichen Kelten, der nordamerikanischen Indianer oder der ostafrikanischen Massai zusammen. Jede rote Ampel, jedes Läuten einer Schulklingel und jedes Glas Champagner ist ein Symbol (rote Ampel = Anhalten, Schulglocke = Pause, Champagner = Reichtum). Eine Zigarette verweist symbolisch, ich sagte es bereits, auf Mündigkeit.
Halten wir fest: Symbolik bedeutet, wir haben das Original mit etwas Zusätzlichem verknüpft, „zusammengeworfen“, sodass das Gefühl oder Verhalten eines Menschen oft nicht aus dem resultiert, womit er sich gerade bewusst beschäftigt, sondern daraus, was unterbewusst damit verknüpft ist.
Oder glauben Sie etwa, dass ein Raucher raucht, weil er gerne Gift einatmet, dessen Wirkung er ja noch nicht einmal bemerkt? Ich werde Ihnen später noch genauer erläutern, dass Sie die Gifte noch nicht einmal spüren.
Eine Ansichtskarte vom letzten Urlaubsort kann beispielsweise ein solches Symbol sein. Wir sehen uns die Karte an und erinnern uns an die paradiesische Ruhe oder den Spaß, den wir dort hatten, und erzeugen dadurch mehr oder minder das gleiche Gefühl, welches wir an dem Ort im Urlaub verspürten.
Ein weiteres Symbol ist die Swastika, besser bekannt als das Hakenkreuz. Für viele fernöstliche oder indische Kulturen ist es ein uraltes Symbol für Heilung und Gesundheit. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie kämen nach Hause und fänden an Ihrer Wohnungstür ein mit Kreide aufgemaltes Hakenkreuz – Sie würden sich wahrscheinlich unangenehm berührt fühlen. Dabei sind es doch nur ein paar abwaschbare Striche, oder?
Falsch, ein Kreuz ist eben mehr als nur seine Striche. Es bedeutet etwas, das nichts mit seiner Daseinsform an sich zu tun hat – aber eben nur für die Menschen, die diese Zusatzinformationen auch damit verknüpft haben. Ein Symbol entfaltet seine Wirkung mittels seiner Bedeutung. So wollte vielleicht nur Ihr indischer Nachbar mit dem Kreidesymbol Ihr Heim segnen und beschützen, derweil Ihnen angesichts der mutmaßlichen Schmierereien irgendwelcher Nazi-Glatzen vor Wut fast der Kragen platzt, hingegen ein Erstklässler Ihnen wiederum erklären würde, dass „das Fenster“ an der Tür nicht ordentlich gemalt ist.
Es gibt unzählige Symbole in unserem Alltag: Eine Armbanduhr kann ein Statussymbol sein, die Farbe des Lichts an einer Ampel ist für einen Verkehrsteilnehmer mehr als nur bunte Beleuchtung – sie fordert ihn zum Anhalten oder zum Weiterfahren auf. Auch das Trinken von Champagner ist ein Symbol: Er dient nicht allein zum Durstlöschen oder Betrinken, sondern kann zusätzlich einen hohen Vermögensstatus sowie eine gewisse Kultiviertheit symbolisieren (was ja nicht unbedingt der Realität entsprechen muss – auch Rüpel und Schnorrer können sich Champagner besorgen und trinken, um an dessen symbolischer Wirkung teilzuhaben).
Wie ein Symbol überhaupt zustande kommt, ist übrigens seit fast 100 Jahren erforscht – und Ihr Arzt hat es sogar studiert; Reiz-Reaktionsverknüpfungen sind Basiswissen in der allgemeinen Psychologie und sind damit ein Bestandteil der medizinischen Ausbildung.
1920: Ein Hund liefert den Hinweis
Das zwanghafte Verlangen nach einer Zigarette ist die Folge einer autogenen (selbsterzeugten) multifaktoriellen Konditionierung. Eine Konditionierung ist eine Informationsverknüpfung, also ein Symbolkomplex, der nicht bewusst ist. Laut Definition kann einem natürlichen, meist angeborenen Reflex künstlich ein neuer, bedingter Reflex hinzugefügt werden.
Vielleicht kennen Sie die Geschichte mit dem so genannten Pawlow’schen Hund? Der russische Forscher und Nobelpreisträger Iwan Pawlow (1849 – 1936) stellte bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts fest, dass immer wenn er seine Laborhunde füttern wollte, die Tiere ganz freudig erregt auf und ab sprangen und sich auf das Futter freuten, noch bevor er die Näpfe gefüllt hatte. Klar, jeder Hundebesitzer weiß, dass das Dosenöffnergeräusch das Lieblingslied eines jeden Hundes ist. Doch Iwan Pawlow untersuchte diese Beobachtung einmal wissenschaftlich und schlug, kurz bevor er den Tieren etwas zu fressen gab, – „ping!“ – ein kleines Glöckchen an. Dies setzte er drei Wochen lang täglich fort und kontrollierte dabei, wie die körperliche Reaktion der Hunde auf das Glöckchen ausfiel. Dazu maß er in einem kleinen Röhrchen den Speichelfluss des Tieres, eine Reaktion auf das zu erwartende Futter. Anfangs reagierten die Hunde auf den Ton nicht mit Speichelfluss. Mit dem Glockenton wurde noch nichts Weiteres verknüpft. Doch nach bereits drei Wochen ließ sich beobachten, dass die Hunde schon allein auf den Glockenton mit Speichelfluss reagierten. Der Körper des Hundes zeigte eine Reaktion. Pawlow hatte nur das Glöckchen angeschlagen und gar kein Futter ausgeteilt, und trotzdem bekamen die Hunde Speichelfluss – eine Verknüpfung zwischen Glöckchen und Futter hatte stattgefunden. Den Tieren lief das Wasser im Mund zusammen, weil sie erwarteten, es gäbe gleich etwas zu fressen. Bemerkenswert dabei ist, dass Speichelfluss eine Reaktion des vegetativen Nervensystems ist, die weder ein Hund noch ein Mensch mit noch so viel Willenskraft erzeugen kann – sie wird durch ein unterbewusstes Gefühl hervorgerufen.
Die Wissenschaft nennt dies eine bedingte (konditionierte) Reaktion. Mit anderen Worten: Ein Verhalten wurde durch den zweiten Reiz einer nicht kausal begründeten Wenndann-Beziehung ausgelöst.
Für die Hunde wurde durch das stetige Zusammentreffen zweier Reize (Futter und Glockenton) ein Symbol erzeugt! Nicht wegen des Tons, sondern aufgrund der damit verknüpften Erwartung des Futters reagierten sie mit Speichelfluss.
Und ähnlich sind wir Menschen auch. Da wir bekanntlich über eine höhere Intelligenz als Hunde verfügen, sind wir noch wesentlich verknüpfungsfähiger, sodass wir die entferntesten Dinge in langen Assoziationsketten miteinander verbinden können.
Wir brauchen nur eine Information (Zigarette) so lange mit einer anderen Information (Erleichterung) in Beziehung zu setzen, bis wir nach einer Weile (unbewusst) keinen Unterschied mehr in der Bedeutung (Wirkung) machen. Die Hersteller wissen, Rauchen gilt als ein Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung. Je öfter in Werbebotschaften Freiheit, Reichtum, Freizeit, Spaß und intellektuelle Überlegenheit in Zusammenhang mit Zigaretten kommuniziert wird, desto wirksamer ist das Symbol. Seit Anfang des letzten Jahrhunderts weiß man also, dass ein Symbol eine körperliche Reaktion auslösen kann – doch Ihr Arzt glaubt, es wäre das Nikotin, weshalb Sie rauchten.
Warum so viel werben, wenn angeblich eine Sucht vorliegt?
Dies erklärt, warum die deutsche Tabakindustrie jährlich weit über 300 Millionen Euro für Werbung ausgibt (das sind etwa 10 Prozent der gesamten Werbeausgaben in Deutschland!). Man muss so viel werben, damit der Raucher überhaupt weiß, was er fühlen soll, wenn er dieses Gift einatmet. Ohne diese Information würde ein gewohnheitsmäßiger Raucher bald nichts mehr von der Wirkung einer Zigarette spüren (genau wie ein Passivraucher). Die in der Werbung dargestellten Gefühle haben hier die Funktion des Futters, die Zigarette entspricht dem Glockenton und wann immer ein konditionierter Mensch raucht, fühlt er sich so, wie es ihm die Werbung vorgemacht hat. Durch emotionales Marketing wird das Symbol Zigarette aufgeladen und verstärkt. Übrigens: Auch hier zeigt sich deutlich, dass es nicht das Nikotin ist, das süchtig macht, denn dann brauchten Kettenraucher mit einem Konsum von 100 Zigaretten täglich ja einfach nur auf Pfeife oder Zigarre umzusteigen. Rein rechnerisch nähme er dann mindestens genauso viel Nikotin täglich zu sich, sparte aber ein bisschen Zeit. Machen Sie einem Kettenraucher mal diesen Vorschlag. Ich wette, er wird dankend ablehnen – es geht ihm nämlich gar nicht um eine Dosis Nikotin, sondern um etwas ganz anderes – das Gefühl von Entscheidungsfreiheit!
Schauen wir uns doch mal einige bekannte Werbebotschaften an: „Gut gelaunt genießen“ lautet zum Beispiel ein Slogan, der in den Siebzigern verwendet wurde. Haben Sie von der guten Laune und dem Genuss etwas gespürt, als Sie den ersten Zug an einer Zigarette in Ihrem Leben gemacht haben? Nein, Ihnen wurde vielleicht etwas schlecht, aber Sie warteten vergeblich auf die tolle Wirkung, die Sie bei Erwachsenen beobachtet haben.
Der „Geschmack von Freiheit und Abenteuer“ ist ebenfalls eine Werbeaussage. Eine, die vor Zynismus strotzt, denn Ihre erste Zigarette war wahrscheinlich begleitet von dem Gefühl, etwas Neues, Gefährliches, gar Verbotenes zu tun (Abenteuer), und indem Sie es getan haben, versuchten Sie sich Ihre Mündigkeit zu beweisen (Freiheit). Heutzutage fühlen Sie sich nur noch frei, wenn Sie Zigaretten haben. Ist die Schachtel leer, kriegen Sie die Krise und laufen „meilenweit“ zum Kiosk. Das, was Sie heute noch spüren, ist totale Abhängigkeit ohne und Freiheit mit Zigaretten. „Liberté Toujours“
(Freiheit, Gelassenheit jederzeit) tönt in dasselbe Horn und „der Duft der großen weiten Welt“ spekuliert ebenfalls darauf, dass Sie von Ihrem Elternhaus die „Nase voll“ haben und davon träumen, nicht bevormundet zu werden.
All diese Werbebotschaften grenzen an unlauteren Wettbewerb, denn diese Gefühle werden nicht von dem Tabakprodukt erzeugt, sondern von Ihnen selbst.
Eine solche Konditionierung kann natürlich auch wieder aufgelöst und damit steuerbar gemacht werden. Bisher ging die klassische Psychologie zwar davon aus, dass dies ein langwieriger Prozess von ungesichertem Ausgang sei, aber zum Glück sind wir in diesem Jahrhundert schon einen Schritt weiter:
Eine Dekonditionierung (Auflösung einer Symbolverknüpfung) geschieht durch Reflexion (Bewusstmachung) der verknüpften Elemente und ihrer Verbindung. Dies ist so einfach, dass sogar scheinbar hartnäckige Phobien und Zwänge damit innerhalb von wenigen Sekunden der Erkenntnis vollständig aufgelöst werden können.
Nachdem ein Raucher die Hintergründe seines Rauchverhaltens vollständig reflektiert hat, ist dieses nicht länger unterbewusst – er wird es wieder bewusst steuern können, wie damals, zur Zeit des ersten Zuges an einer Zigarette.
Wenn Sie dieses Buch verstanden haben, werden Sie sich also, wenn Sie künftig rauchen wollen, hierzu ganz bewusst entscheiden müssen. Wenn Sie diese Entscheidung bereits zu Beginn dieses Buches negativ gefällt haben („Ich will nicht mehr rauchen“), werden Sie vermutlich auch künftig nicht mehr rauchen. Allerdings sollten Sie einen wirklich wichtigen emotionalen Grund dafür haben, da Sie die Entscheidungsfreiheit über das Rauchen zurückbekommen. Sollten Sie zu den Menschen gehören, die nicht gelernt haben, mit Freiheit umzugehen, werden Sie auch nach dem Buch noch mehr rauchen, als Sie wollen, nur um sich selbst zu beweisen, dass ein Buch Sie nicht verändern kann. Mehr darüber lesen Sie im Kapitel über „Trotz“.
Einen Rückfall in das gewohnte Rauchverhalten aufgrund eines Bedürfnisses nach Tabak können sie ausschließen, wenn Sie alles Folgende nachvollziehen können und keine Fragen offen bleiben.
Die persönliche Entscheidungsfreiheit zum Rauchen bleibt gewahrt!
Ja, Sie haben richtig gelesen: Sie können sogar heute noch ohne Probleme aufhören zu rauchen und werden noch nicht einmal rückfällig, selbst wenn Sie auf einer Party mal wieder eine Zigarette mitrauchen.
Ebenso können Sie sofort und ab heute aufs Naschen verzichten, sich obendrein pudelwohl fühlen – und nebenbei natürlich mühelos abnehmen. Ich habe erlebt, dass Menschen bis zu vier Kilo pro Woche verloren, nachdem sie die Ursache ihres übermäßigen Essens erkannt hatten. Ohne Diät, wohlgemerkt. Warum man zu- und wie man wieder abnimmt, habe ich in mehreren Büchern zum Thema Übergewicht beschrieben.
Doch bleiben wir bei unserem Thema: Sie möchten ja schließlich aufhören zu rauchen.