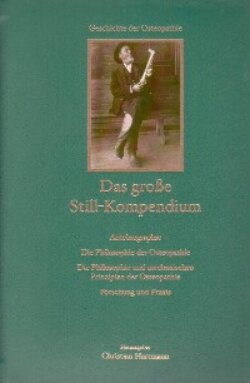Читать книгу Das große Still-Kompendium - Andrew Taylor Still - Страница 17
3. DER EINFLUSS HERBERT SPENCERS, DER MECHANISMUS BEI STILL UND DIE OFFENEN FRAGEN DES MASCHINENMODELLS STILLS
ОглавлениеTexte sind wissenschaftlich-philosophisch gemeint. Daran besteht kein Zweifel. Es fällt freilich ins Auge, dass sie stark metaphorisch und bilderreich geprägt sind. Es scheint nahe liegend, wichtige Metaphernfelder mit biografischen Phasen und Erfahrungen des Autors in Verbindung zu bringen. Dazu gehört natürlich die Erziehung im strengen methodistischen Kontext, die Stills metaphorische Sprache stark geprägt hat. Darauf gehen auch die Archaismen aus der King James-Version der Bibel zurück, die sich in Stills Texten finden. Stills Sprache zehrt auch von den Entbehrungen des Lebens in der Pionierzeit der American Frontier, auch den Schönheiten dieses Lebens, darunter den Erfahrungen mit den Shawnee-Indianern. Dabei entsteht seine Liebe zum ‚Buch der Natur‘. Den dritten Kontext bildet Stills Teilnahme am Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Viertens verarbeitet Still in seiner Sprache medizinisch-philosophisch die technische Revolution im Gefolge der Industrialisierung. Dies erscheint durch einen fünften Kontext metaphorisch eigentümlich gebrochen: die Beschäftigung mit der freimaurerischen Weltsicht und ihren Ritualen. In diesem Unterpunkt gehe ich nur auf die beiden letzten Aspekte ein, weil sie einen wesentlichen Zugang zu Stills Sprechen eröffnen.
Es gilt wohl weithin als Konsens, dass man Stills Texte dann besser verstehe, wenn man sie vor dem Hintergrund des britischen Philosophen Herbert Spencer lese. So entschied sich auch der Verlag JOLANDOS eine Übersetzung der First Principles zu verlegen23, hatte doch Wilborn Deason behauptet, dass es sich bei diesem Buch um „[…] one of his [sc. Stills] most treasured volumes“ 24 gehandelt habe. Als Beleg bezieht er sich auf einen Besuch bei Still im Jahr 1910. Dazu habe ihm Stills Sohn Charles kurz vor der Niederschrift von Deasons Artikel im Jahr 1934 ein Exemplar der First Principles gezeigt, das Andrew Taylor Still besessen habe. Insgesamt schildert Deason Still als einen an Philosophie sehr interessierten Menschen, der sich auf europäische Biologen und einige Ärzte, vor allem Rudolf Virchow bezogen habe. Zu letzterem führt Deason an, dass er Still besucht habe, während dieser die Cellularpathologie las.25 Darüber habe er mit ihm gesprochen, wobei Still die Position Virchows so zusammengefasst habe, „[…] that disease arises in Darwin’s protoplasm.“ 26 Insgesamt erscheint der Bericht recht glaubhaft, vielleicht ein wenig übertrieben die Genialität des Meisters Still betonend. Man erkennt die Glaubwürdigkeit leicht daran, dass die Formulierung Darwin’s protoplasm, die damals recht geläufig war, dreimal explizit in Stills Schriften auftaucht.27 Allein aus dieser Beobachtung folgt eine gewisse Plausibilität von Deasons Bericht. Ein äußeres Indiz für die Wahrscheinlichkeit des Berichtes liegt darin, dass Charles Still erst 1955 starb, also beim Erscheinen dieses Artikels und auch der späteren Erweiterung des Artikels in 1946 noch lebte und keinen Protest gegen Deasons Behauptung erhob.28 Weiterhin erscheint als der angebliche Vermittler europäischer ‚Biologie‘ an Still – wie Deason behauptet – ein schottischer Dr. Neil in Stills Autobiografie auf.29
Man könnte selbstverständlich prinzipiell Zweifel an diesem Bericht haben, zumal in den erhaltenen Bibliotheksverzeichnissen Stills das Buch nicht auftaucht. Doch erscheinen zumindest für elementare Text-zu-Text-Vergleiche auch zunächst vielleicht überraschende Behauptungen wie der Bezug zur Virchowschen Cellularpathologie plausibel. Deason zufolge handelt es sich hierbei gar nicht so sehr um das Thema der Zellen an sich, sondern um die Frage der Entstehung von (entzündlichen) Krankheiten, in Virchows Sprache um ‚pathologische Neubildungen‘.30 Dies wird mit dem Prozess der ‚embryonalen Entwicklung‘ 31 für vergleichbar gehalten: „Diese Form [sc. im Innern der Blase] scheint darauf hinzuweisen, dass in der That durch einen nicht direct auf Theilung praeexistirender Zellen zu beziehende Vorgang und zwar in besonderen blasigen Räumen, die ich Bruträume genannt habe, im Innern von zelligen Elementen neue Elemente ähnlicher Art sich entwickeln können.“ 32 Stills Auffassung der Fermentation sieht durchaus nicht ganz unähnlich aus, sie muss nicht auf der Lektüre der 1860 erschienenen englischsprachigen Ausgabe von Virchows Cellularpathologie beruhen, könnte dies aber doch. Hier muss zur weiteren Aufklärung ein exakter Text-zu-Text-Vergleich geleistet werden, der das Problem der Entstehung von Krankheit und weitere verwandte Themen wie ‚Keim‘ bzw. germ und protoplasm behandeln müsste. Vielleicht kommt man dann auch zu einem recht abgesicherten und befriedigenden Ergebnis. Hier könnten sich kulturwissenschaftliche und medizinische Kompetenz einmal fördernd befruchten, ohne dass es zu ‚pathologischen Neubildungen‘ kommen müsste.
In der Folge werde ich für das Problem der möglichen Spencerrezeption Stills knappe Hinweise geben, die auf einem ausgearbeiteteren Text-zu-Text-Vergleich beruhen. Selbst wenn Still Spencers First Principles niemals gelesen hätte, wäre im Übrigen die verlegerische Entscheidung zur Übersetzung dieses Buches keineswegs sinnlos gewesen, denn es handelt sich um ein gutes Buch, das den Zeitgeist, in dem Still jedenfalls auch gelebt hat, sehr gut erkennen lässt. Das erscheint umso plausibler, weil Spencers Werke zu den damals meistgelesenen Büchern gerade bei Transzendentalisten gehörten.33
Wer sich mit Stills Gedankengang zum ungestörten Normalzustand vertraut gemacht hat, der bei Störung durch Fehlstellung des Skeletts usf. zu Variationen gezwungen wird, die dann durch die Begünstigung der Selbstheilungskräfte wieder angepasst werden können, wird auf folgenden Text Spencers gestoßen:
„Wenn die Abweichung vom normalen Verlauf der Funktionen so groß ist, dass sie gestört werden – wenn etwa gewaltsame Anstrengung Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit hervorruft –, entsteht schließlich doch ein Gleichgewicht. Vorausgesetzt die Störung zerstört nicht das Leben (wodurch das vollständige Gleichgewicht plötzlich hergestellt wird), baut sich die normale Balance nach und nach wieder auf. Der wiederkehrende Appetit ist stark im Verhältnis zu der Größe der Verschwendung. Ausgedehnter und gesunder Schlaf entschädigt für die frühere Schlaflosigkeit. Nicht einmal ein extremer Exzess, der eine Störung hervorgebracht hat, die nicht gänzlich korrigiert werden kann, stellt eine Ausnahme von diesem allgemeinen Gesetz dar. Denn in solchen Fällen entsteht nach einer Zeit ein neuer mittlerer Zustand, der in der Folge zum Normalzustand des Individuums wird. Und dieser Prozess exemplifiziert im Kern die von den Ärzten so genannte vis medicatrix naturae.“ 34
Wichtig für das Verständnis der Texte Stills ist hier der Gedanke unterschiedlicher Gleichgewichtszustände. Auch die Variation als Störung bildet erneut einen Gleichgewichtszustand aus, länger bestehende Störungen tendieren zum Aufbau eines neuen Normalzustandes auf dem Niveau des durch Störung erzeugten Gleichgewichtszustandes – ein auch später in der Osteopathie verwendetes Modell um Krankheiten zu beschreiben.35 Dabei spielt das von Spencer betonte Prinzip des geringsten Widerstandes eine große Rolle wie sich eine Störung genau entwickelt.
Man wird also sagen können, dass Stills Sprechen vom Normalzustand, von Störungen, von den Selbstheilungskräften zumindest eine starke Parallele in bestimmten Aspekten von Spencers Sprechen hat. Still und Spencer teilen dabei eine prozessuale Auffassung des Körpers, der mithin kein statischer Zustand ist, sondern zwischen unterschiedlichen Gleichgewichtszuständen dynamisch schwankt. Noch entscheidender sind für einen Text-zu-Text-Vergleich freilich auffällige sprachliche Phänomene, die nicht zuletzt metaphorischer Art sind.
Hierzu ist es wichtig, sich die englischen Texte genauer anzusehen. Still spricht häufig von demand and supply. Dabei handelt es sich um Metaphern aus dem ökonomischen, marktwirtschaftlichen Bereich, die Still auf Körpervorgänge überträgt – weshalb er nicht selten auch metaphorisch von ‚Ökonomie des Lebens‘ spricht:
„Where and how is the supply made and delivered to proper places? How is it applied and what holds it to its place when adjusted? What makes it build the house of life? Do demand and supply govern the work?“ 36
Hierzu gibt es einen ins Auge fallenden parallelen Text Spencers aus den First Principles:
„The internal actions constituting social functions, exemplify the general principle no less clearly. Supply and demand are continually being adjusted throughout all industrial processes […]“ 37
Es ist unübersehbar, dass Still marktwirtschaftliche Termini metaphorisch für körperliche Vorgänge verwendet. Diesem Sachverhalt wird in der vorliegenden Übersetzung Rechnung getragen (konkret: Nachfrage und Angebot). Auch adjust wird entsprechend als evolutionär-prozessual gemeintes Wort erfasst, sodass mit ‚anpassen‘ übersetzt wird, aber ‚korrigieren‘ ständig mitgedacht werden kann. Dass dies völlig berechtigt ist, zeigt ein weiteres Zitat Spencers, in dem Spencer selbst einen marktwirtschaftlichen Zentralbegriff auf körperliche Vorgänge bezieht:
„This unusual transformation of molecular motion into sensible motion is presently followed by an unusual absorption of food – the source of molecular motion; and the prolonged draft on the spare capital in the tissues, is followed by a prolonged drest, during which the abstracted capital is replaced.“ 38
Die Metaphorik Spencers und Stills sind daher sehr ähnlich. Sie entstammen einer kulturellen Situation und interpretieren die Wahrnehmung von unterschiedlichen Prozessen mit komplexen – Differenzen bzw. Unterschiede in der einen Wirklichkeit übergreifenden – Gleichgewichtsmodellen. Nach meinem Eindruck ist es sehr wahrscheinlich, dass Stills Sprache durch Spencer angeregt worden ist. Um Still zu verstehen, bedarf es dieser Annahme aber nicht. Es ist auch möglich, dass Still in einem ähnlichen kulturellen Horizont zu einer nahezu gleichen Metaphorik gelangt ist. An der sachlichen Parallele und den inhaltlichen Fragen, die sie aufwirft, ändert sich dabei nichts.
Eine in der Zukunft zu diskutierende Frage wird lauten: Wie ist Stills Sprechen zu verstehen, wenn es so eindeutige Parallelen zu einem mechanistischen evolutionären Entwurf wie dem von Spencer aufweist? Wie ist dieser selbst zu verstehen? Was bedeutet dies für die Interpretation der von Still gemeinten osteopathischen Praxis? Ist diese Handwerk, eine Technik? Oder ist sie eine Heilkunst – wie sich die antike Medizin verstand?39 Dann würde das auf der Basis von Wahrnehmung induktiv erschlossene osteopathische Regelwissen in jedem Fall neu überprüft werden müssen, weil die Alten unter Kunstlehren praktische Wissenschaften verstanden, die ein Regelwissen vermitteln, das im einzelnen Fall aber gegebenenfalls korrigiert werden muss, da die individuelle Wirklichkeit immer komplexer sein kann als man bislang in allgemeinen Regeln erfasst hat. Still hat aus seiner Sicht des ‚Buches der Natur‘ diesen Sachverhalt des unableitbar Einzelnen recht genau gesehen:
„Ich habe lange Mineralogie studiert und gelernt, dass jeder Stein oder jedes Metall sich in einem eigenen Zustand befand, kein anderer Stein konnte in seinem Gewand auftreten, das galt für das schwarze Silur genauso wie für den transparenten Kristall. Ein Diamant konnte kein Rubin sein, noch weniger konnte er eine Eiche, eine Gans oder eine Ziege sein.“ (Die Philosophie der Osteopathie)
Hier stellt also die einzelne Osteopathin und der einzelne Osteopath das bisherige induktiv erschlossene Wissen wieder neu in Gegenwart des Patienten infrage und überprüft es. Das geht nur abduktiv, hypothetisch, ratend, wenn man auf bisher nicht Beobachtetes, vielleicht auf neue und überraschende Zusammenhänge stößt. Man muss versuchen, bestätigen usf. Eben deshalb reicht es nicht Osteopathie unter rein quantitativen Wissenschaftsmustern zu betreiben. Der Einzelfall stellt jedenfalls oft vor die qualitative Frage: Wie gehe ich mit dem Einzelfall um, wenn also nicht nur die Gesteinsarten unverwechselbar, sondern auch jeder Stein derselben Art gleich seinen und zugleich ganz verschieden von seinen Artgenossen ist? Still meint es m. E. tatsächlich so, dass jeder Einzelfall prinzipiell meine bisherigen Muster infrage stellt. Und darauf kann ich nur qualitativ-abduktiv reagieren, muss dies aber kritisch-selbstkritisch überprüfen.
Aus der Sicht eines osteopathischen Außenseiters sind dies die Hauptfragen, die sich an das Spencerproblem knüpfen und die damit verbundene mechanistische Sprache von Still: der Mensch als Maschine, Osteopath/inn/en als Ingenieure, Maschinisten usf. Es wird spannend sein, wie die Osteopath/inn/en auf dieses Problem reagieren.
Nach meinem Eindruck war sich Still der Problematik seines mechanistischen Sprechens wahrscheinlich bewusst. Daher wählte er für die Abschlussproblematik seiner Theorie (woher kommt das alles, wie ist es entstanden, wie bleibt es relativ stabil?) keine begrifflich-schlüssige Form, sondern eine Metaphorik, die aus seiner Beschäftigung mit dem Freimaurertum stammt. So gilt ihm Gott als der ‚Große Architekt‘, der ‚Große Vermesser‘, der das ‚Haus des Lebens‘, den ‚Aufbau‘ (superstructure) den menschlichen Körper planvoll, irrtumsfrei und vollkommen erbaut hat und über die von ihm verantworteten Naturgesetze (die ‚Pläne‘ und ‚Bauanleitungen‘) auch gegenwärtig indirekt reguliert, darunter den Gesetzen des Heilens, die Still entdeckt hatte. Es geht in dieser Metaphorik um die Betonung des intellektuellen Elementes, an dem der menschliche Verstand (der mind) Still zufolge Teil hat. In Begriffen der europäischen und nordamerikanischen Religionsgeschichte ist diese Position Stills als deistisch einzustufen. Anders als andere Deisten aber wählt er nicht die Uhrmachermetaphorik (Gott als Uhrmacher, die Welt als perfektes Uhrwerk), sondern betont den intellektuellen Charakter Gottes durch die entsprechende Freimaurermetaphorik. Hierbei ist es m. E. wichtig, den Charakter als Metapher streng zu nehmen. Metaphern bezeichnen etwas als zugleich ähnlich und unähnlich. Sie übertragen etwas aus einem bestimmten gesellschaftlich-sprachlichen Bereich auf einen anderen, der vielleicht ähnlich, in jedem Fall aber auch genauso unähnlich ist. Auf diese Weise scheint sich Still von Spencers Lösungsversuch unterscheiden zu wollen. Spencer war im angelsächsischen Kontext m. W. der erste, der Abschlusstheorien überhaupt für logisch unmöglich hielt. Gleichwohl bleibt in unserem Bewusstsein ein derartiges Element enthalten, das wir aber über unsere Erfahrung und unsere Wissenschaft nicht einholen können. Daher hielt Spencer an der Abschlussfigur fest, erklärte aber ausdrücklich, dass man die letzten Fragen der Wirklichkeit nicht begrifflich-logisch oder durch Erfahrungserkenntnis erfassen könne. Mithin nannte er die letzte Wirklichkeit, auf der unsere Erfahrungswirklichkeit beruht, the unknowable – das Unerkennbare, nicht Wissbare.
Darauf findet sich mutmaßlich auch bei Still eine Reaktion:
When I looked up the subject and tried to acquaint myself with the works of God, or the unknowable as some call Him, Jehovah as another class say, or as the Shawnee Indian calls Him, the great Illnoywa Tapamala-qua, which signifies the life and mind of the living God, I wanted some part that my mind could comprehend. I began to study what part I should take up first to investigate the truths of nature, and place them down as scientific facts. 40
Dies ist ein typisch deistischer Text. Der Autor steht über den einzelnen Religionen und akzeptiert an ihnen nur das Schöpfungskonzept – worin sie übereinzustimmen scheinen.41 Unter den Gottesbezeichnungen findet sich auch Spencers ‚Unerkennbares‘. Es wird von unbestimmt Mehreren gebraucht, was rhetorisch möglicherweise die Position Spencers relativieren soll. Still mag aber auch gewusst haben, dass Spencers Bezeichnung der letzten Wirklichkeit im abendländischen Kontext nicht selten war. Entscheidend ist nun, dass er diese Position in der Folge auch inhaltlich, in der Sache zu teilen scheint:
Where will I begin? That is the question. What will I take? How is the best way? I found that one of my hands was enough for me all the days of my life. Take the hand of a man, the heart, the lung, or the whole combination, and it runs to the unknowable. I wanted to be one of the Knowables. 42
Die angesprochenen menschlichen Sachverhalte sollen zu den erkennbaren, dem Wissen zugänglichen Problemen gehören. Sie entstehen und bestehen aber vor einem unerkennbaren Hintergrund. Diesen drückt Still dann nicht nur negativ wie Spencer, sondern positiv mit einer freimaurerischen Metaphorik aus. Wird diese nicht schlicht vergegenständlicht, dann respektiert Still die Annahme Spencers, dass Abschlusstheorien logisch unmöglich sind. Gleichwohl muss man aus medizinisch-philosophischen Gründen von der schöpferischen Wirklichkeit sprechen. Denn diese garantiert die evolutionär gewordenen Selbstheilungskräfte und begrenzt auf diese Weise die Macht von Behandlern und Patienten. Still geht in gewisser Weise etwas weiter als Spencer, insofern seine Metaphorik zumindest offen lässt, dass Gott so oder ähnlich gehandelt hat, während Spencer dies strikt ausschließt.43 Eine Metaphorik schwebt stets ein wenig, sie lässt mehrere Möglichkeiten offen. Gleichwohl hat Still nach meinem Eindruck nicht vertreten, dass dem menschlichen Verstand alles ganz genau erschlossen sei, obgleich er am göttlichen Verstand Teil hat.44 Und dies spricht eher dafür, dass sein Mechanismus gebrochen ist – mindestens so stark wie dies bei Spencer der Fall ist. Insgesamt ist zu betonen, dass Still das Verhältnis Gottes zur Welt als Liebe versteht, genauso wie das ideale Verhältnis der Menschen untereinander. Hier folgt er z. B. biblischer Sprache, aber auch den zeitgenössischen Swedenborgianern. Dann aber ist das Verhältnis Gottes zur Welt und zum Menschen nicht ausschließlich mechanistisch-kausal aufzufassen, sondern ein grundlegend sittliches Verhältnis. Auch in diesem ganz wichtigen Punkt überschreitet Still den Mechanismus der Industriekultur und folgt hierin insbesondere den romantischen, transzendentalistischen Impulsen. Dies muss beachtet werden, wenn man die Maschinenauffassung des Menschen in der Folge kritisch diskutiert.