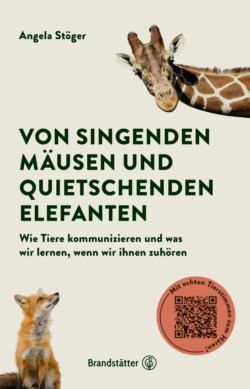Читать книгу Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten - Angela Stöger - Страница 7
Wir bemerken zuerst die „Laut-Auffälligen“
ОглавлениеEs mag überraschen, aber von vielen Tieren, selbst von sonst gut erforschten Vögel- und Säugetierarten, kennen wir noch nicht einmal das gesamte Lautrepertoire. Der Fokus der Forschung lag bisher auf jenen Arten, die leicht zugänglich waren – oder besonders auffällig. Oft beschränkt sich unser Wissen auch nur auf eine Art einer ganzen Tierfamilie oder Ordnung. Manchmal wissen wir nur über einen speziellen Lauttyp einer Tierart genauer Bescheid.
Die Erforschung des akustischen Verhaltens von Elefanten etwa läuft seit vierzig Jahren, allerdings mit einem sehr starken Fokus auf den Afrikanischen Savannenelefanten. Der Großteil der Forschung beschäftigt sich mit ihren tieffrequenten Lauten, den „Rumbles“, mit denen die Tiere in ihren weitläufigen Lebensräumen miteinander in Kontakt bleiben. Über die Laute der Afrikanischen Waldelefanten und der Asiatischen Elefanten hingegen wissen wir noch sehr wenig. Das hat einen einfachen Grund: Elefanten sind zwar aufgrund ihrer Größe und ihrer Lebensweise prinzipiell eine eher schwierig zu erforschende Tierart, aber Savannenelefanten sind dabei einfacher zu beobachten als ihre Artgenossen, die in einem dichten, unzugänglichen Regenwald im Kongo oder in Indien leben. Wie Asiatische Elefanten ihre besonders hochfrequenten Quietschlaute produzieren, die eher an ein Meerschweinchen als an einen vier Tonnen schweren Dickhäuter erinnern, konnten mein Team und ich tatsächlich erst vor Kurzem herausfinden, dazu mehr im nächsten Kapitel.
Die Bioakustik ist in hohem Maß auf die Technik angewiesen. Für unsere Forschungen benötigen wir hochsensible Mikrofone, Rekorder, Kameras, Speichermedien und leistungsstarke Rechner sowie geeignete Analyseprogramme. Der technologische Fortschritt der letzten Jahrzehnte ermöglicht es uns heute, Fragestellungen zu bearbeiten, die vor zwanzig Jahren unlösbar gewesen wären. Dazu gehören zum Beispiel die vielen Tierlaute, die außerhalb unseres menschlichen Wahrnehmungs- beziehungsweise Hörvermögens liegen und die wir nun dank neuer Technologien problemlos aufnehmen und analysieren können.
Manchmal profitieren wir Forschenden sogar von den sozialen Medien. Snowball, ein tanzender Kakadu, wurde vor einigen Jahren zur Youtube-Berühmtheit und zog mit seinem erstaunlichen Rhythmusgefühl die Aufmerksamkeit von Aniruddh D. Patel und John R. Iversen vom kalifornischen Neurosciences Institute auf sich.
Video
Hier können Sie Snowball, dem Gelbhaubenkakadu, bei einer rockigen Tanzeinlage zusehen
https://www.brandstaetterverlag.com/wie_tiere_kommunizieren_snowball/
Bis zu diesem Zeitpunkt dachte man, dass die Fähigkeit, sich im Takt zur Musik zu bewegen, eine rein menschliche wäre. Doch das war eine Fehlannahme – wie es so oft mit rein menschlich gedachten Fähigkeiten der Fall ist. Der Gelbhaubenkakadu begeistert mit seinen rhythmischen „Moves“ zu „Another One Bites the Dust“ der britischen Rockband Queen nicht nur die Youtube-Fans, sondern auch die Wissenschafts-Community und wurde zum Star einiger Publikationen in angesehenen wissenschaftlichen Journalen.
Das Rhythmusgefühl ist eine Form der akustischen Informationsverarbeitung. Gehörtes wird verarbeitet und in motorische Aktion, sprich Bewegungen, umgewandelt. Ähnliches passiert beim Nachsprechen oder Nachahmen, dem akustischen Imitieren. Auch dabei wird Gehörtes in Bewegungen – und zwar in Artikulationsbewegungen – übersetzt. Papageien sind hervorragende Imitatoren der menschlichen Sprache. Sie plappern, singen und grölen – je nachdem, was sie von ihren Besitzern zu hören bekommen. Das wirft die Frage auf: Inwieweit sind diese beiden Eigenschaften – akustische Imitation und Rhythmusgefühl – tatsächlich miteinander verknüpft?