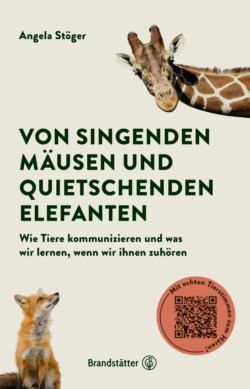Читать книгу Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten - Angela Stöger - Страница 8
Perspektivenwechsel: Der Mensch ist einzigartig, aber andere Tiere sind das auch
ОглавлениеSnowball und Papageien generell sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen nicht als einziges Lebewesen in der Lage sind, Laute zu imitieren. Diese Fähigkeit wird „vokales Lernen“ genannt und ist bei Menschen eine der essenziellen Voraussetzungen für den Spracherwerb. Dass aber auch Tiere zu vokalem Lernen fähig sind, ist in erster Linie bei den bereits genannten Papageien und Singvögeln nachgewiesen. Welche Säugetiere darüber hinaus zu dieser Art des Lernens imstande sind, versuchen wir gerade herauszufinden – oder welche Tiere es besser können und welche weniger gut.
Schwertwale etwa haben Familiendialekte, die durch Nachahmung von den Jungtieren erlernt werden. Bei Buckelwalen wiederum gibt es saisonale Gesänge, die sich weiterverbreiten. Es existiert ein Asiatischer Elefant, der tatsächlich einige Wörter auf Koreanisch „spricht“ – dazu im dritten Kapitel mehr –, und es gab Hoover, einen Seehund, der einzelne englische Wörter imitieren konnte. Ohne Zweifel: Die Imitation der menschlichen Sprache ist so etwas wie die „Königsdisziplin“ im Tierreich. Man geht aber heute davon aus, dass wohl mehr Arten zum vokalen Lernen in verschiedenen Formen fähig sind, als bisher gedacht.
Völlig überraschend haben im Jahr 2012 Forscher der Duke University in Durham, USA bei Mäusen festgestellt, dass sie über die neuronalen Voraussetzungen verfügen, um akustische Information zu imitieren, diese schnell zu verarbeiten und zu antworten. Ob und wie sie diese Fähigkeit tatsächlich einsetzen, wird noch genauer erforscht. Aber belegt ist bereits, dass der Mäuserich, wenn er ein Weibchen umwirbt, einen für den Menschen unhörbaren Gesang im Ultraschallbereich anstimmt – und er scheint von singenden Kontrahenten zu lernen. Braunmäuse gehen sogar „Singduelle“ mit anderen Männchen ein, die einem menschlichen Dialog ähneln. Sie lassen ihren Kontrahenten immer fertig singen – pflegen also eine ordentliche „Gesprächskultur“.
Der Seehund Hoover, der von 1971 bis 1985 im New England Aquarium in Boston lebte, ahmte auf verblüffende Weise die menschliche Sprache nach
Mit solchen faszinierenden Erkenntnissen der bioakustischen Forschung verschiebt sich unsere Perspektive: Die menschliche Sprache ist natürlich speziell und in ihrer Art und Komplexität einzigartig. Je mehr wir aber forschen, desto mehr erkennen wir, dass wir viele der grundlegenden Voraussetzungen für das Erlernen der Sprache mit den Tieren teilen, und zwar durchaus auch Arten wie Mäusen und Elefanten, die aus evolutionsbiologischer Sicht weit von uns entfernt sind.
Die Evolution der Sprache ist eine der größten Wissenschaftsfragen unserer Zeit. Wie und warum hat der Mensch die Sprache als ultimatives Kommunikationsmittel entwickelt? Welche Veränderung, welche Anpassungen – von der Anatomie bis hin zu neuronalen Prozessen und Verbindungen – waren nötig, um die Sprache zu entwickeln?
Der Sprachursprung als Zeitraum, in dem der Mensch lernte, sich sprachlich zu artikulieren, lässt sich nicht datieren. Wir können auch keine Fossilien von Stimmbändern oder den Knorpeln des Kehlkopfes nach Hinweisen auf die Sprachentwicklung untersuchen, da solche Weichteile nicht in versteinerter Form überliefert sind. Wir wissen aber, dass Sprechen eine kognitive Höchstleistung ist, bei der wir Gehörtes verarbeiten, verstehen, uns eine Antwort überlegen und diese formulieren müssen – und das alles in zeitlich sehr kurzen Abfolgen.
Um mehr über die Entstehung der Sprache herauszufinden, verknüpft sich die Bioakustik mit der Biolinguistik und verfolgt einen Forschungsansatz, der beide Disziplinen umfasst. Basierend auf den Vorarbeiten des Linguisten Noam Chomsky wird die Sprache als biologische Eigenschaft von Lebewesen begriffen.
Die fundamentale Frage ist nun: Welche Aspekte von Sprache kommen ausschließlich beim Menschen vor – und welche Merkmale finden wir auch bei Tieren? Könnten Tiere, die in ähnlichen Sozialgefügen wie Menschen leben – beispielsweise Wale oder Elefanten –, einem ähnlichen Selektionsdruck unterworfen worden sein und dadurch eine gut entwickelte Kommunikation hervorgebracht haben? Diese Gemeinsamkeiten oder Unterschiede können wir empirisch untersuchen und dadurch tatsächlich viel über die Evolution der menschlichen Sprache erfahren.