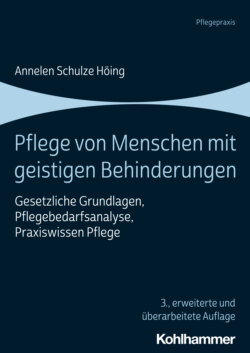Читать книгу Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen - Annelen Schulze Höing - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Das Verständnis von »Behinderung« nach der ICF
ОглавлениеDas Bundesteilhabegesetz hat sich von der Vorstellung verabschiedet, dass »Behinderung« eine Eigenschaft, ein die Person bestimmendes Attribut sei (»Menschen sind behindert«). Vielmehr wird Behinderung im Einklang mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine negative Folge einer Interaktion zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seiner Umwelt (Kontextfaktoren) (vgl. § 2 SGB IX, n. F., s. u.) verstanden.
D. h. eine Behinderung liegt dann vor, wenn eine Person
a. ein Gesundheitsproblem in Form einer Diagnose nach ICD-10 »hat« und
b. im Zusammenhang mit dieser Diagnose die körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen Bereiches) bzw. die Körperstrukturen nicht der biomedizinischen Norm entsprechen und dies
c. Auswirkungen darauf hat, was eine Person in ihren jeweiligen Lebensbereichen tut oder tun kann. Bezugspunkt dieser Beurteilung ist, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme im jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld an Handlungen erwartet wird.
d. sie unter Berücksichtigung der Wirkung von Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren)
e. zu Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, keinen oder nur eingeschränkt Zugang hat bzw. sich in diesen Lebensbereichen nicht so entfalten kann wie Personen ohne Gesundheitsproblem.
Die wechselseitige Beeinflussung der unterschiedlichen Komponenten der ICF will die nachfolgende Abbildung darstellen ( Abb. 1.4). Es gelten folgende Definitionen:
• Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologischer Funktionen).
• Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und Bestandteile.
• Eine Aktivität bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen.
• Partizipation (Teilhabe) ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation.
• Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten (DIMDI 2010: ICF, S. 11).
• Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind. Diese Faktoren können Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Bildung und Ausbildung, Beruf sowie vergangene oder gegenwärtige Erfahrungen etc. sein, die in ihrer Gesamtheit oder einzelnen eine Rolle spielen können (DIMDI 2010: ICF, S. 20).
Abb. 1.4: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF
Die nachfolgenden Beispiele6 verdeutlichen, wie mithilfe des bio-psycho-sozialen Modells der ICF unterschiedliche Behinderungen und Fallkonstellationen beschrieben werden können.
Im ersten Fallbeispiel findet sich eine Diagnose der geistigen Behinderung (ICD-10 F 70). Es liegt eine Beeinträchtigung der Intelligenz vor, wie im Rahmen einer gesonderten Testung ermittelt wurde. Beeinträchtigungen der Intelligenz gehören zu den mentalen Funktionen (Kapitel 1 in der Komponente Körperfunktionen der ICF). Sie werden dort mit dem alphanumerischen Code b117 bezeichnet. Auf eine Darstellung des Schweregrades wird in diesem Beispiel verzichtet. In tatsächlichen Fällen wäre der Schweregrad einer Beeinträchtigung der Intelligenz – auch im Zusammenhang mit gänzlich anderen Diagnosen – abhängig von den jeweiligen in entsprechenden Tests ermittelten Ergebnissen. Im vorliegenden Beispielfall finden sich Schwierigkeiten der Person, Mehrfachaufgaben zu bewältigen. Dies ist plausibel und mit der Beeinträchtigung der Körperfunktion und der Diagnose assoziiert. Mehrfachaufgaben sind ein Merkmal in Kapitel 2 (Allgemeine Aufgaben und Anforderungen) der Komponente »Aktivitäten«. Einmal angenommen, die Schwierigkeiten der Personen, die Mehrfachaufgaben zu bewältigen, wären erheblich. In diesem Falle kann begründet geschlossen werden, dass bei Handlungen in allen Lebensbereichen, deren Umsetzung mit der Bewältigung von Mehrfachaufgaben verbunden sind, Schwierigkeiten bestehen. Dies trifft beispielsweise auf das häusliche Leben zu, zu dem auch das Einkaufen, die Erledigung von Hausarbeiten etc. gehören. Aber auch die Mobilität kann betroffen sein, wenn es etwa darum geht, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Zur Umwelt des hier vorgestellten Falles geistiger Behinderung gehört ein Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe, der Assistenzleistungen zur eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung erbringt. Der alphanumerische Code hierfür wäre e570, der Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung bezeichnet.
An dem »e« ist erkennbar, dass es sich um einen Umweltfaktor handelt. Merkmale der Komponente »Umweltfaktor« werden in der ICF durchgängig mit einem »e« (environmental factors) bezeichnet. Ein »b« bezeichnet die Komponente Körperfunktionen (body functions), ein »s« steht für die Körperstruktur. Ein »d« steht immer für Lebensbereich (life domain).
Es handelt sich um eine freundliche, kontaktfreudige Person, der es mit ihrer sympathischen Art gelingt, andere Menschen für sich positiv einzunehmen. Die leistungsberechtigte Person möchte in ihrer eigenen Wohnung leben. Dies adressiert den Lebensbereich Kapitel 6: Häusliches Leben der Komponente »Partizipation« der ICF. Ob es der Person möglich sein wird, im eigenen Haushalt zu leben, hängt, wie gut gesehen werden kann, ausschließlich an Inhalt, Ausrichtung, Qualität und Umfang der Assistenz ab.
Abb. 1.5: Das bio-psycho-soziale Modell am Beispiel einer geistigen Behinderung
Der zweite Fall beschäftigt sich mit einer Suchterkrankung, diagnostisch bezeichnet als ICD-10: F 10. Eine fachärztliche Untersuchung legt eine starke Beeinträchtigung des Antriebs in Form des Drangs nach Suchtmitteln offen. Gleichzeitig hat der langjährige Konsum zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses und der höheren kognitiven Funktionen geführt. Die Beeinträchtigung des Antriebs, des Gedächtnisses und der höheren kognitiven Funktionen gehört zur Komponente »Körperfunktionen« der ICF und finden sich sämtlich im Kapitel 1: »Mentale Funktionen«. Beschrieben werden im Bereich der Aktivitäten Schwierigkeiten, Probleme zu lösen und die tägliche Routine durchzuführen. Dies erscheint im Zusammenhang mit den beeinträchtigten mentalen Funktionen plausibel. Es besteht eine rechtliche Betreuung mit dem Aufgabenkreis der Vermögenssorge und der Vertretung gegenüber Behörden. Bedeutsam scheint, dass die betreffende Person viele Jahre zur See gefahren ist und insoweit Eigenheiten entwickelt hat, die nicht im Zusammenhang mit der Suchterkrankung zu sehen sind. Wirtschaftliche Eigenständigkeit ist der betreffenden Person außerordentlich wichtig, weshalb in der Komponente »Partizipation« der 3. Abschnitt des 8. Kapitels der Lebensbereiche aufgeführt ist. Auch hier zeigt sich, dass Ausmaß bestehender oder eingeschränkter Teilhabe wesentlich von der Arbeitsweise und Qualität des Umweltfaktors, hier der rechtlichen Betreuung, abhängt.
Abb. 1.6: Das bio-psycho-soziale Modell am Beispiel einer Suchterkrankung
Im letzten Beispiel schließlich geht es um eine körperliche Behinderung in Form einer Querschnittslähmung. In der Komponente »Körperfunktionen« ist das Kapitel 7: »Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen«, dort die Abschnitte Funktionen der Muskeln (b730 – b749) und die Funktionen der Bewegung (b750 – b789) betroffen. Im Zusammenhang mit diesen beeinträchtigten Körperfunktionen bestehen in der Komponente der »Aktivitäten« erhebliche Schwierigkeiten, zu gehen und sich fortzubewegen. Der technikbegeisterten Person ist es wichtig, nach einem Unfall wieder in Arbeit und Beschäftigung zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der medizinischen und beruflichen Rehabilitation, die als Ressource aktiviert werden können. Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation können sowohl technische Hilfsmittel mit Einfluss auf beeinträchtigte körperliche Funktionen und die Aktivitäten sein, beispielsweise in Gestalt eines Rollstuhls. Gleichzeitig üben sie einen erheblichen Einfluss darauf aus, ob es der betreffenden Person möglich sein wird, mit bestehenden Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten zukünftig einer Arbeit und Beschäftigung nachzugehen, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.
Beeinträchtigungen des Körpers, der Seele, des Geistes oder der Sinne sind in der ICF in den Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen beschrieben; einstellungs- und
Abb. 1.7: Das bio-psycho-soziale Modell am Beispiel einer Querschnittslähmung
umweltbedingte Barrieren bezeichnet einzelne Merkmale in der Komponente Umweltfaktoren, während die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft dem Begriff der Partizipation entspricht.
Dies hat für Instrumente zur Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe zur Konsequenz, dass sie in Inhalt und Aufbau die einzelnen Komponenten der ICF beschreiben müssen. Darüber hinaus muss es möglich sein, die Wechselwirkung der einzelnen Komponenten und die Folgen dieser Wechselwirkung auf die Teilhabe in nachvollziehbarer Art und Weise transparent zu machen. Zu den Wechselwirkungen heißt es in der ICF:
»Diese Wechselwirkungen sind spezifisch, stehen aber nicht immer in einem vorhersehbaren Eins-zu Eins-Zusammenhang. … Es kann oft vernünftig erscheinen, eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit aus einer oder mehreren Schädigungen oder eine Einschränkung der Leistung aus einer oder mehreren Einschränkungen der Leistungsfähigkeit abzuleiten. Es ist jedoch wichtig, Daten über diese Konstrukte unabhängig voneinander zu erheben und anschließend Zusammenhänge und kausale Verknüpfungen zwischen ihnen zu untersuchen (DIMDI 2010: ICF, S. 22, Hervorhebung vom Autor).«
Im Folgenden werden die Begriffe »Aktivität«, »Leistungsfähigkeit« und »Leistung« im Sinne der ICF eingehender erläutert.