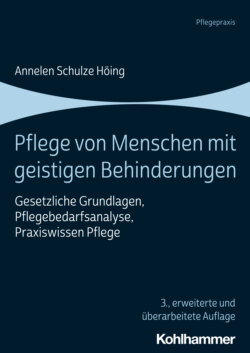Читать книгу Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen - Annelen Schulze Höing - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.2 Teilhabe im Sozialraum
ОглавлениеTeilhabe als »Einbezogensein« in eine Lebenssituation ist in diesem Verständnis keine Fähigkeit, wie dies im alten Recht angenommen wurde. Teilhabe in diesem Verständnis ist das Ergebnis einer Wechselwirkung, also eine Form der Interaktion.8 Eine Person mit einem Gesundheitsproblem interagiert vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Besonderheiten und ihrer Lebensgeschichte (personbezogene Faktoren) in den für sie wichtigen Lebensbereichen. Ist die Leistungsfähigkeit der Person beeinträchtigt, so kann Teilhabe ermöglicht werden, indem diese durch Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation erhöht oder eine Verschlechterung vermieden wird. Diese Wechselwirkung ist im bio-psycho-sozialen Modell als Wechselpfeil zwischen den Körperfunktionen und -strukturen und den Aktivitäten abgebildet. Außerhalb der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wird Teilhabe als Schaffung eines Kontextes begriffen, der an die individuelle Leistungsfähigkeit der Person angepasst ist.9 Dieses Wirken ist im bio-psycho-sozialen Modell zwischen den Aktivitäten und der Partizipation abgebildet.
Die Möglichkeiten einer Person teilzuhaben beziehen sich also grundsätzlich auf die Zugänglichkeit der Umwelt. Die für die Person relevante Umwelt, in deren Rahmen
Abb. 1.9: Ziele von Hilfen im bio-psycho-sozialen Modell
Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht werden, ist der Sozialraum.10
Um zu klären, welche Zugänge für die betroffene Person relevant sind, also an welchen Stellen der Sozialraum nicht auf die Leistungsfähigkeit der Person eingerichtet ist, kommt dem Willen der Person eine zentrale Bedeutung zu. Das Wollen ist in diesem Zusammenhang ein Streben zu etwas, innerhalb dieses Strebens entwirft sich die Person auf ihre Zukunft, was nach Fuchs maßgeblich durch die Möglichkeit gekennzeichnet ist. Das Wollen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Lebensentwurf, also auf die Möglichkeiten – in Sprache von ICF und UN-BRK auf die Zugänge – zu wählen, wo, wie und mit wem jemand leben möchte.
Zugänge stellen demnach sowohl die individuellen als auch die infrastrukturellen Umweltbedingungen ins Zentrum der Betrachtung. Die Möglichkeiten zur selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe hängen in hohem Grad von der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der sozialen Dienste (Teilhabebericht der Bundesregierung, 2013, S. 186) und der Zugänglichkeit des Sozialraums ab.