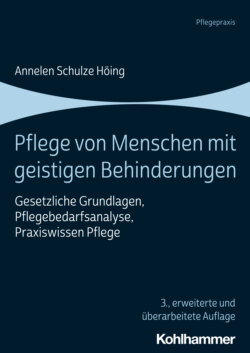Читать книгу Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen - Annelen Schulze Höing - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geleitwort zur 1. Auflage
ОглавлениеDie Betreuung, Bildung und Förderung von Menschen mit – vor allem sog. geistiger – Behinderung gilt gemeinhin als ein Aufgabenbereich pädagogischer Fachkräfte. Aus historischer Perspektive gelang es mit der Stärkung pädagogischer Kompetenz, Behinderung nicht mehr ausschließlich als ein medizinisches oder pflegerisches »Problem« zu betrachten; Menschen mit Behinderungen wurde vielmehr zunehmend zugetraut, kulturelle und lebenspraktische Fähigkeiten zu erwerben sowie personale und soziale Kompetenzen zu entwickeln.
Heute gilt jedoch weder das ausschließlich medizinische noch das pädagogische Verständnis von Behinderung als zeitgemäß. Behinderung wird vielmehr mehrdimensional verstanden; in einer Wechselwirkung zwischen biologischen, psychischen, sozialen und ökologischen Faktoren entsteht eine soziale Situation, die Risiken sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung in sich trägt.
Damit wird Behinderung ein Thema interdisziplinären Handelns; pädagogischer Sachverstand ist ebenso gefragt wie medizinscher, zudem geht es um einen Abbau von Barrieren »in den Köpfen« wie in der materiellen Umwelt. Einem Ausschnitt dieses interdisziplinären Ansatzes widmet sich das vorliegende Buch: Es will pädagogischen Fachkräften pflegerisches Handwerkszeug vermitteln und sie damit aufmerksam machen auf gesundheitsbezogene Risiken, die mit einem Leben mit Behinderung verbunden sein können.
Die Aktualität dieses Themas ergibt sich aus zwei Aspekten:
Zum einen zeigt sich im Rahmen der demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft erstmals, dass auch Menschen vor allem mit lebenslangen Behinderungen ein höheres Lebensalter erreichen. Nach der Ermordung eines Großteils der Menschen mit gravierenden Beeinträchtigungen während der nationalsozialistischen Diktatur kommen die ersten Nachkriegsgenerationen ins Rentenalter. Medizinische Fortschritte und verbesserte Bildungs- und Betreuungsangebote tragen zudem dazu bei, dass sich die Lebenserwartung behinderter Menschen in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht hat.
Mit dieser an sich erfreulichen Entwicklung nehmen jedoch für Menschen mit Behinderung wie für alle Menschen im höheren Lebensalter die Risiken gesundheitsbezogener Belastungen zu: Es drohen Einschränkungen der Selbstständigkeit im Alltag, Nachlassen der Seh- und Hörfähigkeit, Mobilitätseinschränkungen, altersspezifische Erkrankungen wie z. B. Demenz etc.
Zum anderen leben manche Menschen mit Behinderungen ihr Leben lang mit gravierenden gesundheitlichen Belastungen. Probleme einer adäquaten Versorgung ergeben sich vielfach daraus, dass gleichzeitig Kommunikationsschwierigkeiten auftreten, die im Alltag zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen führen können: Nicht erkannte Schmerzen werden als Verhaltensstörung interpretiert, Probleme der Nahrungsaufnahme als Verweigerungsverhalten u. a. mehr.
Das vorliegende Buch greift diese Anforderungen auf und versucht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unerfahren in pflegerischen Fragen sind, ein Leitfaden im Alltag zu sein. Es orientiert sich dabei an sog. Pflegediagnosen, die in gängige Verfahren der Bedarfsfeststellung und der Teilhabeplanung integriert werden. Damit ermöglicht es auch Differenzierungen der Fragestellung, ob bestimmte Situationen eher pädagogische bzw. assistierende Hilfestellungen erfordern oder gesundheitsbezogene Unterstützung bzw. eine Einschätzung, inwieweit pädagogische Mitarbeiterinnen die erforderliche Unterstützung selbst leisten können oder ob medizinische und/oder pflegerische Expertise einzubeziehen ist.
Die Einführung der sog. Pflegediagnosen ist geprägt von einer Haltung der Wertschätzung und des Respekts vor Menschen mit Behinderung. Gerade für die Situation von Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten werden zudem zahlreiche Anregungen gegeben, wie mit den Methoden der Beobachtung Erkenntnisse zu gesundheitsbezogenen Problemen gewonnen werden können.
In und für die Praxis entwickelt, liefert dieses Buch wertvolle praktische Hinweise, wie Menschen mit Behinderungen und gesundheitsbezogenen Belastungen und Risiken ein teilhabeorientiertes Leben führen und wie sie dabei unterstützt werden können.
Ich hoffe, dass dieses Buch einen Beitrag dazu leisten kann, Einrichtungen der Behindertenhilfe dabei zu unterstützen, Menschen mit Behinderungen auch in gesundheitlich belasteten Situationen – sofern sie dies wünschen – ihr vertrautes Wohnumfeld zu erhalten und sie dort pflegerisch zu betreuen.
Dr. Heidrun Metzler,
Entwicklerin des H. M. B.-W-Verfahrens, Forschungsstelle Lebenswelten behinderter Menschen, Eberhard Karls Universität Tübingen