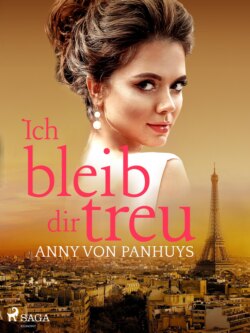Читать книгу Ich bleib dir treu - Anny von Panhuys - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеEs war um die Mittagszeit. Die Elektrischen waren überfüllt, ebenso die Autobusse. Die Autos fuhren durch die Hauptverkehrsadern in endloser Kette. In den Untergrundbahnen herrschte ein lebensgefährliches Gedränge.
Der Zug, der vom Quai de Grenelle kam, hatte in Passy gehalten und fuhr nun über den Viadukt von Passy, als ein furchtbarer Schrei ertönte, ein Schrei, wie ihn nur höchste Todesnot ausstoßen kann, dessen Ursache man aber im ersten Augenblick in dem überfüllten Wagen nicht erkennen konnte.
Noch halb in den Schrei hinein stieß sich ein großer Herr rücksichtslos durch die Menschen, stürzte vor und riß mit eigener Lebensgefahr einen robust aussehenden, etwas kleineren Herrn zurück, dessen Körper das Gleichgewicht verloren hatte, und der im Begriff war, aus dem Wagen zu fallen.
Es gibt in Paris die Unsitte, an heißen Sommertagen die Türen der Untergrundbahnen zu öffnen, um frische Luft einzulassen. Das bedeutete schon an und für sich eine Gefahr. Dazu kam das Schwanken und Stoßen der auf dieser Linie noch benützten alten Wagen. Ein Menschenleben hatte eben auf dem Spiel gestanden, war im allerletzten Augenblick durch Wagemut und Einsatz eines zweiten Lebens bewahrt worden vor einem gräßlichen Tod.
Sekundenlang lag Eberhard Mallentin wie bewußtlos im Arm seines geistesgegenwärtigen Retters, dann erst merkte er, daß er den einen Aermel des andern krampfhaft festhielt, löste seine Finger und sah den Mann bittend an.
„Wenn es Ihnen recht ist, mein Herr, und es Ihre Zeit erlaubt, steigen Sie bitte mit mir am Trocadero aus und begleiten Sie mich von dort bis ins Hotel Moderne, wo ich wohne. Ich bin durch das Erlebnis eben so durcheinandergeraten, daß ich aussteigen möchte, mich aber allein keinen Schritt über die Straße wage.“
Der noch junge, elegante Herr mit dem kurzen, braunen Spitzbart besann sich nicht lange.
„O ja, ich habe Zeit und bin Ihnen gern gefällig.“
Im Auto bedankte sich Mallentin herzlich. Sein Französisch war gut und korrekt, vielleicht ein bißchen zu korrekt.
Der andere lächelte ein wenig.
„Sie sind Deutscher, nicht wahr, mein Herr?“ Der Aeltere nickte.
„Ja, ich bin Deutscher.“ Er nannte seinen Namen: „Eberhard Mallentin, Gutsbesitzer auf Groß-Rampe. Wissen Sie, das liegt in der Nähe von Berlin. Ich hatte wichtige Geschäfte in Paris.“
Der schlanke Herr verneigte sich im Sitzen.
„Ich heiße Gaston de Vernon, bin nichts als Boulevardier.“ Er lächelte stärker. „Es muß auch Leute geben, die nichts tun, nicht wahr?“
Mallentin hatte zwar im allgemeinen nichts für diese Art von Menschen übrig, aber dieser hier, der so freimütig bekannte, daß er eigentlich zur Gilde derer gehörte, die nicht säen und nicht ernten, fand bei ihm doch einen Milderungsgrund.
Es handelte sich ja um seinen Lebensretter.
Er erwiderte liebenswürdig: „Natürlich muß es auch Leute geben, die nichts tun, das ist schließlich Sache des Vermögens. Wenn Sie aber so ganz ihr freier Herr sind, wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie jetzt mit mir im Hotel speisen wollten.“
Das Auto hielt in diesem Augenblick.
Gaston de Vernon dachte heimlich belustigt, daß die Dankbarkeit eigentlich auf seiner Seite wäre, denn seine Börse war wieder einmal leer, und er verspürte immer am meisten Hunger und Durst, wenn er kein Geld besaß.
Er war auf dem Wege zu Lucie Manin gewesen, hatte sich etwas von ihr leihen wollen, um in irgendeinem billigen Bouillonkeller zu essen. Im Hotel Moderne speiste man natürlich besser.
Er verneigte sich abermals.
„Gerne nehme ich Ihre Einladung an, Monsieur Mallentin, ich wollte eben in meinem Klub das Mittagsmahl einnehmen.“
Mallentin sagte erfreut: „Ich danke Ihnen für Ihre Liebenswürdigkeit, Monsieur de Vernon.“
Und dann saßen sie zusammen in dem eleganten Speisesaal.
Eberhard Mallentin betrachtete seinen Lebensretter jetzt erst genauer. Er war mit seiner Musterung zufrieden. Dieser Gaston de Vernon sah äußerst vornehm aus, wie ein richtiger, typischer Pariser Lebemann, und dabei ungemein sympathisch.
Er machte seine Bestellung, und sein Gast hatte keinen Grund, es zu bereuen, die Einladung angenommen zu haben, der deutsche Gutsherr hatte die besten Weine, die erlesensten Speisen ausgewählt.
Eberhard Mallentin konnte beobachten, daß es Gaston de Vernon sehr gut schmeckte.
Eben sagte der Jüngere, nachdem er ein Glas Sekt geleert: „Ich habe tüchtigen Hunger gehabt. Heute früh ritt ich im Bois ein paar Stunden, dann hatte ich ein Boxtraining mit einem Freund. Allen Frühstücksappetit hatte ich mir für das Mittagessen aufgehoben.“
Mallentin lächelte.
„Mir schmeckt es heute auf den Schreck geradezu wundervoll.“ Er wurde sehr ernst, hob sein Glas ein wenig. „Monsieur de Vernon, ich weiß genau, ohne Ihre rasche Hilfeleistung säße ich jetzt bestimmt nicht hier, sondern wäre tot, zum mindesten aber schwer verwundet. Nehmen Sie meinen innigsten Dank, denn Sie begaben sich für einen Fremden selbst in Gefahr. Ich möchte mich Ihnen so gern erkenntlich zeigen. Es würde mich beglücken, wenn ich Ihnen irgendeine Gefälligkeit erweisen dürfte.“
Ueber Gaston de Vernons scharf ausgeprägte Züge ging ein flüchtiges Zucken. Blitschschnell huschte es ihm durch den Sinn, ob er wohl die Gelegenheit beim Schopf packen und ganz einfach bekennen sollte, daß ihm mit barem Geld am besten geholfen sei. Aber ein Rest von Vornehmheit in ihm widersprach.
„Ich habe keine Wünsche, Ihr Dank, Monsieur, macht mir Freude.“
Mallentin wäre, um der Dankbarkeit seines Herzens Genüge zu tun, gern zum Verschwender geworden.
Er sagte lebhaft: „Wenn ich Ihnen dennoch irgendeinen Wunsch erfüllen könnte, erinnern Sie sich, bitte, an mein Angebot. Ich bleibe noch acht Tage in Paris.“
Gaston de Vernon fiel es auf, mit welcher ganz besonderen Aufmerksamkeit der deutsche Gutsbesitzer von den Kellnern bedient wurde. Es schien ihm befremdend, hier, wo es doch viel vornehmere Gäste als den Deutschen gab.
Er wiederholte sich den Namen „Mallentin“. Ihm war es mit einem Male, als hätte er ihn letzthin in irgendeinem besonderen Zusammenhang gelesen.
Er aß langsam von dem köstlichen Pistazieneis, hörte höflich auf das Geplauder des breitschultrigen Herrn, der ihm gegenübersaß, und sann immer wieder: Mallentin, Mallentin? Woher kannte er den Namen?
Es wurde ihm immer klarer, er hatte ihn schon vor dem heutigen Tage in irgendeinem Zusammenhang mit etwas Besonderem gehört.
Ah! Plötzlich kam ihm ein Erinnern. Nun wußte er Bescheid und begriff jetzt die Aufmerksamkeit der Kellner.
Da hatte ihn der Zufall mit einer interessanten Persönlichkeit zusammengeführt. Aber besser war es wohl, weiter so zu tun, als wüßte man gar nichts davon, daß man mit einem Mann speiste, der Gegenstand großer Zeitungserörterungen gewesen war. Chauvinistische Blätter hatten krakehlt, daß ein Boche Millionenwerte aus dem Land schleppen wollte. Die Großmutter Eberhard Mallentins war geborene Französin und nach dem Tode ihres Gatten nach Paris übergesiedelt, wo sie irgendeinen steinreichen Verwandten beerbt hatte. Die Großmutter, Madame Germaine Mallentin, war nun vor einem halben Jahre gestorben, und bis jetzt hatte sich ihr Enkel mühen müssen, die Erbschaft frei zu bekommen, denn die patriotische Presse verlangte, daß namentlich die überaus wertvollen Juwelen von Madame Germaine, die doch im Herzen niemals ihre Nationalität gewechselt, dem Lande erhalten bleiben müßten. Perlen sollten bei dem Schmuck sein, wie sie manche Fürstin nicht einmal in ihren Glanztagen besessen, und der Stirnreif einer ermordeten Balkanfürstin, mit dem kein zweiter sich messen könne.
Eberhard Mallentin schwärmte dem Jüngeren von seinem Zuhause vor.
„Wissen Sie, Monsieur de Vernon, ich freue mich auf daheim. Unser Gut ist ein kleines Paradies. Es gibt keine himmelhohen Häuser, keine Boulevards, das ist klar; dafür aber Eichenwald, wie aus einem alten deutschen Märchen aufgestiegen, und einen tiefen, dunklen See, in dem sich märkische Buchen spiegeln.“
Der andere sagte lebhaft: „Sie schildern das alles so lebendig. Sie reizen mich fast, Ihre engere Heimat kennenzulernen.“
Eberhard Mallentin riß an seinem grauen, dichten Schnurrbart herum.
„Besuchen Sie mich doch, Monsieur de Vernon, ich lade Sie herzlich ein. Dann kann ich meinen Kindern meinen Lebensretter vorstellen.“
Eberhard Mallentin lachte fast laut.
„Groß-Rampe hat Platz für hundert Gäste. Also die Sache ist abgemacht, Sie reisen mit mir.“
Der Jüngere nickte. „Ich nehme mit vielem Dank an, ich habe doch nichts anderes vor und bin völlig Herr meiner Zeit. Uebrigens, etwas Deutsch kann ich auch, wenn auch nicht viel.“ Er dachte, diese Bekanntschaft heute war vielleicht die Gelegenheit zum größten Coup seines Lebens. Einmal mußte er reich werden, um sich aus der Unsicherheit seiner Existenz zu retten. Er zählte zweiunddreißig Jahre, und es war somit die höchste Zeit für ihn.
Ein Boy mit einem Brief in der Hand wollte eben die Treppe ersteigen, erblickte dann Eberhard Mallentin, kam mit devoter Geschmeidigkeit auf ihn zu, überreichte den Brief und verschwand wieder.
Mallentin strahlte seinen Gast an.
„Von meinem Mädel daheim.“
Er wollte den Brief in seine Rocktasche versenken.
„Bitte, lesen Sie nur“, sagte Gaston de Vernon höflich.
Der Gutsbesitzer nickte. „Schön. Ich bin auch gespannt, was meine Kleine schreibt.“
Während Mallentin las, beobachtete der Jüngere ihn ein wenig, sah, wie der Lesende mehrmals schmunzelte.
Jetzt betrachtete er eine Photographie, reichte sie ihm.
„Das ist ein Bild meines Mädels. Franziska heißt sie, aber wir nennen sie ,Fränze‘.“
Das Wörtchen „Fränze“ sprach er natürlich deutsch.
Gaston de Vernon betrachtete die Liebhaberaufnahme ebenfalls.
Er sah ein schlankes Mädchen im einfachsten Kleid der Welt, mit zwei Riesenzöpfen, die nach vorn über die Schultern fielen. Große Augen und ein lachender Mund schienen voll Uebermut.
Landpomeranze, ländlicher, lebensfroher Backfisch! war das Ergebnis von Gastons Betrachtung.
Er reichte das Bildchen zurück, sagte aus Höflichkeit: „Ihre Tochter ist sehr hübsch!“
„So?“ sagte Mallentin, ganz gedehnt. „Wirklich? Ich muß bekennen, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ein sonniges Geschöpf ist sie, das weiß ich. Sie hat die liebenswerte Natur ihrer Mutter, die leider schon vor Jahren starb.“
„Oh!“ machte Gaston de Vernon und deutete dadurch Mitgefühl an.
Er überlegte, daß es gut sei, wenn es auf Groß-Rampe keine scharfsichtige Hausfrau gebe.
Eberhard Mallentin faltete den Brief zusammen, warf noch einen zärtlichen Blick auf das Bildchen und sagte: „Würden Sie mir das Vergnügen bereiten, morgen abend mit mir zusammen zu sein?“ Er sah den Jüngeren treuherzig an. „Damit wir uns noch ein bißchen bessern kennenlernen und uns über Ihren Besuch bei mir unterhalten können.“ Er setzte zögernd hinzu: „Ich habe hier viel mit einem Anwalt zu verhandeln und mit dem deutschen Konsulat. Ich habe dadurch ein paar Bekanntschaften, aber unter uns: amüsieren kann man sich dabei nicht besonders. Ich möchte mich gern einmal mit einem Kundigen da umschauen, wo Paris sich amüsiert. Natürlich in allen Ehren, und wenn Sie da die Führung übernehmen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar.“
Vernon hätte beinahe laut aufgelacht. Es war doch immer dasselbe: die älteren Herren suchten begehrlicher als die jüngeren die Stätten, wo die Becher der Lebensfreude überschäumen.
Nun, ein bißchen konnte er seinem neuen Freunde ja entgegenkommen. Wenn er weiter nichts von ihm verlangte, als dorthin geführt zu werden, wo man sich amüsierte, konnte er ihm dienen, hatte er doch selbst eine große Vorliebe für alles was leicht und lustig war. Sonst — — wie ein bleierner Reif legte es sich plötzlich um seine Stirn — — sonst wäre er niemals Gaston de Vernon geworden.
Er reckte sich in seinem Ledersessel auf.
„Ich werde mich jetzt empfehlen, Monsieur Mallentin. Wann darf ich Sie morgen abend zur Bummelfahrt durch das nächtliche Paris abholen?“
Sie verabredeten sich, und dann ging Gaston de Vernon.
Er fuhr mit dem Metro zum Ostbahnhof. Sein derzeitiges Domizil war das Hotel zur Eisenbahn. Ein schmales, hohes Haus, darin er im dritten Stock wohnte.