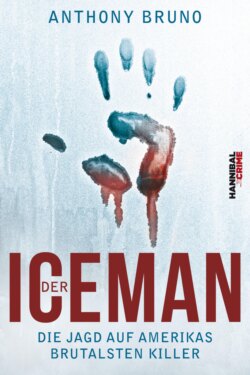Читать книгу Der Iceman - Anthony Bruno - Страница 5
ОглавлениеDer Junge drückte sich dicht an die Backsteinmauer und lauschte. Die Nacht war voller Geräusche. Gedämpft drang das Rattern der Dieselmotoren aus dem Rangierbahnhof von Hoboken herüber, auf dem Hudson ertönten die Sirenen der Schlepper, die Flachkähne mit Müll flussabwärts schoben in Richtung zur offenen See. Im Rücken spürte er das Rumpeln des Verbrennungsofens auf der anderen Seite der Mauer, die leicht vibrierte. Ständig wurde in dieser Gegend Müll verbrannt. Er schaute hinauf zu den Sternen, die trübe durch die aufsteigenden Rauchschwaden schimmerten. Für den vierzehnjährigen Richard Kuklinski war das ganze Leben ein einziger Müllhaufen, und er hatte es gründlich satt. Er konnte einfach nicht mehr. Er lehnte an einer Ziegelwand, die angenehm warm war. Sein Atem bildete Dampfwolken in der eisigen Luft. Mit seiner verschwitzten Hand umklammerte er eine hölzerne Kleiderstange, während er wachsam in der Dunkelheit Ausschau hielt und auf Schritte lauschte, und auf eine Stimme. Johnnys Stimme.
Er musterte die erleuchteten Fenster der Siedlung. Sein Zuhause war irgendwo da oben, aber er wusste nicht genau, welches Fenster es war. Eigentlich spielte es auch keine Rolle. Die Wohnungen hier an der
16. Straße waren alle gleich, mies und verkommen. Die schwere hölzerne Stange stammte aus dem einzigen Schrank, den es bei ihnen gab, dem Schrank im Flur. Total überflüssig, dachte der Junge. Er hatte kaum irgendwelche Sachen wegräumen müssen, um sie mitzunehmen. So ungefähr die einzigen Kleider, die er und seine beiden jüngeren Geschwister besaßen, trugen sie auf dem Leib. Wann immer etwas zerschlissen war und seine Mutter es sich leisten konnte, gingen sie einfach in die Stadt und kauften neue Sachen, die sie gleich anzogen. Manchmal merkten sie erst zu Hause, dass das Preisschild noch dran war. Er spürte sein ausgefranstes, durchgescheuertes Hemd und schämte sich dafür, wie er herumlaufen musste. ›Lumpenrichie‹, ›Penner‹, ›Polackenskelett‹ usw. – so hänselte man ihn dauernd. Doch so schlimm wie Johnny war keiner.
Seine Mutter kümmerte es nicht, wenn er sich beschwerte. Sie kaufte die Sachen für ihn absichtlich immer ein paar Nummern größer, damit er noch eine Zeitlang hineinwachsen könne, wie sie sagte. Aber das passierte nie, egal wie lange er sie trug, und er war so mager, dass sie um ihn herumflatterten wie … ja, wie die Lumpen eines Penners.
Bin auch beinah ein Penner, dachte er. Die anderen Kinder trieben sich in Banden herum, aber er kam mit ihnen nicht zurecht. Lieber durchstreifte er ganz für sich allein stundenlang die Straßen und beobachtete, was es so zu sehen gab – wie die Matrosen sich drüben in Hoboken betranken und mit den Huren davontorkelten, wie die müden Arbeiter sich lustlos in die Maxwell House Fabrik schleppten und am Ende des Tages doch nur ein paar lächerliche Kröten verdient hatten; wie oben am Journal Square die Kunden erbittert mit den Ladenbesitzern stritten, um bei einem Pfund Kartoffeln ein paar schäbige Pennies zu sparen.
Es war alles Müll. Überall gab es Leute, die nur wegen ein paar jämmerlicher Piepen durchdrehten: Dabei war alles bloß Scheiße. Merkten sie das nicht?
Auf einem seiner Streifzüge war er einmal die Henderson Street entlanggeschlendert und hatte draußen vor der Manischewitz-Fabrik einen Laster entdeckt. Auf der offenen Ladefläche stapelten sich Holzkisten voller Flaschen, lauter Weinflaschen. Irgendwas stand auf den Kisten drauf, aber in dieser komischen jüdischen Schrift, genau wie im Fenster der Metzgerei drüben an der Newark Avenue. Nur ein Wort war in Englisch: ›Kosher‹. Richie wusste nicht, was das bedeutete, doch er hatte gehört, dass Juden eine Menge Wein für ihre religiösen Zeremonien brauchten, und Juden hatten Geld. Sie tranken bestimmt kein billiges Zeug, also musste dieser Wein etwas wert sein.
Er ging um den Laster herum und sah, dass die Kabine leer war. Kein Mensch war in der Nähe. Sein Herz begann zu hämmern. Er müsste nur zugreifen. Sicher kam der Fahrer gleich zurück, und dann wäre es zu spät. Vorsichtig schaute er sich um und ging wieder nach hinten zur Ladefläche, wartete ab, bis ein paar Autos vorbeigefahren waren, und spähte hinüber zu den Laderampen der Fabrik. Niemand zu sehen.
Plötzlich war das einzige Geräusch, das er noch hören konnte, sein klopfendes Herz. Er griff nach einer Kiste, um sie herunterzuziehen, aber sie war schwerer als erwartet. Der ganze Stapel geriet ins Schwanken, und er hatte Angst, auf die Heckklappe zu steigen, um besser zupacken zu können. Wenn man ihn im Laster erwischte, wäre es für jeden klar, was er vorhatte. Aber er musste diesen Wein haben. Er hatte noch nie im Leben Wein probiert, doch er wollte ihn, weil er wusste, dass er etwas wert war.
Der Schweiß brach ihm aus, als er zögernd einen Fuß auf die Heckklappe stellte. So rasch wie möglich zerrte er die Kiste herunter, ehe der ganze Stapel umkippen konnte, und sprang wieder auf den Bürgersteig. Die Kiste war schwer, sehr schwer, und er fühlte sich schuldig wie ein Judas. Rasch stemmte er sie auf die Schulter und lief los. Sein Rücken schmerzte, und sein Herz raste. Er dachte an das Paramount Kino in der Stadt und die Cowboyfilme, die er dort am Samstagnachmittag gesehen hatte, in denen die Helden immer mit schäbigen Ganoven kämpften. Und so einer war er jetzt auch. Zum Verbrecher geworden durch roten Wein.
Er rannte den ganzen Weg zurück zur Siedlung, lief direkt zu den Verbrennungsöfen und knallte die schwere Metalltür hinter sich zu. Ein Fenster im Ofen von der Größe eines Briefumschlags tauchte den dunklen Raum in einen rötlich-glühenden Schimmer. Richie stellte die Kiste ab, starrte auf das Feuer und erinnerte sich an den Schwachsinn, den die Nonnen in der Schule dauernd über die Hölle verzapften. Er glaubte kein Wort davon. Mit diesem Gewäsch versuchten sie bloß, einem Angst zu machen und unter ihrer Fuchtel zu halten. Er zog eine Flasche aus der Kiste und betrachtete sie aufmerksam. Der Wein war so dunkel, dass sogar der Feuerschein ihn nicht durchdringen konnte. Mit seinem Taschenmesser probierte er, den Korken zu lockern. Sein Herz hämmerte immer noch wie verrückt, und der Ofen verbreitete eine Hitze, dass sein Gesicht glühte. Verbissen stocherte er an dem Korken herum, um ihn irgendwie rauszudrücken, aber das funktionierte nicht, deshalb zerschnitt er ihn im Flaschenhals, kratzte die losen Stücke heraus und presste dann den Rest in die Flasche. Langsam hob er sie an die Lippen. Seine Hand zitterte. Der Geschmack war ganz anders, als er gedacht hatte, kräftig und süß und eigentlich gar nicht angenehm. Vielleicht war das so etwas, woran man erst ›Geschmack‹ finden musste. Sein wohlhabender Onkel Mickey gebrauchte oft diesen Ausdruck: Es bedeutete, dass etwas auf Anhieb möglicherweise nicht so gut schien und doch etwas Besonderes war. Richie spuckte einige Korkkrümel aus und nahm vorsichtig einen weiteren Schluck. Es dauert wohl, bis man sich an so was Gutes gewöhnt, dachte er. Er trank, so viel er nur konnte, und versteckte dann die Kiste unter einigen alten Zeitungen in einer Ecke.
In dieser Nacht ging es ihm erbärmlich. Dauernd musste er sich erbrechen, lauter purpurne Flüssigkeit, aber nicht, weil er betrunken gewesen wäre. Er war vielmehr einfach krank vor Angst, dass die Polizei kommen und ihn mitnehmen würde, weil man ihn als Dieb entlarvt hatte.
Sein Magen machte ihm tagelang zu schaffen, doch er sagte kein Wort zu seiner Mutter. Er konnte nicht essen und fürchtete sich, nach draußen zu gehen, wo ihm die Polizei womöglich auflauerte. Aber nichts geschah. Zwei Wochen dauerte es, bis er schließlich überzeugt war, dass er Glück gehabt hatte und der Wein tatsächlich ihm gehörte.
Als er jedoch wieder nach seinem geheimen Lager sehen wollte, war die Kiste verschwunden. Irgendjemand hatte sie gefunden und seinen Wein mitgenommen. Garantiert steckte Johnny dahinter.
In einiger Entfernung überquerte ratternd ein Zug die Bertonbrücke an der Newark Avenue, der entweder in Richtung des Rangierbahnhofs fuhr oder von dort kam. Richies Vater arbeitete bei der Eisenbahn als Bremser. Jedenfalls glaubte er das, aber er war nicht sicher. Das letzte Mal hatte er ihn vor zwei Jahren bei der Geburt seiner kleinen Schwester gesehen. Er war abgehauen, als Richie noch ein kleines Kind gewesen war, doch ab und zu stand er urplötzlich vor der Tür wie ein Seemann, der auf Landgang nach Hause kam. Sein Erscheinen bedeutete allerdings kein besonderes Vergnügen. Er war hitzköpfig, und offenbar machte es ihm Spaß, seinen ältesten Sohn völlig grundlos zu verprügeln. Stinkbesoffen kam er brüllend ins Kinderzimmer gestürmt, tobte wegen irgendeiner Nichtigkeit und zog dann den Gürtel aus seiner Hose. Es war nicht so schlimm, wenn die Mutter zu Hause war; dann dauerte die Dresche gewöhnlich nicht lange, weil sie versuchte, ihn zurückzuhalten und ebenso lautstark brüllte und kreischte. Richie war zu dem Schluss gekommen, dass sein Alter genau wie alle anderen war. Das Einzige, was er im Grunde wollte, war ein wenig Beachtung, und deshalb würde er wieder seinen Gürtel nehmen und loslegen, wenn die Mutter bei der Arbeit war; es gab nichts, was ihn davon abhalten konnte. Richie konnte nur versuchen, es zu ertragen und währenddessen an etwas anderes zu denken.
Natürlich wurde er auch von seiner Mutter geschlagen, aber sie hatte nicht so viel Kraft und Ausdauer, wenn sie zum Besenstiel griff, und es tat nicht mal halb so weh. Sie schuftete dermaßen in der Armour-Fleischfabrik, dass sie kaum Zeit fand, ihre Kinder zu verdreschen. Allerdings hatte sie andere Methoden, mit denen sie es schaffte, dass man sich klein und mies fühlte. Bessere Methoden. Sie machte es mit Worten, boshaften, hämischen, verletzenden Worten, nach denen Richie sich wie der letzte Dreck vorkam und überzeugt war, dass ihre Verbitterung und Enttäuschung über das Leben allein seine Schuld waren und dass er etwas tun sollte, um es wieder gutzumachen. Dabei wusste er gleichzeitig, dass alles zwecklos war. Wenn er es sich recht überlegte, war sie eigentlich noch schlimmer als der Alte.
Aber bei den Eltern blieb einem nichts weiter übrig, als sich damit abzufinden; von einem anderen Kind dagegen durfte man sich nichts gefallen lassen. Es gehörte sich, dass man sich wehrte, so wie es die Cowboys in den Filmen machten. Genau deshalb stand er jetzt hier in der Dunkelheit gegen die warme Ziegelwand gedrückt und hielt die Kleiderstange bereit, um sich endlich zur Wehr zu setzen und zurückzuschlagen.
Johnny verhöhnte ihn nicht nur, er schlug ihn auch gern zusammen. Er wohnte im Erdgeschoss desselben Hauses und hatte seine eigene Bande. Ständig triezte er ihn, wenn seine Truppe dabei war, um sich wichtig zu machen und um zu zeigen, wer hier der Anführer war. Am Anfang hatte Richie versucht, sich zu verteidigen, aber wenn er bloß eine Hand gegen Johnny erhob, fielen die anderen sechs Kinder, die ebenfalls in dieser Siedlung an der 16. Straße lebten, mit Boxhieben und Tritten über ihn her. Nach einer Abreibung, bei der er eine geplatzte Lippe kassierte und sich einen Monat lang mit dumpfen Schmerzen in der Seite quälte, hatte er gelernt, dass es besser war, es einfach hinzunehmen, genau wie die Dresche seines Vaters. Das ging schneller. Aber es war schwer. Johnnys zur Schau getragene Überheblichkeit machte ihn rasend, und die Demütigung, von der ganzen Bande ausgelacht zu werden, zerfraß ihn innerlich.
Richie zitterte vor aufgestautem Hass, wenn er nur an Johnny und seine blöde Meute dachte. Er klopfte mit der Stange auf den asphaltierten Boden. Nein. Es reichte jetzt wirklich. Er würde sich nichts mehr gefallen lassen.
Schritte erklangen im Hof, und ihm blieb fast das Herz stehen. Jemand kam in:seine Richtung. Langsam hob er die Stange. Seine Arme waren bleischwer, und er fühlte sich wie gelähmt.
Die Schritte kamen näher.
Richie wünschte, er könnte aufhören zu zittern. Am liebsten wäre er weggelaufen, aber er wollte nicht immer davonrennen. Johnny sollte seine Lektion kriegen und sich merken, dass er nicht länger auf Richard Kuklinski herumhacken konnte. Er wollte einfach nur in Frieden leben und bloß in Ruhe gelassen werden.
Die Schritte waren schon so nahe, dass er ihn treffen müsste, als er ein Gesicht in der Dunkelheit erkannte.
»Richie?«
Hastig ließ er die Stange sinken und versteckte sie hinter seinem Bein. Es war Mr. Butterfield, der auf demselben Flur wohnte. Er hatte eine Bierflasche in der Hand, und Richie merkte, dass dies nicht seine erste war. Mr. Butterfield war ein Trinker, der ebenfalls regelmäßig seine Kinder schlug.
»Weiß deine Mutter, dass du so spät noch draußen bist?«
Richie zuckte die Schultern. »Ist mir egal.« Sie war am Radio eingeschlafen, genau wie jeden Abend.
»Du gehst besser heim. Es ist doch schon so spät.«
Butterfield nahm einen Schluck aus seiner Flasche und torkelte weiter.
Wütend schaute er ihm hinterher. Der Mistkerl scherte sich einen Dreck um seine eigenen Bälger, aber dann große Töne spucken, als mache er sich Gedanken um fremde Kinder! Dieser gottverdammte Heuchler mit seinem blöden Geschwätz.
Richie überlegte, ob es wirklich schon so spät war. Er besaß keine Uhr, jedenfalls keine, die funktionierte. Unwillkürlich musste er an seine Firmung vor drei Jahren denken, und ein Gefühl tiefer Demütigung brannte in ihm wie immer, wenn er sich daran erinnerte.
Johnny hatte einen neuen blauen Anzug getragen, ein weißes Hemd, eine silbergraue Krawatte und die lilienweiße Binde aus Satin am Oberarm. Er ähnelte eher einem jungen Gangster als einem Firmling. Garantiert hatte er die verdammten Klamotten gestohlen, denn schließlich war er genauso arm wie alle anderen in der Siedlung. Aufgeplustert stolzierte er nach der Zeremonie wichtigtuerisch die Kirchenstufen hinunter – ein neuer Streiter in der Armee Christi. Auch so eine schwachsinnige Scheiße von den scheinheiligen Nonnen. Warum sollte Gott ein solches Arschloch in seiner Schar haben wollen? Warum durfte überhaupt jemand wie Johnny gefirmt werden? Bloß weil er einen feinen Anzug hatte? Lauter gottverfluchte scheinheilige Heuchler, alle miteinander.
Richard hatte an diesem Tag dieselben uralten Sachen getragen wie immer: die braunen Hosen, ein abgewetztes gestreiftes Hemd und seinen dunkelblauen Wollmantel. Es war April, aber er musste den Wintermantel anziehen, weil er sonst nichts anderes besaß und seine Mutter darauf bestanden hatte. Er wusste noch genau, wie mühsam er sich die Armbinde über den Mantelärmel gestreift hatte, wobei er ständig fürchtete, dass der Gummizug riss, und sich wünschte, seine Mutter hätte sie ihm angelegt. Aber sie musste arbeiten, an Sonntagen bekam sie fünfzig Prozent Zuschlag. Sein jüngerer Bruder und die kleine Schwester blieben bei einer Nachbarin.
Richie war allein zur Kirche gegangen, und er tat, was die Nonnen ihm beigebracht hatten. Zusammen mit den anderen kniete er am Altar, als der Bischof die Reihe entlangging, etwas auf Latein murmelte, den Daumen in geweihtes Öl tauchte, jede Stirn salbte und jede Wange mit dem symbolischen Backenstreich berührte. Richard empfand nur Gleichgültigkeit und Leere. Nachdem es vorbei war und die anderen Kinder zu ihren wartenden Familien rannten, stand er einfach auf, um heimzugehen, und überlegte, ob noch irgendwas Essbares im Kühlschrank war, damit er sich ein Sandwich machen könnte.
Als er die Treppenstufen hinunterkam, erblickte er Johnny mit seiner Familie. Sie veranstalteten ein Mordstheater um ihn. Er lächelte und hielt sein Handgelenk hoch, damit alle es sehen konnten, und seine Mutter quiekte: »Bedank dich bei deinem Onkel Mario, Johnny. Sag Dankeschön.« Er hatte eine neue Armbanduhr. Sie war aus Gold mit einem vergoldeten Edelstahlband. Er brüstete sich immer mit seinem reichen Onkel, der ihm lauter Sachen schenke, aber bis jetzt hatte Richard kein Wort davon geglaubt. Seine Mutter hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, Onkel Mickey zu sagen, dass er gefirmt wurde.
Rasch schob er sich durch die Menge und bemerkte, dass auch die anderen Kinder die Arme hochhielten und ihre neuen Uhren herzeigten. Sogar die Mädchen hatten welche, diese winzigen Uhren, die so klein waren, dass man kaum die Zeit ablesen konnte. Alle hatten eine neue Uhr bekommen, nur er nicht.
Am nächsten Tag ging er nach der Schule zum Krämerladen an der Ecke und war entschlossen, sich selbst etwas zu seiner Firmung zu kaufen. Fast einen Dollar besaß er in Kleingeld, und dort hatte er Armbanduhren für 79 Cent gesehen, die auf einem Pappkarton befestigt über der Registrierkasse hingen. Mit heftig klopfendem Herzen zählte er seine Münzen auf die Theke. Der Mann nahm das Pappstück herunter, damit er sich eine aussuchen konnte, obwohl alle gleich waren, zog sie für ihn auf, stellte die Zeit ein und sagte: »Viel Spaß damit, Junge.« Stolz befestigte Richie sie an seinem Handgelenk und bewunderte sie.
Beim Aufwachen am nächsten Morgen merkte er, dass die Uhr stehengeblieben war, und als er versuchte, sie aufzuziehen, hielt er plötzlich das Rädchen zwischen den Fingern. Er lief zum Laden, doch der Händler weigerte sich, sie zurückzunehmen.
Richie trug sie trotzdem, um wenigstens nicht der Einzige ohne Uhr zu sein. Aber ständig verfolgte ihn die Angst, Johnny würde sehen, dass sie nicht die richtige Zeit anzeigte, dass das Rädchen zum Aufziehen fehlte, das billige Band brüchig war und braune Flecken auf seiner Haut hinterließ. Er konnte direkt hören, was Johnny sagen würde und in welchem Tonfall, und vermutlich würde es auf eine weitere Tracht Prügel vor den Augen der ganzen Meute hinauslaufen. Richies Herz raste, und er biss die Zähne aufeinander vor Angst und Wut, wenn er nur daran dachte.
Dieser Dreckskerl und seine Bande hatten ihn jahrelang gepiesackt. Aber nun war Schluss. Er würde ihnen zeigen, dass niemand ihn mehr herumschubsen konnte. Von jetzt an nicht mehr.
Angestrengt starrte er in die Dunkelheit. Dort, auf der anderen Seite des Hofs, würde Johnny um die Ecke des Gebäudes kommen. In letzter Zeit hatte er von dieser Ecke aus jeden Abend die anderen zu sich heruntergerufen. Dann standen sie im Hof, rauchten, rissen Witze und brüllten hinauf zu den Mädchen, die sie kannten, und sagten Schweinereien über sie. Manchmal rief Johnny auch zu ihm hinauf: »He, Polacke, schläfst du da oben? Oder tust du nur so, damit deine Mutter nicht merkt, dass du wichst?«
Jeden Abend ging das so. Aber das würde aufhören.
Plötzlich entdeckte er etwas und kniff die Augen zusammen. Ein orangefarbener, glühender Punkt tauchte an der Ecke auf und kam in seine Richtung – eine brennende Zigarette. Richie drückte sich mit angehaltenem Atem an die Wand und umklammerte fest die Stange in seiner Hand. Sein Puls raste, doch diesmal bezwang er den Drang, davonzurennen. Er wollte die Sache hinter sich bringen. Er wollte es Johnny zeigen und ihm ein für allemal eine Lektion erteilen.
Hinter dem orangeglühenden Punkt schimmerte jetzt ein Gesicht. Die kleinen dunklen Augen, das widerliche Grinsen – Johnny. In einer Wolke von Zigarettenrauch schlenderte er heran und war überrascht, Richie zu sehen, aber gleichzeitig freute es ihn, sein Lieblingsopfer im dunklen Hof allein anzutreffen.
Ein paar Schritte vor ihm blieb er stehen, nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette und betrachtete ihn abschätzig. »Was machst du hier draußen, du blöder Polacke? Hast du Lust auf eine Abreibung, oder was?« Er lachte anzüglich.
Richie antwortete nicht. Er konnte kein Wort herausbringen. »Mann, ich rede mit dir, Polacke. Ich hab gefragt, was du hier treibst.«
Sein bösartiger Ton ließ Richie zusammenzucken. Das passierte ihm jedesmal.
»Mach’s Maul auf, Polacke, oder ich trete dir deine dreckigen Zähne ein.«
Er kam näher, und Richie hob automatisch die Stange.
Johnny wich zurück. »Was willst’n damit, Blödmann?«, grinste er.
Richie blieb stumm und rührte sich nicht.
»Was ist? Spielst du hier Hockey, Polacke?«
Er griff nach der Stange, um sie ihm wegzunehmen, aber Richie zog sie hastig zurück.
»Gib mir das Ding«, fuhr Johnny ihn an und sprang auf ihn zu.
Es passierte ganz automatisch. Er traf ihn an der Wange – nicht fest, aber er hatte ihn getroffen. Richie war darüber noch entsetzter als Johnny und wäre am liebsten losgerannt, doch er konnte nicht, und tief im Innern wollte er es auch gar nicht. Er wollte diese Sache hinter sich bringen. Er wollte diesem Ekel zeigen, dass ihn keiner mehr herumschubsen konnte.
Der Junge funkelte ihn wütend an und hielt sich die Wange. »Du Miststück«, flüsterte er. »Du dreckiges kleines Miststück.« Mit einem Satz wollte er sich von neuem auf ihn stürzen.
Diesmal holte Richie richtig aus. Johnny hob die Hand, um den Schlag abzublocken, und bekam ihn mit voller Wucht auf den Unterarm. Er jaulte auf und presste den schmerzenden Arm fluchend an sich.
Hastig schlug Richie noch einmal zu und traf seinen Kopf. »Mann! Lass das!«
Johnny brüllte lauthals und bettelte ihn an, aufzuhören; doch Richie schlug weiter und weiter. Er hob die schwere Stange hoch, ganz hoch und ließ sie auf den Rücken seines Peinigers hinuntersausen, wie man es auf dem Rummelplatz beim Hau-den-Lukas machte, damit die Glocke ordentlich läutete. Er wollte, dass Johnny den Mund hielt. Die anderen aus der Bande würden ihn sonst noch hören und ihm zu Hilfe kommen. Er sollte endlich still sein!
»Halt’s Maul«, stöhnte er durch zusammengebissene Zähne. Aber Johnny schrie unaufhörlich, hilflos wie ein Mädchen, und Richie schlug immer weiter zu, so fest er nur konnte, und plötzlich verspürte er etwas, das er in seinem ganzen Leben noch nie empfunden hatte: Macht. Jeder neue Schlag verstärkte dieses Gefühl, bis er Johnny, der keine Gegenwehr mehr zeigte, auf die Knie fallen sah. Es war ein wunderbares Gefühl, das ihn völlig berauschte. Unerbittlich hieb er auf Johnnys Kopf ein. Er konnte nicht mehr aufhören. Heute wollte er es ihm zeigen, damit er endlich kapierte, dass niemand Richard Kuklinski herumstieß. Niemand. Kein Mensch.
Als er schließlich innehielt, lag Johnny flach auf dem Boden, und es war schwer, ihn in dieser Position noch richtig zu treffen. Keuchend beugte er sich über ihn und wartete, ob Johnny noch mal aufstand. Er war erschöpft, aber er fühlt sich unendlich gut und richtig mächtig. Er hatte es Johnny gezeigt. Keiner aus der ganzen Bande würde es jetzt noch wagen, sich mit ihm anzulegen. Er hatte es allen gezeigt.
Langsam stieg er die Treppen hinauf zu seiner Wohnung und hängte die Stange wieder in den Schrank, dann ging er ins Bett. Eine Weile lag er noch wach und genoß die Erregung seines Triumphs, ehe er in einen tiefen Schlaf sank.
Am nächsten Morgen brüllte seine Mutter an der Schlafzimmertür, er solle endlich aufstehen, es sei Zeit für die Schule. Richie hatte tief und fest geschlafen und wenig Lust, sich schon zu rühren, aber der Klang von Männerstimmen, der von draußen hereindrang, lockte ihn ans Fenster. Im Hof parkten Polizeiautos. Mindestens ein Dutzend Beamte standen dichtgedrängt an der Backsteinwand, wo er Johnny gestern abend liegengelassen hatte. Zahlreiche Leute aus dem Wohnblock waren ebenfalls dort unten – die üblichen Wichtigtuer, die natürlich schleunigst herausfinden wollten, was da los war. Ein paar Kinder aus Johnnys Bande redeten mit den Bullen, und er sah, dass eines stirnrunzelnd den Kopf schüttelte.
»Richie, du kommst zu spät!«, schrie seine Mutter aus der Küche.
»Was ist da draußen los?«, brüllte er zurück.
»Was?«
»Draußen. Im Hof.«
»Kennst du diesen frechen Bengel von unten? Irgend jemand hat ihn gestern Nacht umgebracht. Jetzt mach voran und zieh dich an, oder du kannst das Frühstück vergessen.«
Benommen starrte er hinunter in den Hof. Johnny war tot? Das hatte er nicht gewollt, ganz bestimmt nicht. Er hatte ihm bloß eine Lektion erteilen wollen, mehr nicht. Er hatte ihn doch nicht töten wollen!
»Richard! Bist du endlich angezogen?«
Voller Angst, dass die Bullen hochschauen und ihn sehen würden, trat er hastig vom Fenster zurück. ln seinem Bauch hatte er plötzlich krampfartige Schmerzen. Er schlich hinaus in den Flur, öffnete leise die Schranktür und inspizierte die Stange. Nirgends war Blut zu sehen. Vielleicht hatte er Johnny gar nicht getötet. Vielleicht war es jemand anderer gewesen, der ihn bewusstlos auf dem Boden gefunden und die Gelegenheit genutzt hatte, ihn loszuwerden. Ja, so könnte es sich abgespielt haben. Schließlich hatte er auch andere Kinder schikaniert. Aber irgendwie glaubte Richie es selbst nicht recht. Er wusste, dass er es getan hatte.
Die Krämpfe in seinem Magen wurden so schlimm, dass er sich vor Schmerz krümmte. Seine Mutter brüllte, er solle sich anziehen und zur Schule gehen. Es war eine Qual, sich die Kleider überzustreifen. Gott sei Dank war sie bereits zur Arbeit weg, bis er fertig war. Sie hatte ein paar Haferflocken und Milch für ihn auf den Tisch gestellt, aber schon bei diesem Anblick wurde ihm schlecht, und er erbrach sich ins Spülbecken. Durch das geschlossene Küchenfenster konnte er die Polizei unten im Hof hören. Es war besser, die Schule sausen zu lassen und daheim zu bleiben.
Er hatte Angst, nach draußen zu gehen oder auch nur ans Fenster, und verkroch sich ins Bett. Bestimmt würden sie alles herausfinden und ihn mitnehmen. Die Kinder aus der Bande würden verraten, dass nur er als Täter in Frage kam, weil er Johnny gehasst hatte. Am Ende war Mr. Butterfield gestern gar nicht so besoffen gewesen und hatte die Stange in seiner Hand gesehen, was er der Polizei womöglich gerade erzählte. Sie würden hochkommen, die Wohnungstür einschlagen und ihn wegschleppen. Richie fragte sich, was sie wohl mit Kindern machten, die andere Kinder umbrachten. Ob er ins Gefängnis kam? Oder ins Erziehungsheim? Davon hatte er manchmal gehört, aber er wusste nicht so recht, was das war. Er hatte jemanden getötet. Vielleicht würde man ihn dafür auch töten – auf dem elektrischen Stuhl, genau wie man es mit erwachsenen Mördern machte.
Richie sprang aus dem Bett und rannte zum Schrank. Er warf die wenigen Kleider, die dort hingen, zu Boden und riss die Stange herunter. Im Bad ließ er heißes Wasser in die Wanne laufen und schrubbte sie gründlich, nur für alle Fälle. Dann trocknete er sie mit einem Handtuch ab und befestigte sie wieder an Ort und Stelle.
Doch auch das beruhigte ihn nicht. Bis zum Nachmittag lief er in der Wohnung hin und her und überlegte, was die Polizei für Beweise haben könnte. Zitternd kroch er wieder ins Bett. Seine Zähne klapperten, und gleichzeitig schwitzte er, während er an die Decke starrte und sich fragte, wann sie endlich kommen würden. Irgendwann musste er dann wie bei hohem Fieber die Besinnung verloren haben.
Als seine Mutter am Abend zurückkehrte, nachdem sie seinen vierjährigen Bruder und die dreijährige Schwester von der Nachbarin abgeholt hatte, die auf sie aufpasste, verschwieg Richie, dass er die Schule geschwänzt hatte. Er tat, als sei alles ganz normal. Die Mutter sagte kein Wort mehr über die Sache mit Johnny. Wie gewöhnlich war sie zu erschöpft, um überhaupt irgendwas zu reden. Für eine Weile hatte er nachmittags gehofft, er könne es ihr vielleicht erzählen und sich alles von der Seele laden. Aber jetzt wusste er, dass das nicht ging. Er konnte es niemandem sagen.
Die ganze Nacht lag er wach und hörte dauernd Johnnys Stimme draußen im Hof – und das dumpfe Aufschlagen der Stange, die immer wieder seinen Kopf traf.
Am nächsten Morgen blieb er länger im Bett und trödelte absichtlich herum, bis er allein war. Er würde nie mehr in die Schule gehen, nie wieder einen Fuß nach draußen setzen, und bestimmt war er sowieso bald tot, weil er ständig brechen musste. Keinen Bissen behielt er bei sich, und irgendwann würde er verhungern.
Regungslos lag er im Bett, dachte an Johnny und an diesen schrecklichen Moment, wenn die Bullen die Tür eintreten würden.
Aber dieser Moment kam nicht.
Die ganze restliche Woche blieb er zu Hause, quälte sich mit seinen Ängsten, rannte auf und ab, schwitzte.
Doch nichts passierte.
Die Nonnen erkundigten sich bei seiner Mutter, weshalb er tagelang nicht zur Schule gekommen sei und warum sie keine Entschuldigung geschickt habe, wenn er krank sei. Sie tobte vor Wut über seine Verschlagenheit und prügelte ihn mit dem Besenstiel durch. Außerdem schickte sie ihn am Sonntag zur Strafe in die Kirche. Schweißgebadet saß er in der Messe und schaute sich immer wieder verstohlen um, ob nicht schon ein Junge aus der Bande auf ihn deutete, der gleich herausbrüllen würde, dass Richard Kuklinski der Mörder von Johnny war.
Doch nichts passierte.
Am Montagmorgen sagte er seiner Mutter, dass er wirklich krank sei, aber sie glaubte ihm kein Wort und zwang ihn, mit ihr gemeinsam die Wohnung zu verlassen. Auf dem Weg zur Schule versuchte er, sich so gut es ging zusammenzunehmen. Trotzdem erstarrte er jedesmal vor Schreck, wenn er ein Auto näherkommen hörte. Ständig erwartete er, dass ein Streifenwagen anhielt und ihn mitnahm.
Doch nichts passierte.
In der Schule konnte er nicht aufpassen, und die Nonne, die Unterricht gab, schalt ihn mehrmals, weil er in den Tag hinein träumte. Wenn mich irgend jemand verpfeift, dann sie, dachte er. Nonnen witterten Sünder schon aus meilenweiter Entfernung. Er rechnete dauernd damit, dass sie losschrie und ihn anklagte, woraufhin die Bullen ins Klassenzimmer stürmen und ihn wegzerren würden.
Aber nichts passierte.
Es passierte einfach gar nichts.
Fast zwei Wochen waren seit dieser Nacht im Hof vergangen, und keiner war auch nur mit einer Frage zu ihm gekommen. Keine Bullen, keines der Kinder aus der Bande, keiner aus Johnnys Familie, nicht mal Mr. Butterfield. Überhaupt niemand.
Allerdings war er fest überzeugt, dass es bloß eine Falle war. Sie verstellten sich alle. Die Polizei wartete nur auf den richtigen Moment, ehe sie zuschlug. Es war bestimmt eine Falle.
Ihm kam der Gedanke, dass Johnny womöglich gar nicht tot war. Irgendwann würde er in den nächsten Tagen die Straße entlanggehen und plötzlich Johnny gegenüberstehen, den die Polizei die ganze Zeit über in einem Krankenhaus versteckt hatte. Er würde auf ihn zeigen und den Bullen zurufen: »Das ist er. Der magere Polacke ist der Kerl, der mich umbringen wollte.«
Richie konnte nicht essen, er konnte nicht schlafen und fürchtete sich davor, einen Fuß aus dem Haus zu setzen.
Aber nichts passierte. Absolut nichts.
Allmählich begann er sich zu beruhigen. Vielleicht wusste es tatsächlich niemand. Vielleicht war ja alles gut. Eines Tages ertappte er sich dabei, wie er lächelte, und er merkte, dass er überhaupt nicht mehr an Johnny gedacht hatte: Er begann wieder öfter nach draußen zu gehen, und schließlich hörte er damit auf, hinter jeder Ecke ein Polizeiauto zu erwarten. Er dachte zwar noch an Johnny; aber es quälte ihn nicht mehr sonderlich. Statt dessen fühlte er sich allmählich irgendwie richtig großartig. Der Tyrann war weg; die Schikanen hatten ein Ende, und er hatte seine Ruhe. So einfach konnte man also mit Gewalt seine Probleme lösen.
Im Laufe der folgenden Monate tauchten immer mal wieder im Haus Ermittlungsbeamte auf, um die Nachbarn wegen Johnny zu befragen und zu hören, ob es irgendwelche neuen Informationen gab. Richie ging jedesmal ungerührt an ihnen vorbei und verbiss sich ein Grinsen. Nur er wusste, wer Johnny getötet hatte – und niemand sonst. Es war sein kleines Geheimnis, das ihm ganz allein gehörte. Kein Mensch auf der Welt kannte es, nur er; und es stellte ihn irgendwie über die anderen. Es machte ihn zu etwas Besonderem. Er war jemand.