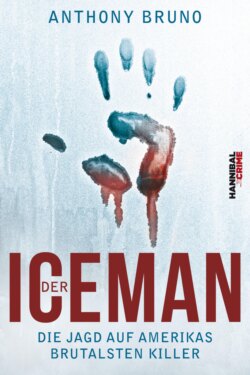Читать книгу Der Iceman - Anthony Bruno - Страница 9
ОглавлениеEine warme Brise wehte durch das offene Fenster des Shark, als Dominick Polifrone auf der alten Stahlträgerbrücke den Fluss überquerte. Die Sonne spähte durch graue Regenwolken, und am Horizont wurde der Himmel allmählich wieder blau. Obwohl der Regen nachließ, hörte man die Reifen auf dem schwarzen Asphalt zischen. Dominick nahm jedoch nichts davon wahr. Er dachte nur an Richard Kuklinski und versuchte, sich nicht nervös zu machen, sondern einfach er selbst zu sein. Das war der Schlüssel zum Erfolg als Undercoveragent: Man musste sich ganz normal geben, so wie man war.
Dominick hatte die Erfahrung gemacht, dass kunstvoll ausgearbeitete Lebensläufe und Decknamen leicht problematisch werden konnten. Man durfte nicht zögern, wenn man sich in solcher Gesellschaft herumtrieb. Brauchte man auch nur eine Sekunde, um auf seinen Decknamen zu reagieren, entstand schon der erste Verdacht. Und dabei blieb es selten. Ein Fehler, und es konnte einem übel ergehen – und ein Fehler bei den falschen Leuten kostete einen möglicherweise das Leben.
Deshalb unterschied sich Dominick Polifrone nicht allzu sehr von ›Michael Dominick Provenzano‹. Er hatte im ›Laden‹ erzählt, dass einige Leute ihn als Sonny kannten, aber allen gesagt, sie sollten ihn einfach Dom nennen.
Die Adresse auf seinem Führerschein war ein riesiges Hochhaus in Fort Lee. Dort wohnte er angeblich bei seiner Freundin.
Michael Dominick Provenzano hatte seine Kindheit in einem Arbeiterviertel in Hackensack, New Jersey, verbracht. Genauso war es bei Dominick Polifrone gewesen.
Michael Dominick Provenzano hatte als Kind geklaut, und Dominick Polifrone ebenso.
Aus Dominick Polifrone wäre am Ende vielleicht tatsächlich ein Typ wie Michael Dominick Provenzano geworden, wenn er kein Football-Stipendium der Universität von Nebraska bekommen hätte. Nicht dass Football oder der Mittlere Westen ihm den Kopf zurechtrückte – ganz im Gegenteil. Dominick fiel in Nebraska ein wie ein italienisch-amerikanischer Tornado. Da er aus dem Osten kam, war er bei allem, was gerade in Mode war, den anderen stets voraus. Er trug ausgestellte Hosen mit Schlag auf dem Campus, ehe die Farmerkinder auch nur wussten, dass es so etwas überhaupt gab, und bei jeder Rückkehr aus den Ferien brachte er einen Schwung der neuesten Platten mit, die in Nebraska noch wochenlang nicht in den Läden zu haben sein würden. Schon in Hackensack hatte Dominick ein großes Maul gehabt, aber in Nebraska war er gar nicht mehr zu bändigen. Bis zu seinem zweiten Jahr war es für ihn ein wöchentliches Ritual geworden, an Freitagabenden in Bars zu randalieren, und allmählich gehörte es ebenso zu diesem Ritual, die Nacht im Kittchen zu verbringen. Zu dieser Zeit hatte ein Sergeant der Polizei von Omaha ein besonderes Interesse an diesem jungen Unruhestifter aus New Jersey, der ihm die letzten Nerven raubte, und schleppte ihn zum Campus, um eine kleine Unterredung mit Dominicks Trainer zu führen. Dieses Treffen war es gewesen, das ihm den Kopf zurechtgerückt hatte. Der Sergeant und sein Trainer stellten ihn klipp und klar vor die Alternative: Entweder fang an, dich wie ein zivilisierter Mensch zu benehmen, oder hau endgültig wieder ab nach Hackensack. Der Sergeant hatte allerdings das Gefühl, dass eine Warnung allein nicht genug sei, also plädierte er nachdrücklich dafür, dass Dominick sein gegenwärtiges Hauptfach, Sport, aufgeben und statt dessen Rechtskunde belegen sollte. Der Trainer pflichtete ihm bei. Diese Zusammenkunft an einem Sonntagnachmittag gab Dominicks Leben eine ganz neue Richtung.
Er schlug zwar immer noch ab und zu Krach, spielte weiterhin Football und war ein so ausgezeichneter Boxer, dass er 1969 die Bezirksmeisterschaft um den Goldenen Boxhandschuh im Schwergewicht gewann. Aber seine Einstellung hatte sich verändert. Er wusste jetzt, wer er war, und hatte seinen leichten Hang zum Kriminellen abgestreift. Dominick Polifrone sah sich nun als einer, der auf der richtigen Seite stand.
Genau das war es, was ihn als verdeckten Ermittler so herausragend machte. Er konnte reden wie ein Gauner, aussehen wie einer und sich so benehmen, weil all dies ein Teil von ihm war; aber tief im Innern wusste er, wo er hingehörte.
Daher machte sich Dominick auch keine weiteren Gedanken über seine Tarnung, während er zum Dunkin’ Donuts unterwegs war. Er wusste, dass er überzeugend wirkte. Nur dass er Richard Kuklinski allein und ohne irgendwelche Rückendeckung treffen würde, bereitete ihm leichtes Unbehagen.
So kurzfristig hatte er niemanden mehr vorher informieren können. Angeblich wartete Kuklinski auf ihn, und die Fahrt vom ›Laden‹ zu diesem Doughnut-Shop dauerte fünf Minuten. Wenn er zu lange brauchte, war Kuklinski verschwunden, das stand fest. Der Kerl war über alle Maßen vorsichtig. Beim geringsten Misstrauen würde er Leine ziehen, und Dominick konnte die Hoffnung abschreiben, ihn je wieder zu treffen. Diese erste Begegnung war ganz entscheidend. Innerhalb von fünf Minuten würde er wissen, ob die Sache klappen würde oder nicht. Vor allem kam es darauf an, die Kontrolle zu behalten. Auf keinen Fall durfte er vor ihm kriechen, ganz egal, wie sehr er darauf brannte, an ihn heranzukommen; sonst würde Kuklinski ihn für eine miese kleine Nummer halten und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Dominick tastete nach seiner Walther PPK 380 Automatik.
Trotz der milden Temperaturen war er wie immer mit einer Lederjacke bekleidet. Sie war sozusagen Teil seiner Uniform als Undercoveragent und ermöglichte es ihm, unauffällig eine Waffe zu tragen. In Anbetracht von Kuklinskis Ruf hatte er vor, seine Hand in der Tasche und den Finger am Abzug zu halten.
Vermutlich gingen Dutzende von Morden auf Kuklinskis Konto, aber der Polizei war es in keinem einzigen Fall gelungen, ausreichend Beweismaterial zusammenzutragen, um ihn zu verhaften. Dominick hatte das unbestimmte Gefühl, dass die ihnen bekannten Morde in Wirklichkeit nur ein Bruchteil der Taten waren, die Kuklinski verübt hatte. Allem Anschein nach war er auf sämtlichen Gebieten seines mörderischen Handwerks bestens bewandert.
Manchmal tötete Kuklinski allein, manchmal hatte er einen Helfershelfer dabei. Gelegentlich arbeitete er auf Bestellung; ein anderes Mal handelte es sich um eine persönliche Abrechnung. Zuweilen war es eine geschäftliche Angelegenheit, dann wieder blinde Wut. Es war bekannt, dass er kleine Waffen wie eine zweischüssige Derringer benutzt hatte, aber auch große wie eine zwölfkalibrige Flinte. Bei wenigstens zwei Gelegenheiten hatte er mit Handgranaten getötet. Er hatte Baseballschläger verwendet, Kreuzschlüssel, Seile, Drahtschlingen, Messer, Eispickel, Schraubenzieher, falls nötig sogar seine bloßen Hände. Und aus irgendeinem Grund, den niemand so recht erklären konnte, bewahrte er eines seiner Opfer über zwei Jahre lang tiefgefroren auf, ehe er sich die Leiche vom Hals schaffte, was ihm in Kreisen der Polizei von New Jersey den Spitznamen Iceman eintrug. Doch nach Erkenntnissen der State Police war eine der Lieblingsmethoden Kuklinskis die Vergiftung mit Zyankali. Dominick wusste aus seiner sechzehnjährigen Berufserfahrung, dass man niemals irgendeinen Kriminellen leichtfertig unterschätzen durfte, aber jemandem wie Richard Kuklinski war er noch nie zuvor begegnet. Er war kein wahnsinniger Serientäter, der zur Befriedigung eines abartigen sexuellen Verlangens mordete. Manchmal tötete er im Abstand von wenigen Wochen; manchmal dauerte es Jahre, bis er wieder zuschlug. Er rauchte nicht, trank nicht, spielte nicht und war nicht hinter Frauen her. Er passte einfach in kein herkömmliches Schema, und es war unmöglich, ihn zu beschreiben – außer mit dem einen Wort: Monster. Dominick atmete tief durch und nahm seine Hand aus der Tasche.
Vor ihm schaltete eine Ampel auf Rot. Er lenkte den schwarzen Shark rasch auf die linke Spur und hielt hinter einem Streifenwagen. Der Bulle am Steuer warf ihm im Seitenspiegel einen Blick zu. Dominick schaute zum Dunkin’ Donuts, das ein Stück weiter die Straße hinauf auf der anderen Seite der Kreuzung lag. Die verrücktesten Gedanken überkamen ihn plötzlich. Was war, wenn diese beiden Bullen beschlossen, ihn anzuhalten? Er hatte keinen Blinker gesetzt, als er nach links eingebogen war. Was war, wenn er auf die Beschreibung von irgendeinem Arsch passte, nach dem sie zufällig suchten? Dort drüben wartete Kuklinski. Wenn er sah, wie die Bullen ihn befragten, würde er wahrscheinlich abhauen. Schlimmer noch, er würde ihn für einen harmlosen Straßenganoven halten, irgendeinen Wichser, den die Bullen nach Lust und Laune herumschubsen konnten. An solch kleinen Nummern war Kuklinski nicht interessiert, und sicher hätte er sofort bei ihm verspielt. Dominick hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, ein Image aufzubauen, dass er jemand mit soliden Verbindungen zu den Mafia-Familien in New York war. Nach 17 Monaten harter Arbeit, in denen er sich mit dem miesesten Gesindel angefreundet hatte, wäre es zum Wahnsinnigwerden, wenn seine erste und bisher einzige Chance, endlich den Iceman zu treffen, platzte – und ausgerechnet auf diese Weise.
Der Bulle hinter dem Lenkrad musterte ihn immer noch im Seitenspiegel. Sein Partner drehte sich jetzt ebenfalls um und starrte durch das Sicherheitsgitter, das die Vordersitze vom hinteren Bereich des Streifenwagens trennte.
Dominick biss die Zähne zusammen: Nicht jetzt, Jungs. Bitte, nicht jetzt!
Die Ampel wurde grün. Der Verkehr auf der rechten Spur setzte sich in Bewegung, aber das Polizeiauto rührte sich keinen Millimeter. Der Fahrer beäugte ihn weiterhin. Allmächtiger, nicht jetzt! Dominick blickte zu dem bunten Reklameschild des Dunkin’ Donuts auf der anderen Seite der Kreuzung hinüber.
Bitte!
Er fixierte die Bremslichter des Streifenwagens und überlegte, ob er kurzerhand um ihn herumfahren sollte. Aber womöglich warteten die beiden bloß darauf, um ihn sich genauer anzuschauen, wenn er auf gleicher Höhe war, ehe sie ihn an den Straßenrand winkten. Gottverdammt! Irgendwas musste er tun. Mit dieser Ünschlüssigkeit machte er sich erst recht verdächtig.
Gerade als er sich entschlossen hatte durchzustarten, erloschen plötzlich die Bremslichter, und der Streifenwagen fuhr an. Dominick holte tief Luft, gab Gas und überquerte die Kreuzung. Er setzte den linken Blinker – der Doughnut-Shop war direkt vor ihm.
Nur drei Fahrzeuge standen auf dem kleinen Parkplatz: ein schwarzer Toyota-Kleinlaster mit grellrosa Scheibenwischern, ein beigefarbener VW Rabbit mit eingedellter Stoßstange und ein blauer Chevy Camaro, gute sechs oder sieben Jahre alt. Dominick hielt neben dem Camaro. Nach allem, was er über Kuklinski wusste, war nicht anzunehmen, dass er einen importierten Kompaktwagen fuhr.
Er stellte den Motor ab und schaute nach rechts. Ein großer, kräftig gebauter Mann saß hinter dem Lenkrad und war in eine Zeitung vertieft. Er war kahlköpfig bis auf das längliche graue Haar an den Seiten, das sorgfältig über seine Ohren gekämmt war, und trug einen gepflegten Vollbart, ebenfalls überwiegend grau, aber noch durchsetzt mit dem früheren Aschblond. Eine übergroße Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern verbarg seine Augen. Langsam wandte der Mann den Kopf und schaute zu ihm hinüber. Dominick kannte das Gesicht sehr gut. Auf Dutzenden von Überwachungsfotos hatte er es gesehen. Es war der Iceman.
Er hatte das instinktive Gefühl, nach seiner Waffe greifen zu müssen. Der Iceman musterte ihn kritisch, aber Dominick erwiderte seinen Blick scheinbar völlig unbefangen. Er musste von Anfang an, ehe sie auch nur ein einziges Wort wechselten, dafür sorgen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Ließ man einem Typen wie Kuklinski die Oberhand, riskierte man, lebendig gefressen zu werden.
Kuklinski schloss seine Zeitung, faltete sie zusammen und stieg aus dem Wagen. Dominick öffnete die Tür seines Lincolns und stieg ebenfalls aus. Erst jetzt merkte er, wie groß Kuklinski tatsächlich war. Mit seinen 1,83 m war er sich bisher noch nie klein oder auch nur mittelgroß vorgekommen, doch verglichen mit Richard Kuklinski wirkte er direkt schmächtig. In der Personenbeschreibung hieß es zwar: ›1,93 m, 270 Pfund‹, aber darüber las man einfach hinweg. Wenn man ihn vor sich sah, schien er wahrhaftig riesig.
»Richie?«, fragte Dominick.
Kuklinski nickte knapp und klemmte sich die Zeitung unter den Arm. »Willst du ’n Kaffee?«
»Klar.«
Kuklinski ging um den Shark herum und streckte ihm die Hand entgegen.
Dominick ergriff sie mit absichtlich ausdrucksloser Miene, um seine wahren Gefühle nicht nicht zu verraten. Er schüttelte die Hand eines Killers, eine Hand, die viele, viele Leben ausgelöscht hatte. Eigentlich hatte er einen festen, zupackenden Griff erwartet, statt dessen war er verblüffend sanft.
»Man nennt dich Dom?« Die weiche und leise, fast singende Stimme des Iceman passte zu seinem Händedruck.
»Ja, ist eine Abkürzung meines zweiten Vornamens.«
Kuklinski nickte, als denke er über etwas nach. »Nenn mich Rich.«
»Okay.«
Sie betraten das Dunkin’ Donuts, einen öden und menschenleeren Schuppen. Eine junge schwarze Kellnerin in einer beigefarbenen Uniform verteilte Doughnuts auf große Metalltabletts, die an der rückwärtigen Wand aufgereiht waren. Ein halbwüchsiger Latino in zerrissenen Jeans, der seine Haare zu einer Punkfrisur hochgetürmt und an den Seiten mit ausrasierten Mustern verziert hatte, verschlang einen Honig-Doughnut und schlürfte Limo aus einem Pappbecher. Im Hintergrund dudelte leise Instrumentalmusik.
Kuklinski deutete auf die Plätze am anderen Ende der Theke, so weit wie möglich von der Kellnerin und dem Jungen entfernt. Er wollte keine unbefugten Lauscher, was ›Michael Dominick Provenzano‹ nur recht war.
Die Kellnerin kam zu ihnen. »Kann ich Ihnen was bringen?«
»Ja, zwei Kaffee«, sagte Dominick und schaute zu Kuklinski.
»Willst du ’n Doughnut oder so was?«
»Ich nehme ein Zimtbrötchen, wenn’s das gibt.«
Das Mädchen nickte. »Für Sie auch, Sir?«, fragte sie Dominick.
Er überlegte eine Sekunde und schüttelte dann den Kopf. Normalerweise hätte er sich einen einfachen Doughnut oder irgendeine Kleinigkeit bestellt, aber als er Kuklinskis Taillenumfang sah, änderte er seine Meinung. Dominick achtete darauf, in Form zu bleiben. Er joggte möglichst jeden Tag und ging regelmäßig in ein Fitnessstudio, doch sobald er etwas nachlässiger wurde, schien er über Nacht zehn Pfund zuzulegen, und die Arbeit als verdeckter Ermittler förderte nicht gerade eine gesunde Lebensweise. In seiner Rolle als Michael Dominick Provenzano verbrachte er fast neunzig Prozent seiner Zeit damit, irgendwo herumzuhängen, Kaffee zu trinken, Dreck zu essen und Scheiße zu reden.
Verstohlen beobachtete er Kuklinski. Mit seinem gepflegten Bart sah er aus wie ein böser Herrscher aus irgendeinem mythischen Königreich, der bedächtig den nächsten mörderischen Schachzug abwägte. Dominick wusste, dass er nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen durfte. So lief es in diesem Milieu nicht. Sie mussten einander zuerst abtasten, sich umkreisen wie Boxer in der ersten Runde und belanglosen Blödsinn reden.
»Immer gut zu tun, Rich?«
Kuklinski nickte. »Ja, mal hier was, mal da was. Wie ist es mit dir?«
»Na, es läuft. Könnte allerdings auch gern besser sein. Ich weiß, dass ich wohl kaum den Haupttreffer im Lotto landen werde, also muss ich selbst zusehen, wo ich bleibe. Du verstehst, was ich meine?«
»Klar.«
Kuklinski schien in seiner Zeitung, die er zusammengefaltet neben sich auf die Theke gelegt hatte, zu lesen und gab sich betont gleichgültig. Die Kellnerin brachte zwei Becher Kaffee und ein Zimtbrötchen von der Größe einer Untertasse. Er öffnete die Aludeckel von zwei Milchtöpfchen und goss den Inhalt in seinen Kaffee. Dominick rührte in seinem Becher und nahm einen Schlucke.
»Wie gefällt dir der Lincoln?«, meinte Kuklinski und deutete zum Fenster auf den draußen geparkten Shark.
»Ganz gut. Ich hatte früher einen Eldorado, aber mir ist der hier lieber. Fährt sich besser.«
Kuklinski biss in sein Zimtbrötchen. »Stimmt. Der Lincoln ist kein schlechtes Auto. Komfortabel und geräumig.«
Sie redeten eine Weile über Autos, verglichen verschiedene Modelle, mit denen sie ihre Erfahrungen gemacht hatten, und diskutierten darüber, warum so viele reiche Leute statt Caddys und Lincolns lieber einen Mercedes fuhren. Es ging alles sehr freundlich zu. Dominick hatte die Chance, sich zu entspannen und sich an sein Gegenüber zu gewöhnen, aber schließlich entschied er, es sei Zeit, zur Sache zu kommen, als er eine Gelegenheit sah, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Also, ein Auto, mit dem ich mich nie anfreunden konnte, war die Corvette. Der Stingray, weißt du? Ich hatte immer das Gefühl, als säße ich in diesen verdammten Dingern direkt auf dem Boden. Lenny hat so eins, und er ist begeistert davon, aber ich kann wirklich nichts daran finden.«
Kuklinski schwieg einen Moment, kaute nur und nippte an seinem Kaffee. »Ist kein schlechtes Auto.«
Dominick wusste aus den Polizeiberichten, dass Kuklinski in der Vergangenheit gestohlene Corvettes gefahren hatte. Das war vermutlich der Grund, weshalb er nicht allzu offenkundig seine Begeisterung für dieses Modell äußerte. Er wusste noch nicht, wie er ihn einschätzen sollte. Dominick musste weiterreden und hoffen, dass er irgendeine gemeinsame Basis fand, um allmählich ein wenig sein Vertrauen zu gewinnen und einen Schritt weiterzukommen. Er beschloss, einen kleinen Vorstoß zu machen.
»Ja, dieser Lenny, das ist schon einer, was?«
»Stimmt.« Kuklinski schaute wieder gleichgültig hinab auf seine Zeitung.
Wenn er nicht bald einen Draht zu ihm bekam und er wenigstens ein kleines bißchen auftaute, konnte er die ganze Sache genausogut gleich vergessen. Aber Dominick hatte im Moment keine Ahnung, wie er vorgehen sollte. Eigentlich hatte er gedacht, Kuklinski würde auf die Erwähnung von Lenny DePrima reagieren. Angeblich vertraute er diesem Kerl doch.
Dominick nahm einen Schluck Kaffee. Er musste sich etwas anderes einfallen lassen. Wenn er dauernd auf diesem Namen herumritt, dachte der Iceman möglicherweise, er sei ein Niemand, der mit dem einzig echten Kontakt prahlte, den er hatte. An Möchtegerns war Kuklinski nicht interessiert. Er würde beim kleinsten Anzeichen einfach gehen und nie wieder etwas mit ihm zu tun haben wollen. Dominick war klar, dass er aufpassen musste, auch wenn er noch so darauf brannte, mit diesem Kerl eine Verbindung anzuknüpfen.
Nur um das Gespräch nicht abreißen zu lassen, wollte er gerade über das Spiel der New York Giants reden, bei dem sie letzten Sonntag die Steelers geschlagen hatten. Vielleicht war er ja ein Fan und taute etwas auf. Aber dann nahm Kuklinski plötzlich die Sonnenbrille ab und schaute ihm in die Augen.
Ruhig erwiderte Dominick seinen Blick. Auf keinen Fall durfte er irgendwie unterwürfig wirken, sonst konnte er gleich einpacken. Er hatte sich bereits vorgenommen, nach der Rechnung zu greifen, sobald die Kellnerin damit kam, um jeden Eindruck zu vermeiden, er ließe sich freihalten.
»Wie ich höre, hast du so einige Verbindungen, Dom.«
»Ja, hab ich wohl.« Er nippte an seinem Kaffee, ohne diesem kühlen Blick auszuweichen.
Kuklinski senkte seine Stimme. »Kannst du Schnee besorgen?« Dominick musterte ihn einen Moment lang bedächtig.
»Reden wir von dem billigen Zeug oder dem teuren?« Kokain oder Heroin.
»Dem billigen.«
Er zuckte die Schultern. »Kann sein. Wie viel willst du?«
Kuklinski schien zu überlegen. »Zehn. Vielleicht später mehr.«
»Klar, ist machbar.«
»Wie viel pro?«
Dominick strich nachdenklich über seinen Schnurrbart.
»Einunddreißigfünf.« 31500 Dollar für ein Kilo.
Kuklinski nickte. »Bisschen happig, Dom. Ich kenne jemanden, von dem ich’s für fünfundzwanzig bis dreißig kriegen kann.«
»Dann besorg dir’s dort und verschwende nicht meine Zeit«, fauchte Dominick. Er würde nicht feilschen, damit Kuklinski nicht dachte, er sei auf den Deal angewiesen. Es war wichtig, dass er sich keine Blöße gab, selbst wenn er riskierte, ihn vor den Kopf zu stoßen. An diese Politik hatte er sich bisher immer strikt gehalten.
Kuklinski riss ein Stück von seinem Zimtbrötchen ab und steckte es sich in den Mund. Dominicks Haltung schien ihn keine Sekunde aus der Ruhe zu bringen. »Wie ist es mit Zyankali?«
»Was?« Dominick blieb fast das Herz stehen. Er wünschte verzweifelt, er wäre besser vorbereitet gewesen und trüge ein verstecktes Mikro bei sich.
»Zyankali. Kommst du an so was ran?«
»Machst du Witze? Wenn du Zyankali brauchst, geh in einen Laden und besorg dir irgendein Rattengift. Da kriegst du so viel, wie du willst.«
Kuklinski schüttelte den Kopf. »Nicht diesen Kram. Ich brauche reines Zyankali, Laborqualität. Solches Zeug, für das man unterschreiben muss, wenn du es irgendwo kaufen willst.«
»Wozu brauchst du das?«
»Eine persönliche Angelegenheit.«
Dominick zuckte die Schultern, als sei ihm absolut gleichgültig, was Kuklinski mit reinem Zyankali anstellen wollte, aber tatsächlich konnte er kaum glauben, dass er so geradeheraus und bei ihrem allerersten Treffen danach gefragt hatte. Er stand in mehreren Fällen unter Verdacht, seine Opfer mit Zyankali vergiftet zu haben. Man nahm sogar an, dass es eine seiner Lieblingsmethoden war. Dominick hätte ein derartiges Glück nie erwartet, und schon gar nicht so schnell. Doch dann packte ihn Misstrauen. Warum fragte Kuklinski ausgerechnet ihn nach Zyankali? Sie hatten sich gerade erst kennengelernt. Und warum konnte er es sich nicht selbst besorgen? Allem Anschein nach hatte er früher nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, an das Zeug heranzukommen. Benötigte er es wirklich so dringend? Und wen wollte er damit erledigen?
»Also, kannst du es mir besorgen, Dom?«
»Ja, klar. Ich kenne da jemanden, bei dem ich ganz sicher was kriegen kann. Wie viel willst du?«
»Nicht viel. Man braucht nur ziemlich wenig von dem Zeug.«
»Ein kleiner Klecks wäre dir genug?«
»Jawohl.« Kuklinski riss ein weiteres Stück von seinem Zimtbrötchen ab. »Ich will dir was sagen, Dom. Du siehst zu, ob du mir das Zeug beschaffen kannst, und in der Zwischenzeit nehme ich dir zehn von dem weißen Pulver ab.«
»Zu welchem Preis?«
»Wie du gesagt hast – einunddreißigfünf.«
»Ich dachte, du kriegst es woanders für fünfundzwanzig?«
»Ja, wahrscheinlich, aber dieser Kerl ist ein Schwachkopf. Er ist mir etwas zu leichtsinnig in seinem Geschäft, und ich mag keine Leute, die unvorsichtig sind. Du verstehst?«
»Absolut. Solche Burschen taugen nichts. Sind nur ein unnötiges Risiko.«
»Genau.«
Dominick winkte der Kellnerin, noch etwas Kaffee zu bringen.
»Hör zu, Rich, da ist etwas, bei dem du mir vielleicht helfen kannst.« Er beugte sich dichter zu ihm und senkte die Stimme: »Ich habe einen Käufer, der schweren Ballerkram sucht. Keine Spielsachen, sondern Militärqualität, Maschinengewehre, Granaten, Raketenwerfen, solches Zeug; auch Schalldämpfer. Kleinkalibrige Waffen mit Schalldämpfer.«
»Also Profiausrüstung.«
»Richtig.«
Kuklinski hob eine Augenbraue. »Was hat er vor? Irgendwo einen Putsch anzetteln?«
Dominick warf ihm einen wütenden Blick zu. »Wenn du mich aushorchen willst, vergiss die Sache.«
»He, nicht so hitzig. Ich will gar nicht wissen, wer dein Käufer ist. Ich würde nie versuchen, dich übers Ohr zu hauen und hinter deinem Rücken das Geschäft selbst zu machen. So arbeite ich nicht.«
»Gut. Also, kannst du mir dabei helfen?« Dominick war erleichtert und gleichzeitig dankbar, dass er nicht beleidigt war über seine hitzige Antwort. Kuklinskis Frage gehörte sich nicht, und das wusste er selbst. Seine Reaktion war vollkommen richtig gewesen.
»Sag mir nur eines, Dom. Will dein Käufer diese Waren geliefert haben, oder wäre er bereit, sie abzuholen?«
»Muss geliefert werden. Nach New York.« Dominick hatte bereits eine passende Story ausgetüftelt. Er kaufte für die Irish Republican Army, und seine üblichen Quellen konnten ihm das Gewünschte nicht in der benötigten Menge verschaffen. Aber das hatte noch Zeit. Im Moment ging es Kuklinski nichts an.
»Hm …«, Kuklinski strich sich über den Bart, »nach New York. Das könnte die Sache vielleicht ein wenig erschweren.«
»Es ist aber nicht für New York bestimmt, sondern geht woanders hin.«
»Und sie können es nicht abholen? Zum Beispiel in Delaware?« Dominick schüttelte den Kopf. »Darauf lassen sie sich bestimmt nicht ein. Ich kenne diese Leute. Entweder wird’s geliefert, oder die Sache platzt.«
»Gute Kunden?«
»Die besten. Sie zahlen erstklassig und stellen keine neugierigen Fragen. Geschäfte mit ihnen laufen immer reibungslos.«
»Klingt nicht schlecht.«
»Wie gesagt, bessere Kunden gibt’s nicht. Wenn du mir das Passende besorgen kannst, wäre eine Menge Geld drin – für uns beide.«
Kuklinski lachte. »Dagegen ist nichts einzuwenden, mein Freund.«
»Ich kann dir fast eine Garantie darauf geben, und es geht hier nicht um Kleinkram. Das wird eine dicke Bestellung, die sich lohnt.« Dominick wusste, dass der Köder verlockend genug sein musste, sonst würde Kuklinski nicht anbeißen.
»Nur eine Frage. Deine Kunden in New York, haben die irgendwas mit der Mafia zu tun?«
Dominick schüttelte den Kopf. »Ich kaufe ab und zu auch für solche Typen. Aber das hier ist was anderes, hängt nicht mit den Familien zusammen.«
Kuklinski nickte. »Ich denke, ich kann dir den Kram beschaffen. Muss nur ein paar Anrufe erledigen, um zu sehen, was so auf dem Markt ist. Ich sag dir dann Bescheid.«
»Okay, prima. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Diese Leute warten nicht gern und suchen sich lieber eine andere Quelle.«
»Keine Sorge. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Sag mir nur, wie ich mit dir in Verbindung treten kann.«
Dominick zog einen Stift aus seiner Brusttasche und schrieb einige Zahlen auf eine Papierserviette. »Hier, das ist die Nummer meines Piepers. Du kannst deine Nummer eingeben, und ich rufe dich nach ein paar Minuten zurück.«
»Prima.«
»Also, wie gesagt, besorg die richtige Ware, und es springt eine Menge Knete für uns beide raus. Glaub mir.«
»Ich glaub dir, Dom. Aber vergiss nicht die Sachen, die ich haben will.«
»Keine Sorge, mein Gedächtnis ist tadellos, Rich. Zehn von dem weißen Pulver und das Rattengift.«
»Ich brauche reines Zeug!«
»Schon klar, Rich. Hab’s kapiert.«
Die Kellnerin kam mit einer Kaffeekanne zu ihnen und füllte ohne zu fragen ihre Tassen auf.
»Danke, Schätzchen«, nickte Dominick. »Wie wär’s, Rich, willst du noch ’n Happen? Nur zu, ich spendier’s dir.«
Ein langsames Grinsen überzog Kuklinskis Gesicht. »Sicher, warum nicht?«