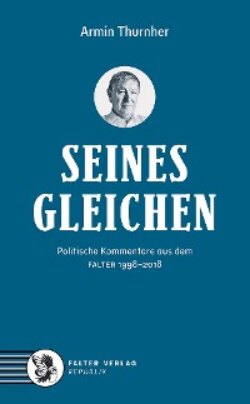Читать книгу Seinesgleichen - Armin Thurnher - Страница 8
Land der Rutsche
ОглавлениеSommer 1999. Es riecht so stark nach Machtwechsel in Österreich, dass das Land selbst in Bewegung zu kommen scheint. Die Berge geraten ins Rutschen.
Ist es wirklich erst ein Jahr her, dass sich die steirische Erde öffnete und elf Bergleute verschlang? Dass die Luftblase Gottes angebohrt wurde, darin der Bergmann Hainzl11 saß, zehn Tage jausenlos im Jausenraum überlebend? Ist es wirklich erst ein halbes Jahr her, dass in Galtür die Lawinen niedergingen und ein halbes Dorf begruben? Dass von den Überlebenden die Hälfte News12-Abonnenten waren, die am Handy Auskunft über die Katastrophe gaben? Leckt nicht noch immer der Bodensee hoch an seinen Ufern? Und jetzt Schwaz.
Ist ja nichts passiert, sagen Sie. Alles rechtzeitig evakuiert. Gefahr erkannt, tausend Kubikmeter Gestein vom Eiblschrofen abgestürzt, aber in eine Schneise gepoltert, die am bewohnten Gebiet vorbeiführte. Krisenstab einberufen. Bergrettung ausgeschickt. Landesgeologe mit Hubschrauber aufgestiegen. Keine weitere Gefahr. Bürgermeister untersagt weiteren Abbau von Dolomitgestein … Aha – Abbau! Der Mensch hat den Eiblschrofen durchlöchert, wie er auch den Lassinger Talk untergraben hat; so weit wäre alles klar. Unser prometheischer Übermut wieder einmal. Nur die Galtürer Lawinen hat er nicht ausgelöst, nicht einmal mit dem umfassenden ökokatastrophischen Verdacht erklären wir die ausreichend.
Ich aber sage euch: Lasst euch weder einlullen von denen, die da sagen, der Mensch war es oder gar der Minister ist schuld, noch von denen, die da mahnen „Risikogesellschaft“ oder: „Wer sich unter den Schrofen begibt, kommt darin um.“ Lasst euch nicht beruhigen! Vielleicht geht etwas ganz anderes vor sich: Österreich rutscht weg. Ende der Neunzigerjahre haben wir keine gesellschaftlichen Skandale mehr, oder wir merken es nicht, weil sie Allgemeingut aller Parteien geworden sind.
Die gesellschaftliche Normalisierung hat gegriffen, bald werden wir merken, dass wir Europäer sind, es wird keine zehn Jahre mehr dauern, dass wir uns von liebgewonnenen Eigenheiten verabschieden. Noch spüren wir bloß halbbewusst, dass etwas rutscht, noch klammern wir uns an Sozialpartnerschaft und Neutralität, an Selbstmordrate und Schilling. Damit ist bald Schluss. Dafür haben wir Naturkatastrophen. Sie gewöhnen uns an einen gleitenden Zustand.
Mehr Mobilität ist angesagt. Wenn schon die Wirtschaftsmächte nur als Naturmächte erscheinen, es aber nicht sind, so können uns Naturkatastrophen doch zumindest auf Änderungen im verfestigten Befinden einstimmen: einbrechende Wiesen, die sich in klaffende Grundwasserseen verwandeln und Menschen und Häuser schlucken. Zu Tal brausende Schneemassen, die hinstürzen, wo sie noch niemals hingestürzt waren. Hochwässer, die das Land überspülen. Abbrechende Gesteinsmassen, sich öffnende Felsspalten, Berge in Bewegung …
„Wo ist die Behörde?“, rufen empört die Österreicher, die auch noch über die Apokalypse eine Dienstaufsichtsbeschwerde verfassen würden. Eine schwache, aber erprobte Reaktion: Immer sind die Bürokraten schuld. Sie enthalten dem Bürgermeister die Pläne vor, den geologischen Fachmann fordern sie nicht an, den ausländischen Experten schätzten sie gering. Es musste erst Fels stürzen, dass denen jemand zugehört hat.
In Lassing haben sie uns auch im Stich gelassen, noch immer sind die Bergleute nicht geborgen, erst nach den nächsten Wahlen werden sie uns die Wahrheit sagen. Was sind die Skandale am Ende der Achtzigerjahre gegen die Katastrophen der ausgehenden Neunzigerjahre? Damals ging es der Nachkriegszeit an den Kragen, unter Verwerfungen verabschiedete sich eine Epoche. Von AKH bis Noricum, von Glykol bis Lucona, von VÖEST bis Frischenschlager-Reder13 begann der lange Abschied vom Zweiparteienstaat.
Udo Proksch14 wurde verurteilt, Minister erschossen sich oder traten zurück. Illegale Kanonenexporte, Steuerskandälchen, Kleinkorruption und dazu noch Kurt Waldheim15, der katastrophische Wendepunkt der Zeitgeschichte – das war’s mit den Achtzigern. Das konnte man sich erklären. Ein Land wollte zu sich kommen, nicht übermäßig korrupt sein, sich seiner Geschichte stellen. Damit konnte man leben, das alles ließ sich bewältigen und wurde bewältigt.
Aber die Berge, die Böden und die Gewässer, die sind schon etwas anderes. Vor allem, weil sich dieses Land ja nicht über seine politische Öffentlichkeit und schon gar nicht über sein Bewusstsein von Zeitgeschichte definiert, sondern über seine Landschaft. „Das Gebirge ist gegen die Menschen“ (Thomas Bernhard), aber die Menschen sind für das Gebirge. Im sogenannten Symbolhaushalt der Österreicher steht die Landschaft an erster Stelle, und innerlandschaftlich halten – man möchte sagen, naturgemäß – die Berge die Spitze.
Wir Österreicher halten an unseren Bergen fest und besteigen sie, wie wir wollen. Berge sind Kultstätten, Begräbnisstätten, Fotolocations für Politiker und Stätten des Fremdenverkehrs. Dass nun dem fleißigen Völkchen davonrutscht, was es am meisten verehrt, ist nicht besonders gerecht. Auch der Fluss tritt über die Ufer, wenn man es am wenigsten braucht, und der liebliche Bodensee hat seine Anrainer erschöpft, indem er sie das Schöpfen lehrte. Der Berg ist in Bewegung. Kommt jetzt, weil der Prophet nicht zum Berg kommt, der Berg zum Propheten? Wer wäre dieser? Und was würde er uns prophezeien? Der Berg kommt nicht zur Ruhe. Bergbau bleibt ein Risiko, wie das Leben. Aber müssen wir dauernd daran erinnert werden? Die Anrainer artikulieren deutlich ihre Gefühle. Was ist los mit Österreich? Land der Bergrutsche? Im Übrigen bin ich der Meinung, die Mediaprint muss zerschlagen werden.
Falter 28/99 vom 14.7.1999