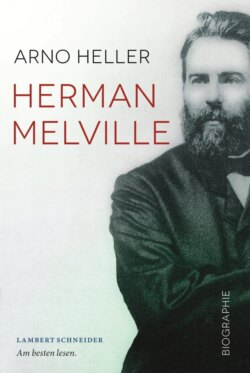Читать книгу Herman Melville - Arno Heller - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unter den Kannibalen – Typee
ОглавлениеDer Marquesas-Archipel 1600 km nordöstlich von Tahiti ist seit über 2000 Jahren von polynesischen Stämmen besiedelt. Nukuhiva, eine seiner Hauptinseln, ist wegen ihres vulkanischen Ursprungs gebirgig und stark zerklüftet mit tief eingeschnittenen Tälern und spektakulären Wasserfällen. Außer an den Flussmündungen gibt es keine nennenswerten Küstenebenen. Die künstlich angelegten Terrassen an den Talrändern, alte Kultstätten mit überlebensgroßen steinernen Götterfiguren sowie eine gediegene Holzschnitzkunst zeugen von einer hochentwickelten Kultur. Am Ende des 16. Jahrhunderts hatte der spanische Seefahrer Alvaro de Mendana von Peru aus die Inselgruppe entdeckt. Er pries ihre landschaftliche Schönheit und gab ihr den Namen des kolonialen Vizegouverneurs Marqués de Mendoza. Wegen ihrer Abgelegenheit wurde sie jedoch bald vergessen und erst 200 Jahre später von James Cook auf seiner zweiten Weltumsegelung im Jahr 1774 wiederentdeckt. Er berichtete begeistert von ihrer üppigen Tropenlandschaft und den stattlichen, tätowierten Bewohnern. Lange Zeit dienten die Marquesas als Zwischenstopp und Handelsposten für Walfänger. 1813 ging das amerikanische Kriegsschiff Essex unter Commodore David Porter vor Nukuhiva vor Anker, um in den Hafenbuchten koloniale Stützpunkte zu gründen. Aber sein zweimaliger Versuch, mit Hilfe feindlicher Nachbarn in das Tal der Taipis einzudringen, scheiterte an deren erbittertem Widerstand. Porter hielt sich sechs Wochen auf Nukuhiva auf und schrieb einen ausführlichen Bericht über die Lebensformen und religiösen Bräuche der Eingeborenen – ein Werk, das Meville als wichtige Informationsquelle für seinen Roman diente.
Im jahrelangen Tauziehen zwischen den USA, Großbritannien und Frankreich um die Vorherrschaft in Polynesien gewannen schließlich die Franzosen die Oberhand. Wenige Wochen bevor die Acushnet in Nukuhiva ankerte, hatte der französische Admiral Dupetit-Thouars die Insel und ihre ca. 80.000 Bewohner mit seiner Fregatte La Reine Blanche, sechs weiteren Kriegsschiffen und 4000 Soldaten als Protektorat für die französischen Krone in Besitz genommen. Die Flotteneinheit hatte den Auftrag, unverzüglich mit dem Bau eines Forts zu beginnen, die Insel zu einem Gefängnisort für die Deportation politischer Gefangener auszubauen und katholische Missionsstationen zu errichten. Obwohl Melville zum diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, dass die kolonialistische Vereinnahmung innerhalb weniger Jahrzehnte zur Vernichtung der polynesischen Kultur und zur Reduktion der indigenen Eingeborenen auf einen Bruchteil der ursprünglichen Bevölkerungszahl führen würde, übt er in Typee leidenschaftlich Kritik an dem, was er wahrnahm. In einer Zeit, da seine amerikanischen Zeitgenossen auf dem Hintergrund der Westexpansion und der Indianerkriege noch überwiegend von der Überlegenheit der „weißen Rasse“ überzeugt waren und koloniale und missionarische Besitzergreifungen als zivilisatorischen Fortschritt betrachteten, war Melville seiner Zeit voraus und nahm eine ablehnende Haltung ein.
Im Roman ist der Name des realen Schiffes Acushnet gegen Dolly ausgetaucht und auch der Kapitän heißt nun nicht Pease, sondern Vangs. Während der Fahrt entlang der Küste von Nukuhiva im 2. Kapitel wächst die Begeisterung des Ich-Erzählers Tommo über die paradiesische Landschaft, die sich vor seinen Augen ausbreitet:
Blühende Täler, tiefe Schluchten, Wasserfälle und rauschende Wälder zogen an uns vorüber und verbargen sich hier und da hinter felsigen Vorgebirgen, die uns jeden Augenblick neue, überraschend schöne Landschaften erschlossen.
Steile Felsküsten, deren mächtige Klippen die Brandung umtost, ab und zu tiefe Buchten, durch die man einen Blick auf dicht bewaldete Täler erhält, dazwischen die Ausläufer des Gebirges mit ihren üppigen Grasdecken, die sich von dem hohen zerklüfteten Inneren nach dem Meere zu senken – das sind die charakteristischen Züge dieser Inseln. (T, 25)
Noch romantischer gestaltet er die Ankunft in der Hafenbucht der Insel. Eine Flottille von Kanus, beladen mit Kokosnüssen und Bananen, nähert sich dem Schiff, und Scharen von jungen nackten Insulanerinnen, für die Kanus tabu sind, schwimmen an das Schiff heran und klettern an Bord:
Wir waren immer noch ein Stück von der Küste entfernt und hatten nun langsame Fahrt, als wir mitten in diese schwimmenden Nymphen hineinsegelten und sie uns von allen Seiten enterten. […] Zu guter Letzt gelang es allen, an den Schiffswänden hochzukommen, wo sie sich festklammerten – das Meereswasser lief an ihnen herunter, und sie glühten vom Bad. Das Haar, schwarz wie Ebenholz, fiel ihnen über die Schultern und verhüllte halb ihre sonst nackten Gestalten. Dort hingen sie und sprühten vor wilder Lebhaftigkeit.
Ich betrachtete sie voller Verwunderung: Ihre große Jugend, das helle, reine Braun der Haut, die feinen Züge und unsagbar anmutigen Figuren, die sanft gerundeten Glieder und das freie ungekünstelte Betragen waren seltsam und schön zugleich. (T, 29 – 30)
Am Abend findet an Bord ein Festgelage mit Lampions, Tanz und viel Alkohol statt und steigert sich zu einer Orgie. Da Melville als Autor fürchten musste, von seinen Lesern eines unmoralischen Verhaltens bezichtigt zu werden, gestaltet er Tommo als einen jungen Puritaner, der etwas abseits stehend das Treiben fasziniert, aber gleichzeitig aus moralischer Distanzierung verfolgt:
Unser Schiff gab sich nun völlig jeder Art von Lust und Ausschweifung hin. Nicht die geringste Schranke bestand noch zwischen den frevelhaften Begierden der Mannschaft und ihrer restlosen Befriedigung. Während der ganzen Zeit unseres Aufenthalts waren schlimmste Zügellosigkeit und schamlose Trunkenheit an der Tagesordnung und nur gelegentlich gab es eine kurzfristige Unterbrechung. Ach, die armen Wilden, die unter diesen verderblichen Einfluss geraten! Arglos und vertrauensvoll lassen sie sich leicht zu jedem Laster verführen, und die Menschheit weint über das Unheil, das ihre europäischen Zivilisatoren so gewissenlos über sie bringen. (T, 30)
Keine Episode des Romans hat so viel Aufsehen erregt wie diese und keine wurde einer stärkeren Zensur unterworfen. Die Verleger tilgten neben missionskritischen Stellen viele der als zu freizügig erachteten Passagen. Melville musste sich notgedrungen dieser Revision unterwerfen und gab in einem Schreiben an den englischen Verleger – in ironischer Anpassung an dessen Wünsche – sein Einverständnis:
Das Buch ist als Lektüre für das Volk gedacht, oder für niemanden. – Trifft das erstere zu, nun so sind alle Stellen, welche den Geschmack oder die Gefühle irgendeiner größeren Zahl von Lesern verletzen, mit Sicherheit als unerwünscht anzusehen. […]
Solche Stellen haben mit der Abenteuerhandlung nichts zu tun, und ob sie auch heutzutage für mache von zeitweiligem Interesse sein mögen, wird ihre Streichung doch, was die breite und dauerhafte Popularität des Werkes betrifft, sich zweifellos als segensreich erweisen. (S/G, 64)
All dies konnte jedoch nicht verhindern, dass viele Kritiker nach dem Erscheinen des Buches den Autor als wollüstigen Voyeur verunglimpften, der sich möglicherweise nur aus Angst vor einer Geschlechtskrankheit von dem anrüchigen Treiben zurückhielt. Andere stellten das Geschilderte überhaupt als ein sensationsheischendes Phantasieprodukt in Frage. Die Ironie dabei ist, dass gerade obige Episode zu den in den Sekundärquellen am meisten belegten Abschnitten des Romans gehört. Elf Tage nach der Acushnet lief die Potomac aus Nantucket in den Hafen ein und berichtet in einer Logbucheintragung über dasselbe Ereignis mit lakonischer Nüchternheit: „Die Decks füllten sich mit Kanaken, die meisten von ihnen Mädchen, die wie ein Schildkrötenschwarm daherschwammen“ (Heflin, 128). Dass es sich dabei im Grunde um eine gewohnheitsmäßige touristische Attraktion handelte, geht aus dem schon 38 Jahre früher geschriebenen Expeditionsbericht Voyages and Travels in Various Parts of the World (1804) des deutsch-russischen Kapitäns Georg von Langsdorff hervor. Auch er berichtet, bei der Ankunft in Nukuhiva von einer Invasion von Insulanerinnen empfangen worden zu sein, die „auf die freizügigste und ungenierteste Weise ihre Reize anboten“ (Heflin, 129). Melville benutzte diese Quellen ausgiebig zur Ausschmückung seiner eigenen Schilderung. Möglicherweise erinnerte er sich dabei auch an die Kaminfeuer-Erzählungen seines Onkels Kapitän John D’Wolf, der in jungen Jahren an Langsdorffs Expedition teilgenommen hatte.
Bei ihrem zweiten Landgang während eines tropischen Gewittersturms setzen der Ich-Erzähler Tommo und sein Kamerad Toby ihren am Schiff ausgeheckten Desertionsplan in die Tat um. Sie umgehen die koloniale Betriebsamkeit der Franzosen und versuchen, sich so schnell wie möglich aus der für sie gefährlichen Nähe zur Dolly zu entfernen. Ihr Ziel ist, über eine Bergflanke ins benachbarte Tal der als friedlich bekannten Happar zu gelangen, um in deren Hafenbucht ein anderes Schiff zum Anheuern ausfindig zu machen. Es kommt jedoch anders als geplant, wie Tommos fiktiver Bericht dem Leser glaubhaft macht. Obwohl das angestrebte Tal in Wirklichkeit nur sechs Meilen von der Hafenbucht entfernt liegt und unter normalen Verhältnissen in vier Stunden auf Eingeborenenpfaden erreicht werden kann (Anderson, 114), weitet Tommo das Unternehmen zu einer spannenden, sich über fünf Kapitel hinziehenden Horrorgeschichte aus. Die beiden erklimmen steile Bergflanken, queren ausgesetzte Höhenrücken, bahnen sich mühsam den Weg durch das Rohrdickicht und steigen durch schwindelerregende Abgründe an Wasserfällen entlang in tiefe Schluchten ab. Da sie weder über eine ausreichende Ausrüstung noch über genug Proviant verfügen, leiden sie in den feuchten Nächten an Kälte, Hunger und Durst. Tommo/Melville zieht sich eine infektiöse Beinverletzung zu, wird fast gehunfähig und leidet unter Schüttelfrösten und Fieber. Nach fünf mörderischen Tagen und Nächten stoßen sie schließlich in einem weiten Tal auf Eingeborene. Zu ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass sie nicht bei den friedfertigen Happars, sondern bei den wegen ihres angeblichen Kannibalismus berüchtigten Taipis gelandet sind.
Die dörfliche Lebenswelt, die sie betreten, ist zu ihrem Erstaunen eine völlig andere als die in ihren Angstvorstellungen ausgemalte. Statt Gräuelgeschichten erleben sie eine heitere Bukolik, wie sie Gauguin ein halbes Jahrhundert später in seinen Südseebildern malte: Das üppig grüne Tal mit seinen Kokospalmen, Orangenhainen, Brotfrucht- und Bananenbäumen entpuppt sich als ein friedliches Paradies mit glücklichen, gastfreundlichen, halbnackten oder leicht bekleideten Menschen. Sie treten den beiden Fremdlingen in einer Mischung aus Neugier und Fürsorglichkeit entgegen, bewirten sie mit köstlichen Speisen und Früchten und versuchen, Tommo mit Heilkräutern und Bädern zu kurieren. Dennoch verheilt die Beinwunde nur langsam, und der ursprüngliche Plan der beiden Kameraden, das Tal so schnell wie möglich wieder zu verlassen und an der Küste auf einem anderen Schiff anzuheuern, zerschlägt sich. Nach einer Woche bricht Toby, begleitet von einigen Stammesangehörigen, zur Küste auf, um Medikamente zu besorgen und Erkundungen über einlaufende Schiffe einzuholen. Aber er kehrt nicht mehr zurück und Tommo bleibt allein bei den Taipis. Der Häuptling nimmt ihn in sein Haus auf und sein Sohn Kory-Kory fungiert als eine Art Leibdiener, der ihm jeden Wunsch von den Augen abliest. Er füttert Tommo, trägt ihn auf seinem Rücken zum Baden in einem nahen See und verbringt die Nächte an seiner Seite. Gleichzeitig umschwärmen und umtanzen junge blumengeschmückte Mädchen den bärtigen Fremdling mit neckischem Gelächter und unverhohlenem Interesse: „Sie schwingen ihre gleitenden Gestalten, biegen den Nacken, werfen die bloßen Arme in die Luft, fliegen, schweben und wirbeln, dass es für einen ruhigen, besonnenen, schüchternen jungen Mann wie mich fast zu viel wurde“ (T, 208). Fayaway, ein auffallend schönes Mädchen, wird Tommo zur Pflege zugeteilt:
Der schönen Nymphe Fayaway, die mein erklärter Liebling war, gebührt ein besonderer Platz. Ihre biegsame Gestalt war der Inbegriff weiblicher Schönheit und Anmut. Ihr Teint war dunkelolivfarben. […] Das rundlich ovale Gesicht war in jedem einzelnen Zug so vollendet, wie es sich das Herz oder die Phantasie eines Mannes nur wünschen kann […] Ihr dunkelbraunes Haar war in der Mitte unregelmäßig gescheitelt und floss in natürlichen Locken über ihre Schultern, und sooft sie sich neigte, fiel es über ihren lieblichen Busen und verhüllte ihn. Schaute man ihr tief in die merkwürdigen blauen Augen, wenn sie sich gerade in einer nachdenklichen Stimmung befand, dann schienen sie sanft aber unergründlich zu sein. (T, 123)
Tommo reagiert zunächst mit schüchterner Verlegenheit, aber allmählich wächst die Vertraulichkeit zwischen ihm und dem Mädchen und erreicht während einer gemeinsamen Kanufahrt am See einen idyllischen Höhepunkt:
Mit einem wilden Freudenschrei nahm sie das weite Tapagewand ab, das über ihrer Schulter zusammengeknotet war – um sie vor der Sonne zu schützen – breitete es wie ein Segel aus und stand aufrecht mit erhobenen Armen im Bug des Kanus. […] Im Nu schwellte die Brise das Tapagewand, die langen braunen Locken Fayaways wehten im Wind, und das Kanu glitt rasch durchs Wasser. (T, 184–185)
Exotische Szenen wie diese begeisterten die Leser, aber in Wirklichkeit gab es den See nicht und das romantische Tableau, das John La Farge und andere Maler zu kitschigen Darstellungen inspirierte, ist ein Phantasieprodukt. Dennoch wird die angedeutete Liebesbeziehung zwischen Tommo und Fayaway im Roman zu einer zentralen Thematik. Der Ich-Erzähler wird nicht müde, die ungekünstelte Lebendigkeit, Natürlichkeit und Anmut des Inselmädchens zu preisen und mit der Steifheit und Geziertheit weißer Frauen zu vergleichen. Fayaway verkörpert für ihn all das, was eine viktorianische Gesellschaftsdame ihrem männlichen Gegenüber nicht bieten konnte: unmittelbare sinnliche Präsenz jenseits aller Konventionen von Moral, Status oder Besitz. Die Frage, die die zeitgenössischen Leser und Leserinnen in diesem Zusammenhang am brennendsten interessierte, war, ob der Autor mit der Inselschönheit oder möglicherweise auch mit Kory-Kory sexuelle Kontakte hatte. Der Roman gibt darauf keine Antwort, denn alle expliziteren Textstellen wurden von Melville abgeschwächt oder vom Verleger getilgt. Nur wenige Passagen wie die folgende lassen möglicherweise eine erotische Deutung zu:
Jeden Abend versammelten sich die Mädchen des Hauses um mich auf den Matten. Sie jagten Kory-Kory von meiner Seite – der freilich nur ein paar Schritte wegging und ihr Treiben eifersüchtig beobachtete – und salbten dann meinen ganzen Körper mit einem duftenden Öl […]. Der Saft der Aka ist erfrischend und angenehm, wenn er von den zarten Händen lieblicher Nymphen, deren Augen einen dabei voller Freundlichkeit anstrahlen, in die Haut eingerieben wird. Mit Entzücken begrüßte ich die tägliche Wiederholung dieses köstlichen Verfahrens, bei dem ich all meinen Kummer vergaß und mich für eine Weile unbeschwert fühlte. (T, 155)
Die Kommentare zum Thema Erotik und Sex in Typee bewegen sich in der literarischen Rezeption zumeist im Bereich von Spekulationen. Sicher ist nur, dass die Eindrücke einer vorzivilisatorischen Kultur, die allgemeine sorglose und polymorphe Sexualität, das polygame Zusammenleben von Frauen und Männern und die unbekümmerte Nacktheit der Menschen den kalvinistisch erzogenen jungen Protagonisten zutiefst beeindruckten (Martin, 186–191). Eine der Idealfiguren im Roman – neben der Nymphe Fayaway – ist Marnoo, eine Art „polynesischer Apoll“, der ihn mit seinem von kunstvollen Tätowierungen gezierten ebenmäßigen Körper, regelmäßigen Gesichtszügen, gekräuselter Haarpracht und leuchtenden Augen bestrickt (T, 167–187). In seiner androgynen Ausstrahlung ist er die erste Verkörperung von Melvilles Schönheitsideal, auf das dieser in seinen späteren Werken in Gestalt von Harry Bolton in Redburn, Queequeg in Moby-Dick, dem handsome sailor in White-Jacket und Billy Budd oder auch des antiken Helden Antinoos, von dem er später eine Büste in sein Zimmer stellt, immer wieder zurückgreift (Martin, 189). In seiner Aufarbeitung des Erlebten faszinierte Melville seine zeitgenössischen Leser mit dem Klischee des noch nicht von der Zivilisation angekränkelten, unverdorbenen „edlen Wilden“, wie ihn vor allem Jean-Jacques Rousseau anpries. Immer wieder prangert der Ich-Erzähler die Leibfeindlichkeit, Prüderie, Förmlichkeit und heterosexuell fixierte Rigidität des Zivilisationsmenschen an und stellt dessen Streben nach materiellem Besitz, Macht und Status die noch unberührte Glücksfähigkeit des Naturmenschen entgegen:
Der sinnliche Polynesier, dem jeder Wunsch erfüllt ist, der von der Vorsehung überreich mit allen Quellen reiner und natürlicher Freuden beschenkt und so vieler Übel und Leiden des Lebens enthoben wurde – was hat er aus den Händen der Zivilisation zu erwarten? Sie mag „seinen Geist bilden“, „seine Gedanken erheben“ – das sind, glaube ich, die üblichen Phrasen –, aber wird er deshalb glücklicher sein?
In einem primitiven Gesellschaftszustand gibt es zwar nicht viele und nur einfache Freuden, aber sie haben eine weite Verbreitung und sind unverfälscht. Die Zivilisation jedoch hält für jeden Vorteil, den sie bietet, hundert Übel auf Lager – das Herzeleid, die Eifersüchteleien, die gesellschaftlichen Ungleichheiten und Streitigkeiten, der Familienzwist und die tausend selbstverschuldeten Unbequemlichkeiten des kultivierten Lebens, die zusammengenommen die ständig wachsende Masse menschlichen Elends ausmachen, sind bei den weniger entwickelten Völkern unbekannt. (T, 171)
Idealisierende und romantisierende Vorstellungen dieser Art sind von der wissenschaftlichen Ethnologie später in Frage gestellt worden. In Typee fügen sie sich jedoch noch uneingeschränkt in eine lange, bis in die Gegenwart reichende Reihe zivilisationsmüder Schriftsteller, Maler und Philosophen, von Paul Gauguin und Nikolaus Lenau bis Thor Heyerdal, Erich Scheurmann und vielen anderen. Die bis heute andauernde Popularität des Romans findet darin ihre Begründung.
In engem Zusammenhang mit neoprimitivistischen Wunschträumen dieser Art steht Melvilles vernichtende Abrechnung mit dem Kolonialismus. Die mehrmaligen Besitzergreifungen der Marquesas durch koloniale Mächte und die repressive Präsenz der französischen Kriegsflotte in Nukuhiva, deren Augenzeuge Melville wurde, bestärkten seine Überzeugung, dass nicht die sogenannten „Wilden“, sondern die „zivilisierten Weißen die schlimmsten Raubtiere dieser Erde sind“ (T, 172). Angesichts der an den Naturvölkern verübten Verbrechen war für ihn die zivilisatorische Anmaßung eine verlogene Farce. Ein besonderer Dorn im Auge waren ihm die christlichen Missionen und ihr verderblicher Einfluss auf ursprünglich zivilisationsferne Menschen. Statt Missionare zu den Südseeinseln zu schicken, fordert der Ich-Erzähler, „sollten eher Bewohner der Marquesas in die USA und nach Europa reisen, um ihnen ihre eigenen Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen“ (T, 173):
Unglückliches Volk! Mich schauert bei dem Gedanken, welchen Wandel ein paar Jahre in das paradiesische Tal bringen werden. Wenn erst die schlimmsten Laster und übelsten Begleiterscheinungen der Zivilisation Frieden und Glück aus dem Tal vertrieben haben, werden wahrscheinlich die großmütigen Franzosen der Welt verkünden, dass die Marquesas-Inseln zum Christentum bekehrt worden sind! Und das wird die katholische Welt zweifellos für ein glorreiches Ereignis halten. Der Himmel sei den „Inseln der See“ gnädig! Die Anteilnahme, die ihnen das Christentum entgegenbringt, hat sich – leider! – in zu vielen Fällen als ihr tödliches Verderben erwiesen. (T, 263)
Ab dem zwölften Kapitel weitet sich der Roman konsequent zu einer ethnographischen Bestandsaufnahme aus. Tommo, der seine Gesundheit langsam wiedererlangt, besucht die Kultorte der Taipis, die Hula-Hula-Festplätze, Bambustempel, die Heiligen Haine und Begräbnisstätten und bemüht sich, in die religiösen Bräuche einzudringen. Er ist beeindruckt von den aus schwarzen Steinblöcken zusammengefügten riesigen Altären und überlebensgroßen Götterbildern und auch vom Grabmal eines Häuptlings, der in einem mythischen Kanu in den Himmel fährt. Mit Trauer erfüllt ihn die Vorstellung, dass das Vordringen der christlich-westlichen Zivilisation diese uralte Kultur und die darauf beruhenden Kult- und Lebensformen für immer vernichten wird: „Kaum sind auf den Polynesischen Inseln die Götzenbilder umgestürzt, die Tempel zerstört und die Götzenanbeter dem Namen nach zum Christentum bekehrt, erscheinen auch schon die Krankheit, Laster und vorzeitiger Tod. Das entvölkerte Land wird dann von räuberischen Horden aufgeklärter Personen neu besiedelt, die lärmend den Sieg der ‚Wahrheit‘ verkünden“ (T, 264).
Nicht zuletzt widmet der Roman der Alltagskultur der Taipis großen Raum. Mehrere Kapitel schildern die wenig hierarchische Form des Zusammenlebens, die egalitären Eigentumsverhältnisse, die natürliche Bekleidung aus Rindenbast und die kunstvollen Tätowierungen. Darüber hinaus erscheinen die Taburegeln, Rituale, Tänze, Gesänge und Prozessionen als zentrale Kräfte, die das Gemeinschaftsleben der Taipis zusammenhalten. Alle Biographen sind sich darin einig, dass Melville unmöglich die ganze Fülle dieser Erkundungen auf eigene Faust, ohne Sprachkenntnisse und Aufzeichnungen in den drei Wochen, die er auf Nukuhiva verbrachte, durchführen konnte. Melville selbst hat auf diesen augenscheinlichen Widerspruch während der Fertigstellung des Manuskripts reagiert und die Aufenthaltsdauer im Tal der Taipis auf fiktive vier Monate verlängert. Charles R. Anderson weist in seinem akribisch recherchierten Buch Melville in the South Seas (1939) aufgrund zahlreicher Textvergleiche nach, dass fast alle Beschreibungen und Erklärungen in Typee mehr oder weniger auf Sekundärquellen beruhen. Melville tat dies zumeist in Form längerer, leicht adaptierter Paraphrasen oder auch durch wortwörtliche Übernahmen ohne genaue Zitierung. Er machte jedoch kein Hehl daraus, dass er die Reiseberichte anderer Südseereisender benutzte, und verweist dabei – neben Langsdorff – besonders auf C. S. Stewarts A Visit to the South Seas und David Porters Journal of a Cruise Made to the Pacific Ocean. Ironischerweise kritisiert er einige dieser Werke auf eine Weise, die auch auf ihn selbst zutrifft: „Da [der Forschungsreisende] kaum Zeit und Gelegenheit hatte, die Sitten kennenzulernen, die er angeblich schildert, reiht er sie aufs Geratewohl im Stegreifstil aneinander“ (T, 231).
Eigenes, Fiktives und Angelesenes lassen sich in Typee nur schwer auseinanderhalten, denn sogar für die Beschreibungen persönlicher Erfahrungen griff Melville auf die Darstellungen anderer zurück. Als ethnographischer Bericht würde die Authentizität des Romans heute zweifellos als plagiatsverdächtig gelten. Andererseits konzipierte Melville Typee nicht als einen rein autobiographischen, wissenschaftlich fundierten Bericht, sondern als einen anschaulich erzählten, den Leser in seinen Bann ziehenden Südseeroman. Erstaunlicherweise stellte eine achtmonatige ethnographische Forschungsexpedition im Jahr 1921 fest, dass die Darstellung, die Melville von den Taipis und ihren Lebensgewohnheiten gibt, trotz mancher romantisierender Übertreibungen und Ausschmückungen im Großen und Ganzen der damaligen Realität entsprach.
Eine weitere Thematik, die in der kritischen Rezeption einen breiten Raum einnimmt, sind die den Roman durchziehenden Hinweise auf den von den Taipis angeblich praktizierten Kannibalismus. Melville bezog sich in seinen Ausführungen vor allem auf die Erkenntnisse des schon erwähnten amerikanischen Explorers David Porter. In seinem Reisebericht schränkt dieser die kannibalistischen Akte der Taipis auf Rituale ein, die ursprünglich an getöteten Feinden vollzogen wurden. Ihr Zweck war, die Kraft der besiegten Feinde aufzunehmen und ihre mumifizierten Köpfe als Stammestrophäen aufzubewahren. Obwohl diese Bräuche zu der Zeit von Melvilles Aufenthalt schon längst der Vergangenheit angehörten, setzte er die Angst vor Kannibalismus bewusst als erzählerische Spannungsstrategie ein. Den ganzen Roman hindurch leidet der Erzähler unter angsterfüllten Vorahnungen und Schreckensphantasien: „Konnte es nicht sein, dass die Insulaner unter dem Schein des Wohlwollens Verrat planten, dass der gute Empfang nur das Vorspiel zu einer schrecklichen Katastrophe war?“ (T, 110) Dass Tommos Wunsch, die Insel zu verlassen, bei den Taipis auf heftigen Widerstand stößt, sieht er als Beweis an, dass er letztlich ein Gefangener mit unsicheren Zukunftsaussichten ist. Zu erschreckender Gewissheit werden diese Befürchtungen, als er eines Tages im Haus des Häuptlings drei geheimnisvolle in Bast gehüllte Mumienköpfe entdeckt. Da einer davon von einem Weißen stammt, quält ihn die Horrorvorstellung, dass es der Kopf seines verschollenen Freundes Toby sein könnte: „Sollte ich wie er umkommen, wie er vielleicht verzehrt und mein Kopf einbalsamiert werden?“ (T, 310) Ab diesem Augenblick gibt es für ihn nur noch ein Bestreben, nämlich so schnell wie möglich zu fliehen. Kurze Zeit später erhält er die Nachricht von Tobys angeblicher Rückkehr und er wird unter Aufsicht einiger Taipi-Krieger zur Küste eskortiert. Als sich dort vom Kameraden keine Spur findet, kommt es zu einem kurzen heftigen Kampf, in dessen Verlauf Tommo seinen Bewachern durch den Sprung in das ablegende Beiboot eines australischen Walfängers entkommt. All dies ist, wie Nachforschungen ergaben, nicht viel mehr als eine spannende fiktionale Dramatisierung. In Wirklichkeit lieferten die Taipis aller Wahrscheinlichkeit nach den entlaufenen Seemann gegen ein Lösegeld an Schiffsrekrutierer aus, die auf der Suche nach „Strandläufern“ in die Bucht gekommen waren. Jedenfalls musterte Melville am 19. August 1842 auf dem australischen Walfänger Lucy Ann an, der auf dem Weg nach Tahiti war.
Typee ist das uneinheitliche, zutiefst ambivalente Werk eines literarischen Debütanten, das zwischen Fiktion und autobiographischem Wahrheitsanspruch, romantischer Verklärung und angsterfülltem Pessimismus hin- und herschwankt. Dementsprechend gemischt waren die Reaktionen, die der Roman auslöste. Während das Lesepublikum ihn als exotischen Bericht mit Begeisterung aufnahm, warfen einige Rezensenten Melville ein voyeuristisches und unmoralisches Verhalten gegenüber den unschuldigen Naturkindern vor oder verurteilten die Herabwürdigung der christlichen Missionen. Der Roman, so lautet ein Kommentar im New York Christian Parlor Magazine, überhäuft die sich für die Verbreitung des Evangeliums unter den wilden Heiden aufopfernden Missionare „mit Schmähungen und beschuldigt sie insgesamt, die Ursache für die Lasterhaftigkeit, das Elend, die Not und das Unglück der Polynesier zu sein“ (H/P, 55). Von beißendem Hohn sind die Auslassungen des Rezensenten über Fayaway: „Komm du sehnsuchtsvolle Seele der engelhaften Fayaway. Lass mich teilhaben an deinen bei uns tabuisierten Reizen! Lass mich aufleben unter dem milden Strahl deiner azurblauen Augen und Ruhe finden in den Rundungen deiner anmutigen Formen“ (H/P, 54). Ein Kritiker im New York Evangelist entrüstet sich darüber, dass ein derartig übertriebenes, von zivilisations- und religionsverachtenden Vorurteilen beherrschtes Machwerk überhaupt in der respektablen „Library of American Books“ Aufnahme finden konnte (H/P, 46). Wesentlich ausgewogener, wenn auch ebenfalls mit vorsichtiger Zurückhaltung ist die Beurteilung von Melvilles späterem Freund Nathaniel Hawthorne im Salem Advertiser:
Die Beschreibungen, die der Autor von den Eingeborenenmädchen gibt, sind von farbiger Sinnlichkeit, aber nicht mehr als es die gegebene Situation verlangt. Er verfügt über eine Freiheit des Geistes – und es wäre zu grob, sie als prinzipienlose Laxheit zu verurteilen –, die es ihm erlaubt, auch gegenüber einem Moralkodex tolerant zu sein, der nur wenig mit dem unserem gemein hat. Sein Buch zeigt eine Geisteshaltung, die einem jungen abenteuerlichen Seemann durchaus zu Gesicht steht und unseren allzu gesetzten Landsleuten gut tut. (H/P, 23)
Schwerwiegender als die moralischen und kirchlichen Einwände war jedoch der Vorwurf, Typee sei ein Phantasieprodukt ohne glaubwürdige Basis. Dies war die Begründung, warum der New Yorker Verlag Harper & Brothers die Drucklegung verweigerte. Der große Durchbruch trat erst im Juli 1846 ein, als Melvilles Fluchtkamerad Tobias Greene vier Jahre nach dem Geschehen in Rochester auftauchte und in einer Buffaloer Zeitung den Wahrheitsgehalt von Typee bestätigte. Auf der Suche nach einem Schiff, so berichtet er, war er einem kriminellen irischen Exmatrosen namens Jimmy Fitch in die Hände gefallen, der als Agent zwischen den vor Anker liegenden Schiffen und den entlaufenen Seeleuten fungierte. Er vermittelte ihm eine Heuer auf einem englischen Frachter, die er unter der Bedingung annahm, dass sein Kamerad unverzüglich nachgeholt werde. Aber Fitch verschwand von der Bildfläche; das Schiff stach zwei Tage später mit Toby an Bord in Richtung Neuseeland in See, während Melville allein auf der Insel zurückblieb. Nach dem Wiederauftauchen Tobys in den USA nahm Melville mit ihm Kontakt auf, schrieb dessen mündlichen Bericht nieder und fügte ihn als „Die Geschichte Tobys“ (1846) dem Roman bei. Damit war der Beweis erbracht, dass Melville tatsächlich der Mann war, „der unter den Kannibalen lebte“ (Leyda, 413) – ein Ruf, den er sein ganzes Leben nicht mehr loswurde.