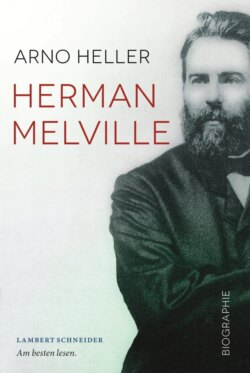Читать книгу Herman Melville - Arno Heller - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Vagabundenjahr im Südpazifik – Omoo
ОглавлениеAls Melville auf der Lucy Ann anheuerte, waren ihm die vier Wochen „unter den Wilden“ anzusehen. Seine zotteligen, schulterlangen Haare, sein ruppiger Bart, seine zu weiten, schlecht sitzenden Hosen und der lässig über die Schulter geworfene Bastmantel hinterließen einen verwilderten Eindruck. Das Schiff, das er betrat, befand sich mit seinen morschen Masten und verschmutzten Decks ebenfalls in einem desolaten Zustand:
Als wir näher kamen, entpuppte es sich als kleines, verwahrlost aussehendes Fahrzeug, Rumpf und Spieren von einem schmutzigen Schwarz, das Takelwerk überall locker und ausgebleicht, und alles ließ auf üble Zustände an Bord schließen […]. An der Reling lehnten nachlässig die Matrosen, wilde, hohlwangige Burschen in schottischen Mützen und verschossenen blauen Jacken; einige von ihnen hatten statt der tiefdunklen Gesichtsfarbe der Seeleute in den Tropen eine fleckige, bronzefarbene, was auf Krankheit schließen ließ. (O, 17)
Diese Beschreibung sowie alle weiteren biographischen Details, die über Melvilles Abenteuer in den folgenden zwölf Monaten bekannt sind, entstammen seinem Roman Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas (1847; dt. Omu: Wanderer in der Südsee). Im Gegensatz zu dem von Angst überschatteten Erstlingswerk ist Melvilles zweiter Roman ein locker erzähltes Buch voller bunter Charaktere und abwechslungsreicher Geschehnisse. Wie spätere Nachforschungen in Logbüchern, Gerichtsakten und Augenzeugenberichten bestätigten, ist es Melvilles authentischstes Werk. Während Typee den Urzustand eines von der Zivilisation noch weitgehend unberührten Eingeborenenstammes evoziert, spielt Omoo in einer kolonialisierten, von westlichen Einflüssen schon kontaminierten Welt. Dementsprechend fällt Melvilles Kritik am Kolonialismus, vor allem an der französischen Besitzergreifung und den christlichen Missionen, noch schärfer aus als in Typee. Der Gegensatz zwischen den beiden ungebundenen, für die Eingeborenenkultur empfänglichen „Strandläufern“ (omus) und den korrupten und inkompetenten Vertretern der westlichen Zivilisationswelt liefert die thematische Grundstruktur des Romans. Da Melville weniger auf Sekundärquellen zurückgriff als in seinem Erstlingswerk, wirken die Schilderungen trotz ihres kulturpessimistischen Untertons insgesamt persönlicher. Melville stellte das Manuskript im Spätherbst 1846 fertig. Der Verlag Wiley and Putnam lehnte die Veröffentlichung wegen der darin enthaltenen missionskritischen Passagen ab, aber Harper & Brothers war nach einigen Streichungen bereit, den Roman herauszubringen. Obwohl Omoo die Spannung und Exotik von Typee nicht mehr erreichte, kam der Roman beim Lesepublikum gut an und löste sogar Reformdiskussionen über das Missionswesen aus.
Nach monatelanger unergiebiger Pottwaljagd war es an Bord der Julia – der fiktionalen Version der Lucy Ann – zu chaotischen Zuständen gekommen. Ein Großteil der Seeleute litt an Geschlechtskrankheiten, die Nahrungsversorgung mit verdorbenem Fleisch und von Würmern zerfressenem Schiffszwieback war miserabel und die Ratten- und Schabenplage unerträglich. Von den ursprünglich in Sidney angemusterten 32 Seeleuten waren zwölf desertiert, darunter drei der vier Harpuniere, so dass das Schiff gezwungen war, die Inseln Nukuhiva, Santa Christina und La Domenica anzulaufen, um andere Deserteure ausfindig zu machen und als Ersatzleute aufzunehmen. Kapitän Guy, ein nach Australien ausgewanderter Cockney, war ein kränklicher, inkompetenter und seeunerfahrener, „junger Mann, blass und schmächtig, und glich mehr einem kränklichen Büroschreiber als einem derben Schiffskapitän“ (O, 18). Die Matrosen nennen ihn verächtlich „Schreiberlehrling“ und der Ich-Erzähler bemerkt lakonisch: „Er taugte zur Seefahrt nicht besser als ein Friseur“ (O, 24). Als Guy immer mehr die Kontrolle über die Mannschaft verliert, übergibt er das Kommando dem ersten Steuermann John Jermin, einem fähigen, aber wegen seiner Brutalität bei der Mannschaft gefürchteten Alkoholiker: „Das gekräuselte Haar wuchs in kleinen stahlgrauen Locken um seinen Schädel, das scharfgeschnittene Gesicht war von tiefen Blatternnarben gezeichnet, mit dem einen Auge schielte er grimmig, die Nase saß ihm schief im Gesicht, und mit seinem breiten Mund und den großen weißen Zähnen, sah er, wenn er lachte, gerade wie ein Haifisch aus“ (O, 25). Ihm zu Diensten steht der Harpunier Bembo, ein undurchschaubarer neuseeländischer Maori, mit dem sich nur Jermin in dessen Muttersprache verständigen kann.
Nach der Abreise von Nukuhiva kreuzt das Schiff mehrere Wochen lang auf der vergeblichen Suche nach Pottwalen umher und nimmt schließlich Kurs auf Tahiti. Für die 1000 Seemeilen dorthin braucht die Julia statt der üblichen zehn Tage mehr als einen Monat. In Ermangelung von Aktivitäten konzentrieren sich die ersten 90 Seiten des Romans auf Schilderungen der Charaktere und Zustände an Bord. Aus den rauen und größtenteils verkommenen Gesellen ragt nur der kauzige, aber gebildete vormalige Schiffsarzt mit dem Spitznamen Dr. Long Ghost (dt. Dr. Langgespenst) hervor. Er ist „eine auffallende Erscheinung, über sechs Fuß groß, ein knochiger Riese mit vollkommen fahler Gesichtsfarbe, blondem Haar und hellen, unbekümmerten grauen Augen, die manchmal verteufelt boshaft blinzeln konnten“ (O, 27). Wie Nachforschungen herausfanden, hieß er im wirklichen Leben John Troy und war ein in jungen Jahren von England nach Australien ausgewanderter Globetrotter. Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem Kapitän der Julia quittiert er den Dienst und zieht sich als gewöhnlicher Passagier zur gemeinen Mannschaft ins Vorderschiff zurück. Der witzige und belesene Mann wird bald zum einzigen Ansprechpartner und Freund des Ich-Erzählers.
Am 20. September 1842 erreicht die Julia Tahiti, eine Insel von großer landschaftlicher Schönheit:
Der Anblick vom Meer aus ist prachtvoll. Vom Strand bis hinauf zu den Gipfeln der Berge sieht man dichtes Grün in allen Schattierungen, und Täler, Bergrücken, Schluchten und Wasserfälle gestalten das Ganze unendlich abwechslungsreich. Hier und da werfen die höheren Gipfel ihre Schatten über die Hügel und tief in die Täler hinein. In ihrem Hintergrund leuchten Wasserfälle im Sonnenlicht auf und scheinen sich durch hohe, grüne Laubengänge zu ergießen. Das Ganze atmet einen so zauberhaften Reiz, als sei eine Feenwelt frisch und strahlend aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen. (O, 96)
In Papeete, dem Hauptort der Insel, wird der kranke Kapitän in einem Walboot an Land gebracht, während die Julia zum großen Missfallen der Besatzung die Walfangreise unverzüglich für weitere drei Monate fortsetzen soll. Als das Schiff außerhalb des Hafens noch ziellos vor Anker liegt, eskaliert der Unmut der Seeleute zu offener Meuterei. Eine gemeinsam verfasste Petition an den stellvertretenden britischen Konsul bleibt unbeantwortet. Nach einem wüsten nächtlichen Gelage verweigert die Mannschaft jede weitere Befehlsannahme, worauf Jermin das Schiff ohne behördliche Bewilligung und Lotsen in den Hafen einlaufen lässt. Der Konsul kommt an Bord, lässt die Meuterer, darunter den Ich-Erzähler und Long Ghost, kurzerhand festnehmen und in den militärischen Gewahrsam der im Hafen vor Anker liegenden französischen Fregatte La Reine Blanche überstellen. Drei Tage später wird die Mannschaft vor Gericht gestellt und nach abstrusen Verhören zu einer unbefristeten Haftstrafe verurteilt. All dies hat, wie Wilson Heflins akribische Recherchen bestätigen, tatsächlich stattgefunden (Heflin, 158 –179).
In der „Calabusa Biriteni“, einem vom polynesischen Wärter Bob lax geführten Gefängnis für Schiffsdeserteure, werden die Verurteilten unter relativ lockeren Bedingungen mehrere Wochen inhaftiert. Die einzigen Unannehmlichkeiten sind ein nächtlicher Fußbalken gegen Fluchtversuche und das spöttische Gelächter herumstreunender Eingeborenenmädchen. Nach dem gescheiterten Versuch Kapitän Guys, die Meuterer vor ein englisches Gericht in Sidney zu bringen, werden die Inhaftierten nach dem Auslaufen der Julia freigelassen. Sie verbleiben noch einige Zeit in Papeete, knüpfen Kontakte mit den Eingeborenen und halten sich mit allerlei Tauschgeschäften und entstandenen Beziehungen über Wasser. Unter anderem gelingt dem Erzähler und Long Ghost, Zutritt zur protestantischen polynesischen Gemeinde zu bekommen. Sie besuchen regelmäßig die Sonntagsgottesdienste in der aus Bambusholz errichteten „Kirche der Kokosnüsse“, dem ersten christlichen Sakralbau in Polynesien. Sie erkennen jedoch schon bald, dass das nach außen zur Schau getragene Christentum der Eingeborenen auf oberflächlichen Lippenbekenntnissen, Opportunismus und dem Heischen nach Begünstigungen basiert. Eine schillernde Figur ist der eingeborene Missionsgeistliche, der seine Gottesdienste neben Angriffen auf die französisch-katholische Konkurrenz als eine Art Werbeveranstaltung zum eigenen Vorteil nutzt. Seine in gebrochenes Englisch übersetzte Predigt, die Melville weitgehend den Polynesian Researches (1832) von William Ellis entnahm, ist ein kleines satirisches Kabinettstück:
Liebe Freunde, sehr schlechte Zeiten in Tahiti. Das machen mich weinen. Pomare ist fort, die Insel nicht mehr euch gehören, sondern den Wiwis [Franzosen]. Hier auch böse Priester und böse Götzenbilder in Frauenkleidern und mit Messingketten. Liebe Freunde, ihr nicht sprechen mit ihnen oder sie anschauen. Aber ich weiß, ihr es nicht tun – sie gehören zu einer Räuberbande, den bösen Wiwis. Bald diese schlechten Menschen werden schnell müssen fortgehen, Briteni Donnerschiffe kommen, und sie gehen fort. Aber nichts mehr darüber sprechen jetzt. […]
Meine lieben kleinen Mädchen, ihr nicht hinter Matrosen herlaufen, nicht gehen, wo sie gehen, sie euch Böses tun. Wo sie kommen her, gute Leute nicht mit ihnen sprechen – sind wie Hunde. […]
Liebe Freunde, wenig zu essen in meinem Haus. Schoner von Sidney nicht Sack mit Mehl bringen und Kanaka nicht bringen genug Schwein und Früchte, ‚Mickoneri‘ [verballhornt missionaries, Missionare] tun viel für Kanaka. Kanaka nicht viel tun für Mickoneri. So, liebe Freunde, ihr flechten viele Körbe von Kokos, sie füllen und sie bringen morgen. (O, 233–234)
Mit Enthüllungen dieser Art, die den christlichen Auftrag zur Farce machten, zog Melville später die Feindschaft vor allem der methodistischen Missionen auf sich, obwohl ihre Konkurrenten, die katholischen Priester, noch schlechter wegkommen als sie. Der Erzähler nennt sie einen „Klub von Schlemmern, die ihr priesterliches Trinkgelage bei manchem guten Glas Brandy abhielten“ und sich „ein Sortiment hübscher, kleiner eingeborener Hausmädchen“ hielten: „Diese jungen Damen waren die ersten Bekehrten, und sie waren es mit Hingabe“ (O, 194). Weitere kritische Beobachtungen und Betrachtungen über die Lebensbedingungen und Bräuche der Eingeborenen kommen am Ende zu einem vernichtenden Ergebnis: Die Missionen, und mit ihnen die westliche Zivilisation, die sie importieren, zerstören das alte Brauchtum der rituellen Tänze, Gesänge und Feste, verbieten die Tätowierungen, die überkommenen Kampfspiele und die als unanständig betrachteten kurzen Taparöcke der Frauen. Die sogenannten „Kannakippers“, eine von den Missionen eingesetzte Sittenpolizei, spionieren Übertretungen aus und verfolgen sie mit drastischen Strafen. Am Gängelband der weißen Kolonialherren werden sie durch importierte zivilisatorische Errungenschaften systematisch ihrer handwerklichen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten beraubt. Auf diese Weise haben sie innerhalb weniger Jahrzehnte durch Eingriffe von außen ihre kulturelle Identität und Eigeninitiative verloren und fristen ein träges und orientierungsloses Dasein:
Ihre Aussichten sind hoffnungslos. […] Vor Jahren wurden sie in einen Zustand versetzt, in dem sich alles vereint, was Unwissenheit und Zivilisation an Verderblichem hervorbringen, das in beiden enthaltene Wertvolle aber unwirksam bleibt. Und wie andere unzivilisierte Menschen, die mit Europäern in Berührung kamen, müssen sie bis zu ihrem vollständigen Untergang in diesem Zustand verharren. (O, 258)
Des wochenlangen Müßiggangs überdrüssig, setzen sich der Erzähler und Long Ghost am Ende von ihren Kumpanen ab und finden auf der benachbarten Insel Imeo auf einer von zwei amerikanischen Exseeleuten geführten Plantage Arbeit. Sie roden den Boden, ernten Süßkartoffeln für die vor Anker liegenden Schiffe und beteiligen sich an der Jagd auf verwilderte Rinder und Schweine in den umliegenden Wäldern. Doch die harte körperliche Arbeit in der tropischen Hitze und die unerträgliche Moskitoplage zwingen sie bald, den Job aufzugeben. Sie erkunden die Insel und entdecken ein abgelegenes Dorf, wo sich unter anderen alten Bräuchen auch die erotischen Tänze und Gesänge junger Mädchen in den Vollmondnächten erhalten haben. Noch einmal zieht Melville alle Register publikumswirksamer Südseeromantik und übernimmt dabei sogar eine vom englischen Verleger Murray aus Typee expurgierte Szene:
Dann stimmen [die Nymphen] ein fremdartiges Lied an und wiegen sich leise hin und her. Aber nach und nach wird ihre Bewegung schneller, bis sie sich zuletzt für einige leidenschaftliche Augenblicke mit bebenden Brüsten und glühenden Wangen völlig dem Dämon des Tanzes überlassen und alles um sich her zu vergessen scheinen. Bald aber fallen sie in das frühere langsame Tempo zurück und stehen wieder still. Schließlich stürzen sie von allen Seiten vorwärts, ihre Augen schwimmen, sie singen einen wilden Chorgesang und sinken einander in die Arme. (O, 320)
Der Wunsch, an diesem idyllischen Ort länger zu bleiben, scheitert mit dem Auftauchen von Häschern, die nach entlaufenen Seeleuten suchen. Die beiden Herumtreiber ergreifen die Flucht und umwandern entlang der Strände die Insel bis zu dem 40 km entfernten Papetoai, dem Residenzort der Exkönigin von Tahiti. Unterwegs knüpfen sie mit den eingeborenen Fischerfamilien freundschaftliche Kontakte und genießen deren Gastfreundschaft und Lebensfreude in vollen Zügen. Sie werden mit köstlichen Früchten, üppigen Essgelagen und dem heiteren Umgang mit den ungezwungenen Frauen verwöhnt. Mit den romantisch rousseauistischen Schilderungen eines exotischen Paradieses, das nur einmal durch eine Gruppe alkoholisierter Matrosen von einem Walfänger gestört wird, folgt Melville noch einmal dem Erfolgsrezept von Typee.
Den Abschluss von Omoo bildet der Besuch des Hofs von Königin Pomare kurz nach ihrer Entmachtung durch den französischen Admiral Dupetit-Thouars. Melville widmet der Geschichte Tahitis ganze zwei Kapitel. Der Wunsch, eine Audienz oder gar eine Anstellung am Hof gewährt zu bekommen, scheitert am Unwillen der frustrierten Herrscherin. Die beiden beschließen, Tahiti zu verlassen und auf dem amerikanischen Walfänger Leviathan anzuheuern. Dies gelingt jedoch nur dem Ich-Erzähler, während der Kapitän den als Sidney-Kriminellen verdächtigen Long Ghost zurückweist. Das Zwischenspiel eines sorglosen Vagabundenlebens hat damit ein Ende gefunden: „Als alle Segel gesetzt waren, brassten wir die Rahen vierkant, die Brise frischte auf und trieb uns rasch vom Lande weg. Wieder einmal schaukelte die Wiege des Seemanns unter mir, und ich schritt mit schwankendem Gang übers Deck. Gegen Mittag war die Insel am Horizont verschwunden und vor uns lag der weite Pazifik“ (O, 416).
Im realen Leben musterte Melville auf dem amerikanischen Walfänger Charles and Henry an und verbrachte weitere drei ereignisarme Walfangmonate im Pazifik. Über die Route des Schiffs ist wenig bekannt, denn Melville verwarf den ursprünglichen Plan eines weiteren Seereiseromans über den letzten Abschnitt seines Südseeaufenthalts. Zwar beginnt auch sein nächster Roman Mardi auf einem Walfänger, mutiert aber schon nach wenigen Kapiteln zu einer allegorisch-philosophischen und satirischen Phantasiegeschichte ohne autobiographische Anhaltspunkte. Fest steht, dass die Charles and Henry am 7. Mai 1843 in den Walfanghafen Lahaina in Maui einlief, eine der damaligen Sandwichinseln und des heutigen Hawaii-Archipels. Alles, was über Melvilles Aufenthalt in Hawaii bekannt ist, verraten Passagen und Randbemerkungen im 26. Kapitel von Typee sowie spätere Nachforschungen vor Ort (Heflin, 187–219). Melville musterte in Lahaina ab, verbrachte einige Zeit in dem landschaftlich schönen Hafenort, besichtigte das Seminar der dortigen Missionsschule sowie den alten Backsteinpalast des hawaiischen Königs Kamehameha III. – eines in seinen Augen „dicken und faulen Dummkopfs“ (T, 254). Mit seiner korrupten Marionettenregierung und Günstlingswirtschaft, so Melville, hatte der unfähige und charakterlose Herrscher Hawaii ins Chaos gestürzt und den britischen Konsul zum Eingreifen gezwungen. Admiral Lord George Paulet ging mit seiner Fregatte H.M.S. Carysfort in Honolulu vor Anker, entmachtete den König und übernahm interimsmäßig die Verwaltung. Die USA, die sich dadurch geopolitisch brüskiert fühlten, reagierten auf die britische Provokation mit der Entsendung von Kriegsschiffen, darunter die U.S.S. Constellation unter Commodore Lawrence Kearny. Sie sollten die Unabhängigkeit Hawaiis wieder herstellen sowie die Interessen der dort niedergelassenen amerikanischen Bewohner wahren. Das Eingreifen führte am 31. Juli 1843 zur Aufhebung der fünfmonatigen britischen Okkupation und zur Wiedereinsetzung des Königs. Die eingeborenen Bewohner Honolulus, der künftigen Hauptstadt Hawaiis, feierten dieses Ereignis in über zehn Tage dauernden polynesischen Saturnalien mit überschäumenden Ausschweifungen aller Art. Die spätere freundliche Haltung Hawaiis gegenüber den USA geht im Wesentlichen auf diese Zeit zurück und bahnte den Weg zur offiziellen amerikanischen Übernahme der Inselgruppe im Jahr 1898.
Die Acushnet, von der Melville elf Wochen zuvor desertiert war, langte am 2. Juni 1843 ebenfalls in Lahaina ein und deponierte bei der dort niedergelassenen amerikanischen Handelsagentur eine Desertionsanzeige. Zu diesem Zeitpunkt hatte Melville jedoch die Stadt längst in Richtung Honolulu auf der Nachbarinsel Oahu verlassen. Während seines viermonatigen Aufenthalts dort wurde er Zeuge der erwähnten politischen Entwicklungen. Er schrieb Briefe an seine Familie, aber deren Antwortschreiben kamen nie bei ihm an. Anfang Juni fand er eine Anstellung als Buchhalter in der neu eröffneten Kurzwarenfirma des Engländers Isaac Montgomery und sympathisierte unter seinem Einfluss mit der britischen Politik. So vehement Melville die französischen kolonialen Schachzüge verurteilt hatte, so sehr rechtfertigte er nun das britische Vorgehen gegen die in seinen Augen degenerierte und korrupte Eingeborenenregierung. Wie wichtig ihm diese Angelegenheit war, zeigt sich in seinem politischen „Appendix“ in der englischen Ausgabe von Typee, wo er die Polemik seiner amerikanischen Landsleute gegen das Vorgehen der Briten auf Hawaii als ungerechtfertigt zurückweist. Diese Stellungnahme war der Erstausgabe in England zweifellos förderlich, in den traditionell antibritischen USA jedoch stieß sie auf Ablehnung und wurde in der revidierten amerikanischen Ausgabe eliminiert.
Wie zuvor in Tahiti richtete sich Melvilles Kritik gegen die auf Hawaii agierenden christlichen Missionen. Die mehrheitlich methodistischen Missionare hatten Vergnügungen aller Art, volkstümliche Bräuche, das traditionelle Handwerk, den Genuss von Alkohol und nicht zuletzt den beliebten Volkssport des Surfboardens verboten und damit die einheimische männliche Bevölkerung zu einem langweiligen und trägen Leben verdammt. Wie Charles Anderson anhand von Textvergleichen nachgewiesen hat, orientierten sich Melvilles kritische Auslassungen über die Zustände und Entwicklungen in Hawaii eng an den Berichten früherer Polynesienreisender. Zu den wichtigsten Referenzwerken, die er las und zum Teil paraphrasierte, gehörten die Erkundungen des englischen Missionars William Ellis, der acht Jahre in Hawaii tätig war und seine landeskundlichen und historischen Erkenntnisse in seinem Buch Polynesian Researches (1832) veröffentlichte. Die Arbeitsweise, die Melville schon in Typee entwickelt hatte, brachte er in Omoo zur Perfektion. In einem ersten Schritt schrieb er seine persönlichen Erlebnisse nieder, ergänzte diese durch frei erfundene Einschübe und fügte am Ende angelesenes Material in adaptierter Form in den Text ein. Harrison Hayford, der Melvilles Quellen zu Omoo eingehend erforscht hat, kommt zu folgender Schlussfolgerung: „Melville veränderte Fakten und Daten, schmückte Ereignisse aus, assimilierte Fremdtexte, erfand Episoden und gab die gedruckten Erlebnisberichte anderer als seine eigenen aus. Es waren aber nicht einfach nur Plagiate, denn er schrieb die übernommenen Passagen stets neu und verbesserte sie in der Regel“ (Hayford, 1969, „Introduction“).
In seiner Kritik an den christlichen Missionen brandmarkt Melville vor allem die rassistische Machtanmaßung und hierarchische Kastenmentalität der Missionare gegenüber den Eingeborenen. So berichtet er über eine Missionarsgattin, die sich täglich in einer zweirädrigen Equipage von zwei fast nackten Insulanern durch Honolulu karren lässt und sie mit einem Fächer auf die Köpfe schlagend antreibt: „Es ist entschieden etwas falsch bei der praktischen Durchführung der Mission auf den Sandwichinseln“, ist seine sarkastische Schlussfolgerung. „Ehe ich Honolulu besuchte, wusste ich nichts davon, dass der kleine Rest der Eingeborenen zu Zugpferden zivilisiert und zu Lasttieren christianisiert worden war. Es ist wirklich so. Man hat sie buchstäblich wie die Tiere vor die Fahrzeuge ihrer geistlichen Lehrer angeschirrt!“ (T, 265–266) Nicht weniger sarkastisch wendet sich Melville gegen den verderblichen Einfluss der westlichen Zivilisation vor allem in Hinblick auf den schon damals in Hawaii florierenden Sextourismus und seine negativen Folgen: „Der demoralisierende Einfluss einer liederlichen fremden Bevölkerung und die häufigen Besuche von Schiffen aller Art haben viel dazu beigetragen, die angedeuteten Übel zu vermehren. Mit einem Wort: Wie überall, wo die Zivilisation zu den sogenannten Wilden gebracht wurde, hat sie auch hier ihre Laster ausgestreut und ihre Segnungen vorenthalten“ (T, 268). Die Frage, ob die Zivilisation den Polynesiern zu mehr Glück verholfen habe, verneint Melville entschieden:
Lasst die kranken, hungernden und sterbenden Eingeborenen der einst blühenden, dicht bevölkerten Hawaii-Inseln die Frage beantworten. Die Missionare mögen die Sache beschönigen, soviel sie wollen, aber die Tatsachen lassen sich nicht auf den Kopf stellen, und der frömmste Christ, der diese Inselgruppe vorurteilslos besucht, wird sie mit der traurigen Frage verlassen: „Ach, sollten dies die Früchte einer fünfundzwanzigjährigen Aufklärung sein?“ (T, 171)
Die bei diesen unglücklichen Völkern eingeschleppten Laster und Krankheiten erhöhen von Jahr zu Jahr die Sterblichkeitsziffer [und beschleunigen] die völlige Ausrottung der Bewohner Hawaiis und Tahitis. (T, 260)
Es mögen düstere Erfahrungen und Erkenntnisse dieser Art gewesen sein, die Melville an eine baldige Abreise denken ließen. Vielleicht war es auch der wachsende Überdruss über sein allzu langes Herumvagabundieren oder das Heimweh nach seiner Familie, von der er nach wie vor nichts wusste, was in ihm schließlich den Entschluss reifen ließ, abzureisen. Er kündigte den unterschriebenen einjährigen Anstellungsvertrag vorzeitig auf und heuerte auf der im Hafen liegenden amerikanischen Fregatte United States als einfacher Marinematrose an. Am 17. August 1843 stach das Schiff in See, segelte zunächst südwärts Richtung Marquesas-Inselgruppe und Tahiti, ohne dass die Mannschaft – zu Melvilles Bedauern – Landurlaub bekam. Weiter ging es ostwärts nach Valparaiso und an der südamerikanischen Westküste entlang nach Norden nach Callao in Peru. Dort lag die Fregatte bis zum 6. Juli 1844 zehn Wochen lang als Flaggschiff der US-Pazifikflotte in Bereitschaft gegen eventuelle britische Besitz- oder Machtansprüche an der Westseite des Kontinents. Ein kurzer Besuch der peruanischen Hauptstadt Lima war der einzige Landurlaub auf der gesamten Reise. Die Rückfahrt führte über Kap Hoorn und Rio de Janeiro nach Boston, wo das Schiff am 3. Oktober 1844 in den Charleston Navy Yard einlief. Melvilles fünfter Roman White-Jacket; or, The World in a Man-of-War (1850; dt. Weißjacke oder das Leben auf einem Kriegsschiff), den er vier Jahre nach seiner Heimkehr in wenigen Wochen niederschrieb, ist die einzige authentische, aber nur eingeschränkt autobiographische Informationsquelle über diese Zeit (s. Kap. „Experimente und Aufbrüche“).
Mit der Rückkehr in die Heimat nach fast vierjähriger Abwesenheit war Melvilles Südseeabenteuer zu Ende. Erstaunlicherweise betrachtete Melville seine Jahre in der Südsee im Rückblick als verlorene Zeit: „Bis ich fünfundzwanzig war“, schreibt er 1851 in einem Brief an Hawthorne, „hatte ich mich überhaupt nicht entwickelt. Ich datiere mein Leben von meinem fünfundzwanzigsten Jahr an. Zwischen damals und heute sind kaum je einmal drei Wochen vergangen, in denen ich mich nicht in mir selbst entfaltet hätte“ (S/G, 259–260). Offenbar wurde ihm erst viel später bewusst, welch ungeheurer Schatz an sinnlichen Eindrücken, Abenteuern, Begegnungen und Erkenntnissen sich in diesen Jahren in seinem Gedächtnis als ein ihn prägendes Erlebensreservoir angesammelt hatte. Es war die innere Substanz, von der er als Schriftsteller lebenslang zehren konnte. Die zwei frühen Seereiseromane Typee und Omoo sind realistische, stark autobiographische Erstlingswerke, aber sie legten den Grundstein für spätere Entwicklungen. Die authentische Erfahrung der Jahre auf See, der Aufenthalt in exotischen Ländern und die daraus resultierende Zivilisationskritik, die Gespräche, die er mit Familienangehörigen, Freunden und Schriftstellerkollegen darüber führte sowie eine riesige Zahl recherchierter Quellen und gelesener Bücher ließen den jungen Matrosen und Weltenbummler allmählich und auf vielen Umwegen und Fehlschlägen zum Autor von Moby-Dick heranreifen.