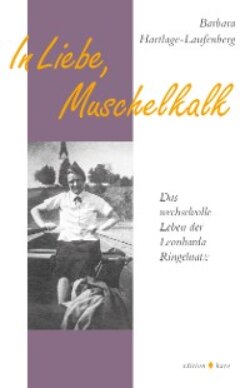Читать книгу In Liebe, Muschelkalk - Barbara Hartlage-Laufenberg - Страница 6
ОглавлениеAm Strand tanzt ein Boot.
Das lockt mich hinaus in die tosende See.
Hans
Hans Bötticher, Marinesoldat und Dichter, hat schon einiges erlebt, als er der fünfzehn Jahre jüngeren Lona zum ersten Mal begegnet. Sein Elternhaus ist ebenso gutbürgerlich wie das von Lona. Der Vater, Georg Bötticher, ist ein anerkannter Zeichner von Tapetenmustern. Er lässt sich 1875 in Wurzen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Leipzig, nieder und heiratet 1876 Rosa Marie Engelhart. Er beginnt zu schreiben, vor allem humoristische Verse, die er mitunter selbst illustriert und die sogar zum Teil in Reclams Universal-Bibliothek veröffentlicht werden. Seine drei Kinder werden geboren: 1879 Wolfgang, 1882 Ottilie und schließlich am 7. August 1883 Hans, der das Talent zum Zeichnen und Dichten von ihm geerbt hat. Seine Geburtsstadt erlebt er aber so gut wie gar nicht, denn schon vier Jahre später zieht die Familie um nach Leipzig, wo sie am Stadtrand an der Alten Elster wohnt. Hans ist fantasiebegabt, aber kein guter Schüler. Doch angeregt durch die schriftstellerische Tätigkeit seines Vaters beginnt er früh kreativ zu sein: Als Geschenk für diesen verfasst er schon mit neun Jahren das Heft Die Landpartie der Tiere, kleine Verse, die er auch selbst illustriert.
Später wird Hans vom Gymnasium verwiesen, weil er – so berichtet er selbst – in der Pause zu einer der damals üblichen Völkerschauen in den Leipziger Zoo verschwindet, sich von einer Samoanerin am Unterarm tätowieren lässt und sich damit dann vor der Klasse brüstet. Als Gegenleistung hat er der Frau aus dem Weihnachtsbaumschmuck seiner Familie glitzernde Tannenzapfen, Kugeln und einen kleinen Knecht Ruprecht geschenkt. Die Samoanerin schmückte mit diesen Preziosen mitten im Sommer ihre schwarzen Haare. Diese Selbständigkeit sollte sich als typisch für Hans Bötticher erweisen: verrückte Ideen, die Aufmerksamkeit erregen, deren Konsequenzen er aber auch zu tragen hat.
Damit er einen ordentlichen Schulabschluss bekommt, stecken ihn seine Eltern in eine private Realschule, die er 1901 mit der Mittleren Reife, dem sogenannten Einjährigen, verlässt. Jetzt aber ist er nicht mehr zu halten. Er will etwas erleben. Er wird Seemann, das heißt, er ist auf diversen Schiffen Hilfsarbeiter beim Ein- und Ausladen und wird auch zu allen sonstigen Arbeiten herangezogen, die anfallen. Jedenfalls kommt er in dieser Zeit in der Welt herum und kann später die beeindruckenden Ziele beim Namen nennen: Westindien, British Honduras, Venedig, Konstantinopel, Odessa, Algier, England, New York, Lissabon, Rio, Buenos Aires, Madeira und Narvik. Dass er oft den Hafen gar nicht verlassen hat, also die genannten Orte keineswegs wirklich »erlebt« hat, muss ja nicht jeder wissen.
Mit zwanzig Jahren beginnt er eine Kaufmannslehre in Hamburg, muss dann aber zunächst noch ein Jahr zum Militär. Wunschgemäß kommt er zur Marine, die er 1905, zum Bootsmannsmaat befördert, verlässt. Danach setzt er seine Lehre fort und schließt sie auch ab. 1907 wird er von seiner Firma nach Leipzig versetzt. Doch dann kündigt Hans, der noch immer das Abenteuer sucht, seine Stelle, geht zu Fuß nach Rotterdam und nimmt die Fähre nach Hull in England, das ihm aus seiner Seemannszeit noch ein Begriff war. Doch entgegen seiner Annahme kann sich hier niemand mehr an ihn erinnern und er findet keine Stelle auf einem Schiff. So arbeitet er als Zeitungsverkäufer, ist zeitweise obdachlos und kehrt schließlich auf abenteuerlichen Wegen nach Deutschland zurück.
Es zieht ihn nach München, wie viele, die künstlerisch etwas werden wollen, denn das ist es, was Hans Bötticher jetzt will. Er möchte das Schreiben zu seinem Beruf machen. Er wohnt bei Selma Kleinmichel, genannt Seelchen (später etwas abgeschwächt Seele), die er aus Kindertagen kennt. Ihr verstorbener Mann Julius hat einige Bücher von Georg Bötticher, also seinem Vater, illustriert. Seelchen vermietet Zimmer ihrer großen Münchner Wohnung. Weil Hans bei der Betreuung ihrer alten Mutter mithilft, kommt er bei ihr sogar gegen freie Kost und Logis unter.
Abends verkehrt Hans jetzt in der Kneipe »Simpl«, die eigentlich »Simplicissimus« heißt, wie die bekannte satirische Zeitschrift, die in München erscheint. Er bekommt hier die erhofften Kontakte zu Künstlerkreisen. Gedichte von ihm erscheinen in der Zeitschrift Grobian, die zwar alles veröffentlicht, ihm aber nur einmal fünf Mark bezahlt. Einige Monate betreibt Hans in München sogar (wenn auch erfolglos) einen Tabakladen. 1910 erscheinen zwei Büchlein mit Gedichten für Kinder: Kleine Wesen (14 Seiten) und (zusammen mit Ferdinand Kahn) Was Topf und Pfann’ erzählen kann (32 Seiten). Außerdem veröffentlicht er in diesem Jahr das Büchlein Gedichte.
In dieser Zeit, also ganz zu Beginn seiner literarischen Karriere, hat ihn Dora Kurtius aus Eisenach im »Simpl« kennengelernt. In diesem beliebten Lokal in der Türkenstraße ist die resolute und geschäftstüchtige Kathi Kobus die Wirtin. Ihre Kneipe ist bei den Münchner Faschingsumzügen stets mit einem eigenen Wagen vertreten, was ihre Bedeutung illustriert. Der vordere Raum des »Simpl« ist die Schankstube, von der ein Verbindungsgang, »Darm« genannt, in den hinteren Raum führt. Hier gibt es Tische mit weißen Decken unter einem schrägen Atelierfenster. An die fünfzig Personen passen hinein, aber Kathi macht es möglich, auch das Dreifache an Leuten unterzubringen. Den Tischen gegenüber befindet sich ein Podium, ungefähr drei Quadratmeter groß, auf dem auch noch ein Klavier Platz hat. Kathi hat die Zeichen der Zeit erkannt: Die Leute wollen mit Darbietungen unterhalten werden, und so treten hier Personen auf, die eigene oder fremde Texte vortragen. Erich Mühsam und Ludwig Scharf sind die bekanntesten von ihnen. Aber auch Hans Bötticher betritt bald die Bühne und avanciert schnell zu einem der Hausdichter, gehört also zu denen, die hier sehr oft auftreten und auch etwas dafür bekommen. Er muss zweimal am Abend vier bis fünf seiner Gedichte vortragen und erhält dafür zwei Schoppen Magdalener und eine Mark in bar, die er vor Ort in Alkohol umsetzt. Und er verfasst auf Wunsch der Wirtin zum siebenjährigen Bestehen der Kneipe am 1. Mai 1909 als Privatdruck das 48-seitige Heftchen Simplicissimus Künstlerkneipe und Kathi Kobus.
Dora Kurtius mag diesen Bötticher und erkennt schnell seine miserable finanzielle Situation. So schickt sie ihm auch schon mal Geld. Und sie hat in der Zeitung eine Stellenanzeige des Grafen Yorck von Wartenburg gesehen, der einen Privatbibliothekar sucht, also jemanden, der Ordnung in seinen Buchbestand bringt. Ihm hat sie Böttichers Adresse mitgeteilt. Und der Graf stellt ihn 1912 für einige Monate auf dem Schloss Klein-Oels in Niederschlesien ein, etwa vierzig Kilometer von Breslau entfernt. Mit einer festen Einnahmequelle, mit genug Zeit und im Umgang mit den Büchern kann Hans Bötticher, der darunter leidet, nicht studiert zu haben, vieles an Bildung nachholen.
Neben der Tätigkeit in der Bibliothek schreibt Bötticher weiter Gedichte. 1912 veröffentlicht er im Piper-Verlag München seinen kleinen Gedichtband Die Schnupftabaksdose. Vom 1. Januar bis Ende März 1913 arbeitet er wieder in einer Bibliothek, diesmal in der des Kammerherrn von Münchhausen auf Burg Lauenstein bei Probstzella in Oberfranken. Anschließend fährt er zum ersten Mal nach Eisenach, um Dora Kurtius zu besuchen. Sein Novellenband Ein jeder lebt’s ist gerade bei Albert Langen in München erschienen. Er widmet ihn Seelchen. Mit Ausnahme von zwei der zehn Geschichten waren alle zuvor in Zeitschriften oder Zeitungen abgedruckt. Hans hat für das Buch ein Honorar bekommen und kann die Mädchen der Sprachschule sogar mehrmals in die Konditorei einladen.
Er ist jetzt fast dreißig und sucht eine Ehefrau. So verliebt er sich in Eisenach in eines der Mädchen, in Alma Baumgarten. Da er sich Namen schwer merken kann, wählt er für Personen oft bildhafte Bezeichnungen. Alma ist »Maulwurf«, denn sie ist kurzsichtig und trägt ein dunkles Samtkleid, ein Stoff, den Hans besonders liebt. Zu Ostern 1913, also schon nach wenigen Wochen, verlobt er sich mit ihr, der Tochter eines Lokomotivführers. Allerdings sind ihre Eltern im fernen Ludwigshafen am Rhein damit überhaupt nicht einverstanden, und die Verlobung wird auf deren Druck hin ziemlich umgehend wieder gelöst. Den Sommer 1913 über arbeitet der Bibliothekar als Fremdenführer auf Burg Lauenstein, anschließend hält er sich wieder in München auf. Dann kommt der Krieg, in den er, wie so viele, beigeistert zieht. Große Abenteuer, wie er sie sich erhofft hat, erlebt er jedoch als Soldat nicht. Seit dem 1. August 1914 ist Bötticher bei der Kriegsmarine, was sein Wunsch war, versieht aber seinen Dienst meist auf Sperrschiffen vor der Nord- und Ostseeküste und beneidet seine Kameraden draußen auf hoher See.