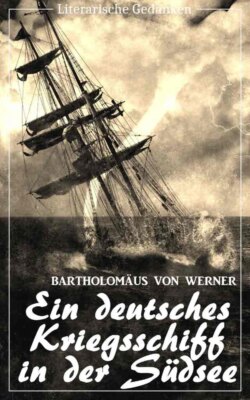Читать книгу Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee: Die Reise der Kreuzerkorvette Ariadne in den Jahren 1877-1881 (Bartholomäus von Werner) (Literarische Gedanken Edition) - Bartholomäus von Werner - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1. – Die Magelhaens-Straße.
ОглавлениеAn Bord S. M. S. „Ariadne“, 14. Januar 1878.
Die Südsee ist das Ziel unsers Schiffes. Dort von der Hauptstation, den Samoa-Inseln aus, soll ich als Commandant des Schiffes mit diesem die weitverzweigten, sich über ein schier endloses Gebiet erstreckenden deutschen Handelsinteressen schützen und fördern, unsern dort wirkenden tapfern Landsleuten Schutz und Schirm geben. Ich kann mir allerdings noch kein Urtheil darüber bilden, was ich dort finden werde, wie ich die mir gestellte Aufgabe lösen kann und lösen werde, denn die Südsee ist mir trotz der Vorstudien, welche ich bisher gemacht habe, noch immer ein so unbekanntes Gebiet voller Räthsel, daß ich das Grübeln aufgegeben habe und geduldig der Zeit warten will, wo ich mit eigenen Augen sehen und nach Selbsterlebtem urtheilen kann.
Die sich so häufig widersprechenden Berichte über jene fernen Inseln haben aber in mir den Entschluß zur Reife gebracht, auf dieser Reise von meiner Abneigung, Reiseschilderungen zu verfassen, abzusehen und meinen Angehörigen über meine eigenen Erlebnisse getreulich Bericht zu erstatten, damit sie Gelegenheit finden, ihre Kenntniß von Land und Leuten zu erweitern. Und so will ich denn schon mit der Magelhaens-Straße, der Pforte zu dem südlichen Theil des Stillen Oceans oder der Südsee, in die ich noch heute einzulaufen hoffe, den Anfang machen und vorher der rückliegenden Zeit nur soweit gedenken als nothwendig, daß der Kreis unserer Erdumsegelung am Schluß der Reise auch wirklich geschlossen ist.
Am 3. November v. J. haben wir den heimatlichen Strand verlassen, durch Sturm und Regen, Kälte und Nebel unsern Weg durch die unwirthliche Nordsee und späterhin auch durch die nicht minder unfreundliche Bai von Biscaya gesucht und gefunden.
Am 20. morgens 8 Uhr passirten wir das östliche Cap von Madeira und hielten damit gewissermaßen unsern Einzug in die Tropen. Der nordische Spätherbst mit all seinen Unannehmlichkeiten lag hinter uns; wie durch Zauberschlag waren wir in eine andere Welt versetzt. Ein weicher, warmer, mit Blumen- und Waldesduft gesättigter Hauch umfing uns; das Meer mit seiner wunderbaren blauen Farbe war ein anderes; statt der niedrigen, in Nebel und Regen gehüllten deutschen und englischen Küsten lag, von den Strahlen der niedrig stehenden Sonne goldig überhaucht, die hohe, mit ihren Berggipfeln in den Wolken verschwindende Südküste Madeiras vor unsern entzückten Blicken, so schön wie nur diese Perle unter den Inseln es sein kann. Am 21. abends 10 Uhr, nach Einnahme von Kohlen und Proviant in Funchal waren wir wieder unter Segel, auf dem Wege nach Rio de Janeiro.
Die schöne Fahrt unter Segel durch die berauschende Passatzone des Atlantischen Oceans nahm auch ihr Ende. Am 16. December morgens mit Tagesanbruch lag der Schlafende Riese, jener das Wahrzeichen von Rio de Janeiro bildende mächtige Gebirgszug, vor unsern Blicken, und um 12 Uhr mittags ankerten wir in der herrlichen Bai zu Füßen der großen Stadt.
Unser Aufenthalt in Rio, welcher auf 4 bis 5 Tage berechnet gewesen war, dehnte sich infolge besonderer Verhältnisse zu einem elftägigen aus, wodurch ich Gelegenheit fand, von der liebenswürdigen Gastfreundschaft unsers Consuls Gebrauch zu machen und unter seiner Führung auch die großen Naturschönheiten der Umgebung der Stadt kennen zu lernen und mit Entzücken zu genießen.
Am 27. December verließen wir Rio und damit die heiße Zone wieder, denn schon am 30. fing es an zu wettern und zu stürmen, und am 1. Januar schon trugen wir wieder warme Kleider, obschon wir uns im Sommer der südlichen Halbkugel befanden.
Nach mancherlei Fährlichkeiten sind wir nun hier an der südlichsten Spitze Südamerikas angelangt, und die Besatzung ist damit beschäftigt, die Takelage unsers Schiffes für die Fahrt durch die Magelhaens-Straße zu erleichtern, um dem Wind, welcher uns nach allen Erfahrungen wahrscheinlich während der ganzen Fahrt mit Sturmesstärke entgegenwehen wird, möglichst wenig Widerstand zu bieten.
Magelhaens-Straße, 23. Januar 1878.
Da wir jetzt am Ende unserer Fahrt durch die Magelhaens-Straße stehen, will ich einen Rückblick auf dieselbe werfen.
Am 14. Januar abends liefen wir von dem Atlantischen Ocean aus in die Magelhaens-Straße ein, mußten aber wegen der eingetretenen Dunkelheit und der unberechenbaren starken Strömungen (der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt hier 13 m) dicht an deren Eingang ankern und konnten erst am 15. morgens 2½ Uhr mit dem ersten Morgengrauen die Fahrt fortsetzen. Der Morgen war klar und schön, wenn auch kalt, denn wir hatten, da der hiesige Januar unserm Juli entspricht, im Hochsommer auf einer gleichen Breite wie Leipzig nur 6-7° C. Das in Sicht befindliche Land ist ohne Reiz, niedriges Sandland ohne Baum und Strauch, eine endlose Wüste, welche nicht eine Spur von Menschen aufweist und nur an der Meeresküste von unzähligen Scharen der verschiedensten Arten Wasservögel bewohnt wird. So reizlos die ganze Umgebung für das menschliche Auge ist, so interessant wird die Fahrt als solche für den Seemann. Jeder Augenblick bringt Abwechselung, weil die Straße nicht nur fortgesetzt ihre Richtung ändert, sondern auch noch viele Untiefen eine öftere Cursänderung nothwendig machen, sodaß die gespannteste Aufmerksamkeit erforderlich ist, zumal wenn das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten oder 3 deutschen Meilen in der Stunde durch das Wasser eilt. Zeitweise befindet es sich auf einer großen Wasserfläche; nach einer halben Stunde steuert es durch einen engen Kanal von nur 500 m Breite; dann wieder zwischen dicht beieinander liegenden Inseln hindurch, geht danach mit einem scharfen Bogen dicht unter die Küste des Festlandes und verläßt nach einer kurzen Weile diese Seite wieder, um eine Insel anzusteuern, unter deren Küste der Curs so nahe vorbeiführt, daß man ohne Anstrengung einen Stein ans Land werfen könnte; und so geht es stunden-, in der Folge gar tagelang fort. Der Seemann muß hier auf dem Platze sein, er findet aber ein so reiches Feld vollster Thätigkeit und Aufregung, daß die mit einer solchen Fahrt verbundenen Strapazen in den Hintergrund gedrängt und nicht weiter beachtet werden. Denn eine Strapaze ist es wahrlich, wenn man morgens um 2½ Uhr bei noch kaum durchbrechendem Tageslicht den Ankerplatz verläßt und mit schneller Fahrt in ein unbekanntes Fahrwasser hineinsteuert, welches mit dem Vorschreiten des Tages immer schwierigere Passagen bringt, die dem Commandanten verbieten, die Commandobrücke auch nur auf Augenblicke zu verlassen, und ihn zwingen, dort bis zum Einbruch der Nacht, wo in irgendeinem kleinen Hafen geankert wird, auszuharren. So steht man, ohne sich von der Stelle zu rühren, viele Stunden ununterbrochen in ungewohnt frischer Luft, welche den in den Tropen verweichlichten Körper stark angreift; die Augen ruhen entweder auf dem fortwährend wechselnden Landpanorama oder auf der in einem Glaskasten sicher untergebrachten Karte; alle Sinne sind in Thätigkeit, um den richtigen Curs zu wählen, der Maschine den zweckmäßigsten Gang anzuweisen und dem Ruder die richtige Lage zu geben. Die Mahlzeiten müssen auch auf der Commandobrücke eingenommen werden, schmecken allerdings vortrefflich, wenngleich man hierbei erst bemerkt, daß die Lippen von der scharfen Luft schon aufgerissen sind, ohne dabei indeß zu ahnen, daß das ganze Gesicht bereits halb wund ist. Ein scharfer Sturm weht uns entgegen und peitscht uns den von dem Schiffe aufgeworfenen Salzwassergischt in das Gesicht; glücklicherweise regnet es aber nicht, trotzdem es in dieser Gegend immer regnen soll. Doch dies ist nicht richtig, es regnet allerdings vor uns, hinter uns, links und rechts; nur wo die „Ariadne“ fährt, lacht die Sonne, als ob sie wie bisher uns auch in dieser verrufenen Gegend nicht verlassen wolle.
Um zu zeigen, daß das Wetter es wirklich gut mit uns meint, will ich hier einige Stellen aus den Segelanweisungen, welche alle bisher gesammelten Erfahrungen enthalten, ausziehen und einfügen; ein Vergleich zwischen diesen Notizen und dem weitern Verlauf unserer Reise wird dann am besten die Richtigkeit meiner Behauptung beweisen.
1. „August, September und October sind die kältesten Monate; westliche Winde, Regen, Hagel und Schnee sind dann vorherrschend. December, Januar und Februar sind die wärmsten Monate, die Tage sind lang und es kommt zuweilen etwas gutes Wetter vor; aber westliche Winde, welche häufig zu starken Stürmen anschwellen, mit heftigem Regen sind selbst während dieser Jahreszeit vorherrschend, welche weniger Sommer mit sich führt wie irgendein anderer Theil unserer Erde.
2. „Der Gipfel dieses ausgezeichneten Berges (Mount Burney), welcher gegen 1850 m hoch und mit ewigem Schnee bedeckt ist, ist selten sichtbar; sollte aber ein Vorbeireisender glücklich genug sein, einen klaren Tag zu finden, so wird er schwerlich je die Pracht dieses Panoramas vergessen.
3. „Das Charakteristische in dem Wetter dieser Kanäle ist weniger die Stärke des Windes, als der fast unaufhörliche Regen. Tag um Tag, wenn der Seemann unglücklicherweise länger hier verweilen sollte, wird er diesen stetigen Niederfall zu erdulden haben, es sei denn, daß er so glücklich ist, in einem jener seltenen Durchbrüche von lieblichem Wetter anzukommen, welches zuweilen vorkommt. Dann allerdings wird er die interessanteste Fahrt finden mit ruhigem Wasser, guten Ankerplätzen, umgeben von der großartigsten (most glorious) Scenerie; doch diese Fälle sind gar selten, und er wird schon glücklich zu nennen sein, wenn er überhaupt einmal den Regenrock ablegen kann, welchen er anzog, als er um Cap Tres Montes ging. Eine Jahreszeit ist so gut, oder besser gesagt so schlecht wie die andere, immerhin aber ist der Sommer wegen seiner geringern Kälte und der längern Tage für diese Passagen vorzuziehen.“
Diese Schilderung verspricht gewiß viel, und ebenso läßt die „Vineta“, welche vor zwei Jahren dieselbe Tour in beschränkterer Ausdehnung machte, sich vernehmen und klagt über das anhaltend schlechte Wetter, das sie zu erdulden hatte. Ein Vergleich dieser beiden Reisen zeigt auch in eclatanter Weise, von welchem Einfluß das Wetter auf derartige Reisen ist; denn zu derselben Strecke, welche die „Ariadne“ unter den günstigsten Wetterverhältnissen in 6 Tagen zurücklegte, gebrauchte die „Vineta“ mühsam gegen Wind und Wetter anringend 21 Tage. Doch zu unserer Reise.
Nachdem am 15. Januar etwa 80 Seemeilen zurückgelegt waren, vollzog sich allmählich ein Wechsel in der Scenerie. Wir waren den Ausläufern der Anden, des mächtigen Gebirgszuges, welcher mit seinen 7000 m hoch gelegenen Felsen- und Schneerücken das platte Land Patagonien von Chile und Peru trennt, näher gekommen und zeitweise entwickelten sich schon aus den vorbeijagenden Wolkenfeldern einzelne schneebedeckte Gipfel. Das untere Land zeigt jetzt auch einen andern Charakter: einzelne mit grünem Gestrüpp bewachsene Hügel und Felsen werden sichtbar, das Land hebt sich immer mehr und wächst langsam zunehmend bis zu 300 m hohen Bergen an, welche mit dichtem Wald bedeckt sind. Auffallend ist, daß in diesen frisch-grünen Wäldern kaum 150 m über dem Meeresspiegel große Schneefelder verstreut liegen, und daß trotz der geringen Kraft, welche die Sonne demnach im Hochsommer hier nur hat, große Scharen von Papagaien und Kolibris in den Sommermonaten ihren Wohnsitz in dieser Gegend aufschlagen. In Punta Arenas fanden wir diese Vögel allerdings noch nicht, da sie erst 14 Tage später erwartet wurden, in einem der nächsten Häfen trafen wir sie aber schon an. Würde man nur nach den hier lebenden Eingeborenen, ohne Rücksichtnahme auf die herrschende rauhe Witterung zu urtheilen haben, so wäre das Räthsel, wie diese buntgefiederten Bewohner der brasilianischen Urwälder hierherkommen, leicht gelöst, denn diese Menschen gehen ohne jede Kleidung vollkommen nackt, besitzen kein Heim, leben in einem elenden offenen Boot oder tragen sich an dem Fleck, wo sie gerade landen, aus Reisern eine Hütte in der Größe eines runden Tisches von etwa 1½ m Durchmesser zusammen, wo Mann, Frau oder Frauen (es herrscht Vielweiberei), große und kleine Kinder, oft 10-12 Personen, Unterkommen für die Nacht finden, wie ein Rudel Thiere zusammengeschachtelt und sich mit ihren Körpern gegenseitig erwärmend. Kälte, Wind und Regen machen keinen Eindruck auf ihre Nerven, eine wunderbare Menschenrasse in ihrer Art, da alle sonst in kalten Klimaten wohnenden Menschenstämme stets warm bekleidet sind. Ich werde später noch Gelegenheit finden, auf diese Eingeborenen zurückzukommen.
Küste des Feuerlandes in der Magelhaens-Straße.
Bald nachdem das flache Land hinter uns lag, näherten wir uns der chilenischen Colonie Punta Arenas, welche, früher als Verbrechercolonie gegründet, in der Neuzeit durch den regern Dampfschiffsverkehr eine andere Bedeutung erlangt hat. Die an der Küste steil aufsteigenden niedrigern Gebirgszüge von 300-400 m Höhe versagen dem Auge zwar noch den Blick auf die dahinter liegende mächtige Alpenwelt des Festlandes, das Auge kann nun aber frei über die düstern, unfruchtbaren, bis zu 2000 m Höhe aufsteigenden schwarzen Felsmassen des Insellandes Feuerland, welches sich auf der andern Seite der Wasserstraße unheimlich aus der See erhebt, schweifen: schwarzes, kaltes, zerklüftetes Gestein ohne eine Spur von Leben und Pflanzenwuchs, welches dem Auge nirgends Ruhe gönnt, da keine Linie zu finden ist, welche man festhalten könnte. Ein Pic steigt neben dem andern empor, erhebt seinen Gipfel immer noch wilder und trotziger wie sein Nachbar und erweist dem menschlichen Auge dann eine wahre Wohlthat, wenn er mit Schnee bedeckt ist. So frostig der Anblick des Schnees sonst macht, hier, inmitten dieses schwarzen Höllengesteins, um welches unermeßliche schwere Wolkenbänke von tiefgrauer Farbe sich lagern und, von dem heulenden Sturme getrieben, ihre Wasserballen in die unzähligen tiefen Schluchten hineinzwängen, hier ist der Schnee erwärmend. Hätte Dante dieses Stück Erde gekannt, seine Hölle wäre nach diesem Feuerland gebildet worden, welches ja auch richtige Teufel in sich birgt. Der Name „Feuerland“ ist allerdings nicht von vulkanischem Feuer hergeleitet, sondern hat einen harmlosen Ursprung; er ist dem Umstande zuzuschreiben, daß die ersten Entdecker überall am Lande kleine Rauchsäulen sahen, welche nie erloschen. Die Eingeborenen dieses nassen Landes, wo die Erzeugung des Feuers so sehr schwer ist, sind gezwungen, wo sie gehen und stehen, stets ein Feuer zu unterhalten, wenn sie dieses wichtige Element nicht zeitweise verlieren wollen; es wird also immer da, wo Menschen sich aufhalten, auch die unentbehrliche Rauchsäule zu sehen sein. Daß hier, wie ich vorhin sagte, auch wirkliche Teufel in Menschengestalt hausen, dürfte vielleicht aus dem nachfolgenden Auszuge aus Darwin's Reise um die Erde hervorgehen:
Hütte der Feuerländer.
„Die verschiedenen Stämme sind Kannibalen, sobald sie miteinander in Fehde leben. Dies beweist auch die Aussage Jemmy Button's (ein Junge, welcher während zweier Jahre auf Kosten eines englischen Seeoffiziers in England erzogen und mit dem Schiffe, auf welchem Darwin war, dann zurückgebracht wurde), wonach die Eingeborenen im Winter, wenn sie sehr unter dem Hunger leiden, erst die alten Frauen schlachten und verschlingen, bevor die Hunde an die Reihe kommen, denn die Hunde fangen Ottern, alte Frauen aber nichts. Die Frauen werden derart getödtet, daß sie über Rauch gehalten werden, bis sie erstickt sind. Der Junge ahmte auch mit sichtlichem Vergnügen in spaßhafter Weise das Geschrei der Opfer nach und beschrieb die Körpertheile, welche am besten schmecken. Oft sollen die alten Frauen, sobald sie den Zeitpunkt gekommen wähnen, in die Berge flüchten, sie werden aber von den Männern dann gejagt, um in ihre Hütte gebracht und geschlachtet zu werden. — Schrecklich, wie solch ein Tod durch die Hand der Freunde und Verwandten sein muß; schmerzlicher noch ist es daran zu denken, was diese Frauen empfinden müssen, wenn der Hunger sich einzustellen beginnt.“
Nachmittags 3 Uhr am 15. Januar, nach Zurücklegung von 120 Seemeilen an diesem Tage, ankerten wir vor Punta Arenas, dessen kleine Holzhäuser kurz vorher als erste Zeichen menschlichen Lebens hinter einer kleinen Landzunge zum Vorschein gekommen waren. Dieser weit vorgeschobene Posten menschlichen Unternehmungsgeistes zeigte allerdings ein anderes Bild, als wir nach den vorhandenen Beschreibungen erwarten konnten. Eine vor wenig Wochen stattgehabte Soldatenemeute hatte traurige Spuren hinterlassen. Die aus 100 Soldaten gebildete Garnison soll von ihrem Commandanten so barbarisch behandelt worden sein, daß sie schließlich zum Aufstand getrieben wurde. Sie tödteten und verstümmelten den Commandanten, rissen ihm Augen und Zunge aus, schnitten Nasen und Ohren ab und zerstückten den ganzen Körper. Darauf befreiten sie die Gefangenen (der Platz ist noch Strafcolonie), etwa 80 an der Zahl, und fingen dann an zu brennen und zu morden. Alle größern Gebäude wurden eingeäschert und etwa 80 Personen verloren ihr Leben. Nachdem die Meuterer auf diese Weise zwei Tage gehaust hatten, wurden sie unsicher, da täglich ein in der Nähe befindliches chilenisches Kanonenboot eintreffen konnte, und verließen den verwüsteten Platz. Vorher aber bemächtigten sie sich aller Frauen und Mädchen, deren sie habhaft werden konnten, und schleppten diese mit Gewalt mit sich in die Pampas Patagoniens, wo ihnen mit den dortigen Indianern jedenfalls ein Krieg bis aufs Messer bevorsteht. — Wenige Tage vor unserm Eintreffen hatte ein chilenisches Kriegsschiff die neue Garnison und eine Untersuchungscommission gebracht.
Der kleine Ort liegt recht hübsch dicht am Ufer des hier stets wellenlosen Meeres, lehnt sich im Rücken an den Fuß eines Berges an und ist umsäumt von jungfräulichem Urwalde. Die in den Gebirgen lagernden großen Schneemassen führen in kleinen Flüssen vorzügliches Wasser zum Strande, wo in den geringern Tiefen des Meeres ein unerschöpflicher Reichthum an wohlschmeckenden Fischen herrscht. Rindvieh und Schafe gedeihen vortrefflich und finden auf dem herrenlosen Lande die saftigste Nahrung im Ueberfluß. Auch Pferde sind fast mehr wie Menschen vorhanden, denn hier in diesem kleinen Dorfe ist sogar der Bäckerjunge zu faul, das Brot zu Fuße auszutragen, er setzt sich dazu aufs Pferd. Der Wald liefert ein vorzügliches Holz, das vorläufig noch als werthlos betrachtet wird. Die mächtigen Stämme — ich habe solche von 4 Fuß Durchmesser gesehen — haben einen vollständigen Eisenkern; schwere Schmiedehämmer, welche als Keile zum Auseinandertreiben des Holzes benutzt wurden, zersprangen unter den wuchtigen Hieben eines noch schwerern Hammers in dem Holze, ohne es zu spalten. Jeder kann sich soviel Holz nehmen wie er will; wir haben an einem Tage 40 cbm Kernholz gefällt und an Bord geschafft, ohne Zahlung dafür zu leisten, weil den Ansiedlern auf diese Weise das Land ohne eigene Mühe urbar gemacht wird. Die Häuser, oder besser Holzhütten bestehen selten aus mehr als zwei kleinen Zimmern; Comfort ist nirgends zu finden. Ackerbau und Gartencultur fehlen vorläufig noch ganz, die Leute leben nur von den durchkommenden Schiffen, denen sie vornehmlich Fleisch verkaufen. Einige Meilen von diesem Ort entfernt ist noch eine kleine Schweizercolonie, welche sich mit Landwirthschaft beschäftigt und ihre Erzeugnisse hierher abliefert. Von diesen Producten erhielten wir recht gute Butter und namentlich ganz vorzüglichen Kopfsalat. Für die übrigen Erzeugnisse der Schweizercolonie, Gemüse und Kartoffeln, war die Zeit der Reife noch nicht gekommen, sodaß wir uns von ihrer gerühmten Vortrefflichkeit nicht selbst überzeugen konnten.
Der Totaleindruck dieses Ortes ist, von innen gesehen, ein öder, schmutziger und wüster. Die Straßen sind allerdings regelmäßig und breit, ja so großartig angelegt, daß sie einer großen Stadt Ehre machen würden, die menschlichen Wohnungen zeigen aber sofort, daß nur mittellose Abenteurer, welche kein anderes Streben als ihr Leben zu fristen kennen, ihr zeitweiliges Heim hier aufgeschlagen haben. Natürlich sind die Deutschen wie überall auch hier vertreten, bilden aber das beste Element.
In Punta Arenas wurde mir die große Enttäuschung zutheil, daß ich keine Kohlen, auf die ich sicher gerechnet hatte, erhalten konnte. Es ist eine Kohlengrube, welche sich in soliden englischen Händen befindet, in nächster Nähe, die Meuterei hatte aber auch hier störend eingegriffen, da die Soldaten, die mit Genehmigung der Regierung die Grubenarbeiter gewesen waren, jetzt fehlten. So blieb mir nur übrig, mit meinen Kohlen hauszuhalten und das Brennmaterial durch Holz zu ergänzen. Auch meine Reisedisposition für die Straße erhielt dadurch eine Abänderung; ich hatte vorher auf einen drei- bis viertägigen Aufenthalt in Punta Arenas gerechnet, ließ mich aber jetzt nicht länger aufhalten, da ich in dem herrenlosen Lande, durch welches ich noch 600 Seemeilen zurückzulegen hatte, überall Holz schlagen konnte. Ich blieb daher nur noch den 16. in Punta Arenas und benutzte diesen Tag zum Holzschlagen. Nachts 12 Uhr war das Holz an Bord, am 17. morgens 2 Uhr war das Schiff fertig und weiter ging die Reise aus der Nacht zum Tage.
Ich hatte einige Stunden geschlafen und stand nun in der rauhen Nachtluft mit der Gewißheit auf der Commandobrücke, dieselbe vor 9 Uhr abends nicht wieder verlassen zu können. Die Aufgabe, welche ich mir gestellt hatte, war, bis zum Eintritt der Dunkelheit einen Hafen zu erreichen, welcher von unserm Ausgangspunkt 170 Seemeilen entfernt lag. Der Weg dahin führte durch eine enge Felsenstraße, in welcher der Sturm stets mit der Gewalt eines Orkans wüthen soll; die in ihrer Großartigkeit auf dieser Welt einzig dastehende Gebirgswelt soll fast immer bis zum Wasserspiegel herunter in dichtes grauschwarzes Gewölk gehüllt sein, aus welchem der Regen in Strömen herniederfällt; die Navigirung soll nur dadurch möglich werden, daß der Sturm ab und zu das Gewölk auf Augenblicke zertheilt und so dem Auge Gelegenheit gibt, den Curs bis zur nächsten Zertheilung der Wolken festzustellen. Dies war der vor mir liegende Tag mit seinen Aussichten. Fand ich wirklich solches Wetter, dann war die Erfüllung meiner Aufgabe unmöglich und ich konnte höchstens zwei Drittel des vorgenommenen Weges zurücklegen, mußte dann aber auch für die ganze Passage etwa die doppelte der in Ansatz gebrachten Zeit rechnen. Einigermaßen gruselig war mir zu Muthe, als ich meine Fahrt in der dunkeln Nacht mit 10 Seemeilen Geschwindigkeit und mit der Aussicht begann, nun während etwa 10 Tagen, wenn auch in sicherm Fahrwasser, täglich 12-15 Stunden dem Regen und Sturm voll ausgesetzt auf der Commandobrücke zuzubringen. Immerhin vertraute ich aber meinem guten Glück und gab zunächst keinem Zweifel an dem Gelingen des festgesetzten Planes Raum. Allerdings hatte ich noch einen vertrauenerweckenden Führer zur Seite, nämlich den Bericht unserer Corvette „Vineta“, welche als erstes deutsches Kriegsschiff die Passage durch die Magelhaens-Straße gemacht hat. Wenn auch dieser Bericht die vorzüglichen englischen Segelanweisungen als durchaus zuverlässig anerkennt, so vertraut man dem, was Kameraden gesehen und erfahren haben, doch immer mehr; man fühlt sich dort, wo ein Bruderschiff schon gewesen ist, eher heimisch.
Bis gegen 8 Uhr morgens bleibt der Curs in offenem Fahrwasser südlich und durch die an der Westseite liegenden Berge gegen den erwarteten Weststurm geschützt. Der Morgen läßt sich gut an, der Sonnenaufgang war zwar nicht sehr vertrauenerweckend gewesen, die Sonne zeigt aber doch wenigstens ab und zu ihr erwärmendes Gesicht. Zu unserer Rechten liegen weich geformte Berge mit dichtem frischen Wald bestanden, aus dessen grünem Laub hier und dort verstreut blendend weiße Schneefelder hervorlugen. Die Berge steigen direct aus dem Wasser auf, bilden aber doch hin und wieder freundliche kleine Einbuchtungen, welche den vorbeifahrenden Schiffen gute Ankerplätze bieten, aber auch einen grell in die Augen springenden Beweis liefern, wie alles Lebende, was die Natur hervorbringt, dazu dient, von dem Stärkern wieder vernichtet zu werden. Hier in diesen geschützten lieblichen Baien steigen die der Magelhaens-Straße eigenthümlichen mächtigen Wasserpflanzen tief von dem Meeresgrunde bis zu einer Höhe von 10 m hoch aus und geben mit ihren 6-7 dcm langen und 2 dcm breiten Blättern den kleinen niedern Wasserthieren Schutz und Nahrung. In diesem Wasserpflanzenwald lebt aber auch die junge Fischbrut, welche ihr Leben mit den kleinern Thieren erhält, dieses aber auch sofort hingibt, sobald sie das schützende Dach verläßt, denn außerhalb der Pflanzen stehen Scharen von Raubfischen, welche jeden kleinen Wasserbewohner ihresgleichen erbarmungslos verschlingen, sobald er sich aus seinem Versteck hinauswagt. Wieviel Mord und Vernichtung spielt sich nicht an einem Tage in einem solch kleinen Stück Wasser ab?
Zu unserer Linken liegt eine weite Wasserfläche, begrenzt durch in blauen Dunst gehülltes Bergland, durch dessen weite Schluchten die noch hinter den Bergen niedrig stehende Sonne ihre Strahlen wirft und das wild geklüftete Alpenland magisch beleuchtet. Vor uns haben wir den Eingang zu der berüchtigten Felsenpassage mit einem Aussehen, welches einen schlimmen Tag verspricht. Das aus dem Wasser steil aufsteigende nackte Gestein ist infolge des ewigen Regens von tiefschwarzer Farbe, welche nur selten durch einige hellere Flecke unterbrochen wird. Sichtbar ist das Land dort überhaupt nur bis etwa 100 m über dem Wasser, von da ab ist alles in dicht übereinander geschichtete feste Wolkenmassen von tief blaugrauer Färbung gehüllt, in Wolkenbänke, welche so tief liegen, daß man sie mit den Mastenspitzen zu berühren glaubt und damit ihre Entladung herbeizuführen befürchtet. Regen erwartet man von ihnen aber nicht, sondern das schärfste Schneegestöber. Das Gewölk eines schweren Schneesturmes unserer Gegenden ins Vielfache übertragen gibt ein ungefähres Bild von der vor uns liegenden Wolkengestaltung und dem Aussehen der Luft. In diesen Sturm- und Regenkessel muß man hinein. Was hilft's! Mehr wie naß werden kann man ja nicht, also frisch drauf los.
Einige mächtige Walfische von 14 bis 18 m Länge — ich sehe im ganzen vier — spielen so harmlos in der Nähe des Schiffes, daß das Behagen, welches sie athmen, sich unwillkürlich dem Menschen mittheilt und sein Gemüth beruhigt. Hoch werfen sie aus ihren Spritzlöchern das Wasser in die Luft, strecken ihren mächtigen Kopf aus dem Wasser oder heben ihren kolossalen Rücken wie eine kleine Insel über die Wasserfläche, tauchen dann in die Tiefe und schnellen dabei den riesigen Schwanz aus dem Wasser, daß das hinterste Drittheil des Fisches für einen Augenblick senkrecht in die Luft ragt. Solch ein harmloses Spiel übt eine beruhigende Wirkung auf uns Zuschauer aus, die Gegend vor uns sieht sich schon gar nicht mehr so erschreckend an. Ein tüchtiges warmes Frühstück war oben in der frischen Luft mit köstlichem Appetit eingenommen; der kurze Rock, unter welchem eine warme wollene Weste sitzt, wird fest zugeknöpft, die Mütze fest in die Stirn gedrückt, der Kneifer auf der Nase zurechtgerückt und dann um 8 Uhr um das verschriene Cap Froward herumgejagt. Jetzt soll es kommen, Sturm und peitschender Regen! Ein frischer Sturm, welcher in diese 100 Seemeilen lange unabsehbare Felsenstraße eingekeilt an Stärke gewinnt, weht uns zwar in die Zähne, die Wolken über uns bilden eine feste undurchdringliche Decke; unten aber ist es schön klar, kein Hagel und kein Regen, kalte frische Luft und überall viel zu schauen. Was es zu sehen gibt läßt sich aber nur schwer schildern.
Die Gestaltung des Landes ändert unausgesetzt. Hier springt ein hohes, steiles Cap trotzig in die Straße vor und deckt die hinter ihm liegende tiefe Bucht; dort läuft das Land in eine weit vorgeschobene flache Spitze aus; an jener Stelle brechen aus den vorbeijagenden Wolken für Augenblicke scharf gezackte Bergkämme hervor; hier steigt senkrecht aus dem Wasser eine Felsenwand von dem Aussehen einer von Menschenhand sorgsam aufgebauten Riesenmauer auf; dort ziehen sich mächtige Kanäle, welche große Wasserstraßen nach einem andern Theil des Weltmeeres bilden, hin; hier liegen kleine, in frischem Laub prangende Inseln oder einzelne nur mit ihrer Spitze aus dem Wasser hervorragende Klippen, dort mehrere Quadratmeilen umfassende Inseln. Das alles vermag das Auge wol für Stunden und Tage, ja Wochen unausgesetzt zu fesseln, da es in seiner natürlichen Großartigkeit immer Neues und Interessantes bietet, in der Beschreibung wird es aber immer nur ein sehr verblaßtes Bild geben.
Ab und zu fegt der Sturm das Gewölk stellenweise fort und gestattet dann einen Blick in dieses eigenartige Gebirgsland, das noch im Hochsommer seine ewig starren Gletscher bis zum Meeresrand hinabsendet und gleichzeitig den an die Tropensonne gewöhnten Zugvögeln ein begehrenswerthes Asyl gewährt. Der Grundton des sich entrollenden Bildes ist Grau in Grau: eine grau erscheinende Wasserfläche als Vordergrund, graues Gewölk als Hintergrund. Aus diesem unbestimmbaren, farblosen und doch auf das Auge so mächtig wirkenden Grundton treten riesige Steinmassen, tiefschwarz gefärbte oder mit einer blendenden Schneedecke überzogene hohe Berge mit ihren entschiedenen und wilden Contouren scharf heraus. Das massige Unterland entsendet ungezählte scharfgeschnittene Pics in die Lüfte, welche bei annähernd gleicher Höhe scheinbar ganz willkürlich theilweise mit ewigem Schnee überzogen sind, theilweise mit vollkommenster Nacktheit prahlen und ebenso allen Unbilden des Wetters trotzen, wie die an ihrem Fuß lebenden Eingeborenen, mit welchen sie so große Charakterähnlichkeit haben. Zwischen jenen blendend weißen, zart überhauchten Berggipfeln und diesen schwarzen rauhen Gesellen liegen in tiefen unheimlichen Schluchten große, in ihrer ganzen Ausdehnung wol noch von keinem Menschenauge berührte Schneefelder, welche sich bis zum Meeresspiegel, bis dicht an die vorbeipassirenden Schiffe hinabsenken und auf ihrer Wanderung dahin sich allmählich aus duftiger Schneedecke von dem reinsten Weiß in starrende zerklüftete Gletscher von heller, bläulich-grüner Farbe umbilden, deren Mächtigkeit nach unserer Schätzung 5-8 m beträgt. Und neben diesen Gletschern findet das Auge an geschützten Stellen die üppigste Vegetation, den Urwald in seiner ganzen Schönheit mit seinen herrlichen Laubkronen, seinen Schlinggewächsen, Parasiten, elastischen Moosdecken und farbenprächtigen Blumen, über welchen in denselben Sommermonaten, die den nebenliegenden Schnee nicht zu schmelzen vermögen, nach glaubwürdigen Berichten die Kolibris über den Blumenkelchen schwirrend ihr Vernichtungswerk gegen die Insekten betreiben. Weiterhin öffnet sich die Wasserstraße, das Land tritt zurück, und man glaubt auf einem großen Binnensee zu sein, welcher keinen Ausgang zeigt. Einige Inseln vor uns scheinen den Abschluß zu bilden, auf diese ist der Bug des Schiffes gerichtet. Dort angekommen geht das Schiff in scharfem Bogen um eine derselben herum und läuft in einen von hohen Felswänden gebildeten Hohlweg ein. Der größte Theil der Straße behält jetzt den Charakter eines Hohlwegs von vorherrschend enormen Dimensionen.
Während der Fahrt versucht ein Boot mit Feuerländern das Schiff zu erreichen, jedenfalls um gegen Bogen, Pfeile und Felle andere Sachen, Taback und Eßwaaren einzutauschen. Da es die ersten Eingeborenen sind, welche wir zu Gesicht bekommen, so entsteht eine allgemeine Aufregung in dem Schiffe; die Offiziere drängen mich, auf das Boot zu warten, ich kann ihnen aber, so groß auch meine eigene Neugierde ist, nicht willfahren, da das Reiseprogramm in so enge Grenzen gezogen ist, daß ein kleiner Aufenthalt das ganze Gebäude umwerfen kann. Ich lasse indeß das Schiff an das Boot heranscheeren, um es dicht zu passiren und so einen flüchtigen Blick zu erhalten. Zwei junge nackte Männer führen die Ruder, eine nackte Frau das Steuer, die übrigen Insassen, mehrere Erwachsene und eine größere Zahl kleiner Kinder sitzen oder vielmehr kauern in der Mitte des Bootes, wo auch auf Steinen das nie fehlende Feuer unterhalten wird. Alle zusammen schreien und heulen, mit den Armen gestikulirend, aus Leibeskräften, um das Schiff zum Anhalten zu bewegen, aber wie schon erwähnt ohne Erfolg.
Der Berg Sarmiento auf dem Feuerland, Magelhaens-Straße.
Abends 8 Uhr scheint es mir doch zweifelhaft, daß wir vor Eintritt der Nacht den als Ziel gesetzten Hafen noch erreichen können; die Entfernung ist zwar nicht zu groß, aber vor uns sieht es so dick und drohend aus und der Seegang nimmt in der nun nach dem Stillen Ocean hin offenen Straße so merklich zu, daß ich mich entschließe, nach dem kleinen Hafen Port Angosto, welchen wir vor einer Viertelstunde passirt haben, zurückzulaufen. Der Eingang, keine 40 m breit, ist bald gefunden, und die „Ariadne“ geht, oft nur wenige Fuß von den Klippen entfernt, durch eine schmale Gasse in einen Kessel, welcher gerade genug Platz bietet, daß das Schiff ohne den Grund zu berühren sich vor dem Anker drehen kann. Die steilen Bergwände sind dicht bewaldet, einige kleine und ein größerer Wasserfall ergießen mit anheimelndem Geplätscher das geschmolzene Schneewasser von den Höhen hinab. Der Abend ist schön und ruhig, aber ohne Anziehungskraft für einen Mann, welcher 19 Stunden auf der Commandobrücke zugebracht hat und nach Verlauf von 5 Stunden Ruhe wieder dahin berufen wird, um das eben überstandene Tagewerk noch einmal durchzumachen.
Abends ging ich gleich, nachdem ich schnell einige Bissen zu mir genommen hatte, zu Bett, um sofort in einen tiefen traum- und bewußtlosen Schlaf zu verfallen. Um 2½ Uhr morgens wurde ich wieder geweckt — ein kritischer Moment. Niemand kann mich hier zur Eile treiben, mir vorschreiben, an diesem Tage weiter zu gehen oder eine so große Distanz abzulaufen, wie ich sie mir gesteckt habe; auch zwingen mich die natürlichen Verhältnisse nicht zu einem so großen Pensum, da in den vor uns liegenden Kanälen alle 20-30 Meilen Häfen zu finden sind. Durch das Wetter begünstigt habe ich an dem gestrigen Tage ein besonders großes Stück Weg zurückgelegt, ich bin über alle Begriffe müde — ein Wort und der Aufbruch wird verschoben oder ganz aufgehoben. Der Gedanke „beschleunigte Segelordre“ durchzuckt traumhaft mein Hirn und — „Reveille und Ankerlichten“ ist die Antwort auf den vielleicht schon mehrmals wiederholten Weckruf. Ich verlasse mein Lager, mache unter Absehung von dem gewohnten kalten Bade die den Verhältnissen entsprechende Toilette, nehme schnell ein warmes Frühstück ein, welches mein vortrefflicher, aber im Punkte des Schlafens sonst unverbesserlicher Diener heute ausnahmsweise schon bereit hat, und stehe nach 15 Minuten auf der Brücke, um in dem Dunkel der noch herrschenden Nacht die meinem Ruf willig gehorchende „Ariadne“ aus diesem kleinen Felsenlabyrinth hinaus in ein 500 Meilen langes hineinzuführen. Die Nachtluft ist kalt; die todten Bergmassen, von welchen her kein Ton eines lebenden Wesens zu hören ist, werfen tiefe Schatten auf die unter Windstille regungslos daliegende schwarze Flut und machen es unmöglich, die schwarze Wasserfläche von dem schwarzen Lande zu unterscheiden. Nichts ist zu hören als das dumpf nach oben schallende Arbeiten der rastlosen mächtigen Schiffsmaschine und das monotone Rauschen des von dem Schiffsbug aufgeworfenen Wassers, nur ab und zu unterbrochen von einem kurzen Rudercommando aus meinem Munde, welches von den Leuten am Ruder ebenso kurz erwidert wird. Die durchbrechende Tagesdämmerung nimmt dieser Fahrt bald das Geisterhafte des Anfangs. Zur Linken liegt die jetzt schon breite westliche Oeffnung der dort ihr Wasser mit dem des Stillen Oceans bereits mischenden Magelhaens-Straße; vor uns öffnet sich der Smyth-Kanal, in welchen unser Weg uns führt, theilweise noch versteckt im Morgendunst, welcher auch das umliegende Land verhüllt. Eine halbe Stunde später — die Sonne bricht mit einzelnen Strahlen durch die Wolken, gewinnt immer mehr an Macht, hat bald die Nacht- und Morgennebel verzehrt und beschert uns einen selten schönen Tag. Der über 1800 m hohe Mount Burney erhebt sich als regelmäßiger Kegel mit abgestumpfter Spitze, welche jedoch mit mehrern kleinen Pics geziert ist, majestätisch aus einer Ebene, die halbkreisförmig von einem hohen Gebirgszuge umrahmt ist, dessen Gipfel in ungezählte schneebedeckte Pics auslaufen. Die jetzt durch den wolkenlosen Aether ungehindert durchstrahlende, noch tiefstehende Sonne übergießt das vor uns liegende Bild mit einem seltenen Duft. Die in goldigem Schimmer erglänzenden Lichtseiten der untern Partien heben sich nur unmerklich von den Schattenseiten ab, da die Sonne kurz nach ihrem Aufgange nur zarte Schatten zu erzeugen vermag. Die von ihrer erhabenen Höhe aus weithin strahlenden jungfräulichen Gipfel spiegeln die Färbung des Aethers wieder und schimmern in einem fast ins Weiße übergehenden duftig zarten Grün. Die höher steigende Sonne bringt uns einen prachtvollen, windstillen und wolkenlosen Sommertag, wie er für eine Vergnügungsreise nicht schöner gewünscht werden könnte. Die Fahrt geht rastlos weiter, immer neue Bilder vor uns aufrollend, enge Hohlwege, Klippenstraßen, mit Inseln gezierte Alpenseen, freiere Passagen, welche den Blick weiter schweifen lassen — nur eins bleibt bis gegen Abend unverändert, das ist der herrliche Mount Burney, welcher über alles hinwegragend in fortwährend wechselnder und immer erhebend schöner Umgebung uns den Anblick seiner edeln Gestalt gönnt.
Es ist zwecklos, auf die Fahrt dieses Tages näher einzugehen, da jede neue Schilderung doch nur eine Wiederholung sein würde; aber ein uns an diesem Tage in der Collingwood-Straße und dem Sarmiento-Kanal noch gebotener Blick auf diese große Natur verdient doch besondere Beachtung. Das Bild war das schönste unserer ganzen bisherigen Reise und von so großartig wilder Schönheit, wie sie schwerlich in irgendeinem Theil unsers Erdballs wiedergefunden wird. Obwol meiner Schwäche bewußt, will ich dennoch versuchen, eine oberflächliche Skizze dieses erhabenen Naturbildes zu entwerfen.
Vor uns und zu unserer Rechten liegen die Sarmiento-Cordilleren, zwei regelmäßig hintereinander gereihte Gebirgsketten von etwa 25 Seemeilen Länge und 1000-1500 m Höhe. Die uns zugekehrte vordere Kette steigt direct aus dem Wasser auf, die zweite liegt so weit verschoben hinter der ersten, daß man einen ziemlich weiten Blick in das von den beiden Bergzügen gebildete Thal erhält. Die vielen Gipfel dieser mächtigen malerischen Bergreihen streben in schönen und edeln Formen zu dem reinen Blau des Himmelsgewölbes empor und sind mit ewigem, tadellos weißen Schnee bedeckt, welcher nach unten hin unmerklich sich verändernd allmählich Gestalt und Farbe eines Gletschers annimmt, sich auf den Thalseiten bis zur Thalsohle hinabsenkt und dort ein ebenso unwegsames Eisfeld bildet, als die mit Wasser angefüllten Thäler der tieferliegenden Bergketten dem Menschen nutzbare Wasserstraßen bieten. Zu unserer Linken liegen niedrigere, steile und nackte Felswände, und vor denselben dicht bewaldete Inselgruppen mit saftigen, frischgrünen Bäumen, zwischen denen farbenreiche Blumen hervorlugen. Dieses von der warmen Sonne mit einem eigenen Reiz übergossene Bild erhält seinen würdigen Abschluß durch den Mount Burney, welcher, seine Umgebung weit überragend, sich in unserm Rücken aus der von ihm beherrschten Ebene, die mit Ausnahme der uns zugekehrten Seite jetzt vollständig von hohen schneebedeckten Gebirgszügen umrahmt ist, gigantisch emporhebt und in seiner majestätischen Größe das um ihn liegende gezackte, mit unendlich vielen kleinen Pics gekrönte Berggewirre verspottet. Dieser ausgezeichnete Berg, welcher nur ein riesengroßer Kegel ist, aber durch seine einfachen edeln Linien alles Plumpe von sich weist und voll Grazie nach dem unendlichen Weltall zeigt, muß auf dieser Erde einzig in seiner Art sein und kann wol als ein würdiges Denkmal der urkräftigen Allgewalt der Weltenschöpfung angesehen werden. Der in Japan auf der Insel Nipon liegende und als heilig verehrte Berg Fusijama, welcher wegen seiner reinen Formen einen hohen ihm auch gebührenden Ruf genießt, kann sich in Bezug aus großartige Schönheit mit diesem Mount Burney nicht messen und muß nach meinem Geschmack, trotz seiner doppelten Höhe, vor seinem hiesigen Rivalen zurücktreten.
Abends gegen 9 Uhr, nach einem herrlichen, an Naturgenuß so reichen Tage ankern wir in Puerto-Bueno, dem Hafen, welcher bei Aufstellung des Reiseprogramms als Ziel des zweiten Tages in Aussicht genommen war; wir haben somit die am gestrigen Tage verlorenen 20 Seemeilen wieder eingeholt. Der kreisförmige kleine Hafen Puerto-Bueno, in welchen man durch eine schmale Oeffnung einsteuert, bietet gerade ausreichenden Platz für ein großes Schiff und ist rundherum von niedrigem Land eingeschlossen. Er weist einen außerordentlichen Fischreichthum auf; auch kommt eine eßbare sehr schmackhafte Muschel, welche wol mit der Kieler Mießmuschel verwandt ist, häufig vor und kann bei Niedrigwasser ohne weitere Mühe in großen Massen eingesammelt werden. So brachten vier Mann in einer halben Stunde ein ausreichendes Gericht für die 200 Köpfe zählende Besatzung des Schiffes zusammen. In zwei dicht aufeinander folgenden Fischzügen in einer kleinen Bucht von etwa 12 m Breite und 10 m Tiefe des Hafens wurden mit jedem Zuge in dem Netze je 120 Fische im Totalgewicht von 105 resp. 108 kg gefangen. Die große Mehrzahl der Fische bestand aus vorzüglichen fetten, bis zu 1¾ kg schweren Makrelen, der Rest aus einer Lachsforellenart bis zu 2¾ kg Schwere. An der einen Seite des Hafens mündet cascadenartig über Felsblöcke hinwegspringend ein Wasserlauf, welcher sich aus einem dicht dahinter liegenden Süßwassersee ergießt. Leider ist das Wasser aber wegen des moorigen Bodens im See schlecht und zum Trinken nicht recht geeignet. Eine Recognoscirung des Sees, welche mit einem beschwerlichen Wege durch den Urwald, über umgefallene Baumstämme und große Felsblöcke, über Moosdecken, in die man oft bis unter die Arme einsinkt, durch dichtes Gestrüpp u. s. w. verbunden ist, ließ uns auch die Spuren und die Losung von Guanacos auffinden. Natürlich wurde in der nächsten Nacht von den Jägern ein Jagdzug unternommen, um womöglich eins dieser seltenen Thiere, welche zwischen dem Kamel und dem Lama liegen und ein vielbegehrtes schönes Fell haben, zu erlegen, doch verlief die Jagd resultatlos.
Dieser Tag verschaffte uns auch die interessante Bekanntschaft mit einer Indianerfamilie. Einer der hier gebräuchlichen großen, aus drei Bretern zusammengesetzten Kähne kam in der gewöhnlichen Weise längsseit des Schiffes, d. h. zwei Männer ruderten, eine Frau steuerte und die übrigen Personen hockten in der Mitte. Der ganze Inhalt des Boots bestand aus folgenden Personen: ein älterer Mann, durch ein weißbemaltes Gesicht als Familienhaupt gekennzeichnet; zwei ältere Frauen, jedenfalls die Gattinnen des Häuptlings; ein Mann von etwa 25 Jahren; ein halbwüchsiger auffallend hübscher Bursche von 16-17 Jahren; ein ebenso hübsches gleichalteriges Mädchen oder junge Frau, dem Burschen wie aus dem Gesicht geschnitten; ein Junge von 12-13 Jahren; 5 oder 6 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Sämmtliche Personen waren von dunkler Kupferfarbe, mit einer dicken Schmutzkruste überzogen, hatten hübsche regelmäßige Gesichter, schöne sanfte dunkle Augen, großen Mund und waren von guter Mittelgröße. Die Körperformen der Männer waren gut; die Frauen hatten schöne Nacken und Schultern, schöne Arme, Hände und Fingernägel, und wußten Arme und Hände mit Grazie zu gebrauchen. Der Leib der Frauen war stark, die Hüften traten nicht hervor, waren daher ohne jede Taille, die Oberschenkel waren auffallend schwach, Unterschenkel und Füße jedoch wohlgeformt. Die Brüste der ältern Frauen hingen lang und schlaff herab, die des jungen Frauenzimmers dagegen waren sehr üppig, aber doch nicht so fest wie es ihrem Alter zukam. Der Leib des jungen Frauenzimmers war sehr stark, es blieb aber fraglich, ob dies ein Zeichen noch großer Jugend war, da der Leib aller Kinder infolge der mangelhaften Ernährung (die Leute leben nur von Fisch, Kräutern und einer bestimmten Erdart) stark aufgetrieben war. Die tiefschwarzen Haare waren nicht gepflegt, struppig, reich mit Ungeziefer bevölkert und bei beiden Geschlechtern gleich lang bis auf die Schultern herabreichend; Bartwuchs fehlte bei den Männern ganz. Der Häuptling trug ein Seehundsfell auf dem Rücken und eins um die Hüften geschlungen, die andern Personen hatten gleichmäßig nur ein Fell auf dem Rücken und waren sonst ganz nackt, den kleinsten Kindern fehlte auch das Rückenfell.
Gleich nach ihrer Ankunft begann das Tauschgeschäft. Für eine Cigarre, etwas Taback, ein Stück Brot oder eine Schachtel Zündhölzer wurde aus dem Boot eine aus Seehundsknochen gefertigte Lanzenspitze, ein ebensolcher Dolch oder ein Albatros-Schnabel hinaufgereicht. Geschenkt nehmen diese Leute, solange sie noch etwas zu geben haben, nichts, sondern reichen für jede Gabe, wenn sie auch als Geschenk bezeichnet wird, einen Ersatz hinauf und ruhen nicht eher, als bis ihnen der Gegenstand abgenommen ist. Nach Erschöpfung des Vorraths der Indianer richtete sich der Sinn unserer Offiziere auf die Seehundsfelle, und nun entwickelte sich eine höchst lächerliche Scene. Mit Ausnahme des Häuptlings, welcher seine Kleidung nicht hergab, haben die Männer ihre Kleidung bald gewechselt. Der Eine trägt an Stelle seines Fells zwei alte Civilröcke übereinandergezogen, ist unten aber nackt; der halbwüchsige Bursche hat eine Hose an und eine zweite als Mantille über die Schultern gehängt; der dreizehnjährige Junge prangt in einer alten blauen Cadettenjacke, unter welcher der braune Unterkörper sich komisch ausnimmt. Das Verlangen nach Seehundsfellen ist aber noch nicht gestillt, ein Offizier hat noch einen alten Unterlieutenants-Frack zur Hand und will für diesen ein Fell haben. Das europäische Schicklichkeitsgefühl verbietet ihm, eins der Frauenfelle zu begehren, wenngleich diese gerade das nicht bedecken, was bei uns als bedeckungswürdig angesehen wird, er zeigt daher auf ein mit noch einem Fell versehenes Kind. Der Alte, welcher unmöglich glauben kann, daß für den schönen Frack nur ein elendes Fell verlangt wird, nimmt den von der Mutter bereits weggestoßenen Jungen am Wickel, macht ihm mit einer Holzkohle einen schwarzen Strich quer über Backen und Nase und stellt ihn zum Tausch. Als nun der Offizier, um sich verständlicher zu machen, auf das Fell des jungen Frauenzimmers und dann wieder auf das des Jungen zeigt, glaubt der Alte, er wolle beide haben, packt sie daher auch am Genick, macht ihr auch einen schwarzen Strich über Backen und Nase und stellt sie für den Frack ebenfalls zur Verfügung. Während dieser Manipulation ist in den Gesichtern der Betheiligten keinerlei Erregung zu bemerken; so wie alle gleichzeitig zu dem Schiff hinaufschwatzten, plappert auch das junge Frauenzimmer, während der Alte sie zeichnet, ohne Unterbrechung weiter fort und scheint mit demselben Gleichmuth in den Besitz eines neuen Herrn übergehen zu wollen, mit dem sie vorher die ihr zugeworfenen Brosamen auffing, und kokettirt mit ihren schönen sanften Augen ohne wechselnden Ausdruck nach wie vor zu dem jungen Lieutenant hinauf. Endlich fangen die Wilden an zu verstehen, um was es sich handelt, und nun muß das Mädchen ihr Fell hergeben. Höchst lächerlich ist es zu sehen, wie nun auf einmal ein gewisses Schamgefühl bei der Person durchbricht. Da das Schamgefühl wol in dem Körpertheil sitzt, welcher gewöhnlich bedeckt getragen wird, wie es ja bei den türkischen Frauen z. B. im Gesicht liegen soll, so wird das Ding plötzlich unruhig, zieht sich mit verängstigtem Gesicht hinter die andern im Boot befindlichen Personen zurück und läßt sich erst dort ganz zusammengekauert das Fell von ihrem uns abgewandten Rücken abnehmen. Das Fell kommt nach oben, der Frack geht hinunter; nach einigen vergeblichen Versuchen gelingt das Anziehen dieses fremden Kleidungsstücks endlich, und nun haben wir das seltene und prächtige Vergnügen, diese junge, nunmehr wieder vergnügte Schönheit der Wildniß mit nur einem offenen Unterlieutenants-Frack bekleidet vor uns stehen zu sehen. Die Erscheinung wird aber noch lächerlicher, als die Kinder die für sie höchst merkwürdigen Taschen in den Frackschößen entdecken; sie graben ihre Arme tief hinein, strecken beide Frackschöße nach oben und seitwärts hoch hinaus und die Person steht vor uns wie ein Pfau mit ausgespreiztem Rad.
Alle Gegenstände, welche von dem Schiffe aus in das Boot gelangten, wurden mit Ausnahme der Kleidungsstücke, ohne lange betrachtet zu werden, gleich der am Steuer sitzenden Frau zugereicht, welche sie in Verwahrung nahm. Nur etwas Hartbrot und Zucker behielt die zweite ältere Frau für sich, um ab und zu daran zu naschen. Eine Handvoll Rosinen, welche ich in das Boot warf, wurde aufgesammelt, die Kinder naschten wol eine, den Rest aber gaben sie ab. Das junge Frauenzimmer biß eine Rosine an, gab die zweite Hälfte ab, griff in ihre Haare und verzehrte an Stelle der Rosine einen ihrer Kopfbewohner, welchen sie wie ein Affe vorher genau betrachtete und wol für essenswerther hielt. Ein als Geschenk hinuntergereichter kleiner Spiegel ließ jeden, der hineinsah, ein so urkomisch dummes Gesicht machen, daß man annehmen muß, daß Spiegel etwas bisher Unbekanntes waren. Die zwei jungen Männer mußten auf Deck antreten; es wurde ihnen ein Cognak vorgetrunken, worauf sie es nachmachen mußten. Der Cognak wurde getrunken und beide standen gleichmäßig wie Statuen vor uns mit offenen Mäulern, gehobenen Nasenflügeln und so sprechend lachenden Augen, daß wir uns Gewalt anthun mußten, um nicht jedem eine derbe Ohrfeige zu geben und sie damit aus ihrer Verzauberung zu reißen. Sie erhielten den zweiten Cognak — dieselbe Wirkung, den dritten Cognak — der gleiche Erfolg; dann ließen wir es genug sein.
Alte Feuerländerin.
Gleich zu Anfang während des Tauschgeschäfts kroch ein etwa 6 Jahre alter Junge an seine Mutter heran, nahm die eine Brust, saugte daran, warf sie aber zur Seite und nahm die zweite, welche ihm das Gesuchte zu geben schien. Die Mutter, deren Gedanken nur nach dem Schiffe gerichtet waren, schien diesen Vorgang gar nicht zu bemerken; ohne nur den Kopf zu drehen oder ihre erhobenen Arme zu senken, schrie sie in derselben Weise nach dem Schiff hinauf. Wir sehen doch unwillkürlich nach der Stelle hin, wo eine Fliege uns belästigt, geschweige denn wenn ein Kind uns unerwartet auf den Leib rückt, hier aber scheint fast jedes Gefühl am Körper zu fehlen.
Als ich abends in meinem Boote noch etwas segelte und zu der Hütte unserer Indianerfamilie kam, sah ich die beiden jungen Männer auf einem Steine sitzend in das Wasser stieren, der eine immer noch mit seinen zwei Röcken, der andere mit seinen zwei Hosen; der dreizehnjährige Junge stolzirte in seiner Jacke auf einem im Wasser liegenden großen Stein umher, beide Hände in den Seitentaschen und damit die Jacke so knapp an den Rücken holend, daß die untere nackte Partie um so besser hervortrat. Das Mädchen stand am Ufer, aber wieder mit einem Fell auf dem Rücken; der Frack ziert jedenfalls schon den alten Häuptling, welcher sich in diesem Staatskleid in seinem Wigwam wol von seinen Frauen bewundern läßt.
Als Curiosum führe ich noch an, daß auf der „Leipzig“ in der eigentlichen Magelhaens-Straße ein Besuch der Wilden den Matrosen Veranlassung gab, ein junges Frauenzimmer in eine große Bütte mit Wasser zu setzen und sie mit Bürsten und Seife gründlich zu waschen. Sie soll nach Schluß der Wäsche ordentlich hell gewesen sein und ganz appetitlich ausgesehen haben.
Morgens 3½ Uhr setzen wir die Reise nördlich fort, mit der Absicht gegen Abend in dem 150 Seemeilen entfernten Gray-Hafen zu ankern. Der vor uns liegende Tag schließt den schwierigsten Theil der ganzen Fahrt durch die Straßen in sich, da gerade hier zusammengedrängt die engsten Stellen liegen und ein Theil der Straße noch dazu mit sehr vielen blinden wie sichtbaren Klippen übersäet ist. Auch führt der vor uns liegende Weg durch einen langen Kanal, welcher oft mit Treibeis, welches die Navigirung erschwert, angefüllt sein soll. Die Morgenluft sieht gut aus und wir dürfen wieder auf einen schönen Tag rechnen. Schon gegen 6 Uhr morgens stehen wir vor einer der hervorragendsten Engen und sind von einer Scenerie umgeben, welche lebhaft an die der schönen norwegischen Fjorde erinnert. Das Schiff befindet sich bereits in einem ziemlich engen Kanal; vor uns liegt eine Insel, welche sich in ihrer Grundform als regelmäßiger Kegel aus dem Wasser erhebt, deren kahles Gestein nach oben zu aber stufenförmig einfällt, sodaß der Berg den Namen Treppenberg erhalten hat. Dieser mächtige Felsblock scheint den Weg zu verschließen, denn er lehnt sich von unserm Standpunkt aus gesehen direct an die hinter ihm liegenden 800-1000 m hohen Felswände an. Das Schiff macht einen Bogen nach rechts und läuft dann zurückdrehend um den Treppenberg in die sich links öffnende und immer mehr verengende Straße ein, erreicht nach Zurücklegung von etwa 3 Seemeilen die engste Stelle und steuert dann nach Passirung derselben in ein weites Wasserbecken von etwa 20 Seemeilen Breite. Hiermit ändert sich auch ganz plötzlich der Charakter unserer Umgebung. Während wir vorher zwischen hohen dunkeln Felswänden, welche mit ihren Schatten die ganze Straße beherrschten, eingekeilt waren, befinden wir uns jetzt auf freiem, von der Sonne hell beschienenen Wasser. Die Berge sind in weite Ferne gerückt, das Land in unserer Nähe wird nur durch kleine niedrige, mit dichtem Wald bewachsene Inseln repräsentirt. Das Wasser, welches vorher keine Bewohner zu haben schien, ist auf einmal reich bevölkert, die ganze Flut lebt. Große Scharen von Möven, Tauchern und Enten der verschiedensten Gattungen schweben und fliegen kreuz und quer über das Wasser hin oder sonnen sich, ruhig auf demselben schwimmend, um nur dann aufzufliegen, wenn das Schiff nahe an sie herankommt. Große Heerden von Seehunden folgen, wie in unsern Meeren die Delphine, hoch aus dem Wasser herausspringend mit eleganten Sätzen dem Schiffe. Und trotz dieses Lebens — welche Grabesstille! Bei der herrschenden Windstille kann die Takelage ihren uns so wohlbekannten Gesang nicht anstimmen; die spiegelglatte Flut ist frei von dem Geräusch sich überstürzender Wellen, welches uns sonst fast immer begleitet; alle Thiere gehen, ohne einen Laut von sich zu geben, stumm ihrer Beschäftigung nach; alles ist stumm, denn auch vom Lande her lassen weder Vögel noch anderes Gethier ihre Stimme vernehmen. Diese sonntägliche Stille wird nur unterbrochen, wenn das Schiff in zu große Nähe von Dampfschiffs-Enten kommt, welche in diesem Falle mit geräuschvollem Geplätscher das Weite suchen.
Dieser Vogel kommt meines Wissens nur in den Gewässern der Magelhaens-Straße vor; er gehört zu den Enten, ist klein, von sehr zierlichem Bau und hat einen reizenden Kopf. Die Thierchen nehmen auf dem Wasser dieselbe Stufe wie der Strauß auf dem Lande ein, d. h. sie können nicht fliegen, sondern sind nur vorzügliche Schwimmer und Taucher. Wie der Strauß beim schnellen Lauf seine kurzen Flügel mit benutzt, so thut diese Ente dasselbe beim schnellen Schwimmen; wie die Schaufelräder eines Schiffes schlagen die kleinen unentwickelten Flügel auf und in das Wasser. Es sieht höchst possirlich aus, wenn sich eine Heerde dieser zierlichen Thiere in schnelle Bewegung setzt. Die Köpfchen sind weit aus dem Wasser gestreckt, die Flügel schlagen immer abwechselnd so schnell und kräftig auf das Wasser, daß es hoch aufspritzt, von dem Arbeiten der Füße wird das Wasser hinten ebenso wie von einer Schiffsschraube aufgeworfen. Sowol aus diesem Grunde, wie auch wol wegen ihrer Schnelligkeit, hat man ihnen ihren Namen gegeben; trotzdem wir mit 10 Knoten Geschwindigkeit gingen, liefen uns diese kleinen plätschernden Dinger doch in ziemlich raschem Tempo vorbei.
Hier will ich auch noch eines absonderlichen Vogels erwähnen, den wir am 17. Januar an einer Stelle in der Magelhaens-Straße in großen Scharen sahen. Es ist ein ganz kleiner Wasservogel von der Größe eines Sperlings oder vielleicht besser gesagt der eines Reisvogels, weil er auch dessen Farbe hat. Da man nicht gewohnt ist, so kleine Wasservögel zu sehen, so kamen diese Thiere uns vollständig märchenhaft vor. Wir hatten uns kurz vorher mit den riesigen Walfischen beschäftigt, hatten große Möven in der Nähe, waren von mächtigen Gebirgszügen umgeben und sahen uns inmitten dieser großartigen Natur, wo alles sich in großen Dimensionen hält, nun plötzlich bei dem Einlaufen in einen großen Kessel von diesem kleinen Volk umgeben, das wie die Heinzelmännchen in zauberartiger Schnelligkeit das ganze Wasserfeld bedeckte und an der nächsten Ecke ebenso plötzlich wieder verschwand. Höchst putzig sah es aus, wenn dieses winzige Gethier von dem Schiffe aufgescheucht sich scharenweise gleichzeitig erhob, in geschlossener Truppe einen großen Bogen abflog und dann plumps! wieder regungslos auf dem Wasser saß, geradeso wie eine Heerde frecher Sperlinge, welche von einem Kirschbaum aufgescheucht schnell und ohne weiteres Besinnen sich auf dem nächsten niederläßt.
Als wir in das freiere Wasser einsteuern, steht vor uns fern am Horizont dickes Gewölk, welches wol zu der Sorge berechtigt, ob uns das gute Wetter erhalten bleibt. Bald wird in der verdächtigen Wolkenbank ein großes uns entgegensteuerndes Schiff entdeckt, was mir zu der übermüthigen Bemerkung Veranlassung gab, daß jetzt in Betreff des Wetters nichts mehr zu befürchten sei, da es ja genug sei, wenn ein Schiff den Regen zu tragen habe; denn ich konnte gar nicht daran glauben, daß das hier so seltene herrliche Wetter nun auf einmal ein Ende haben sollte. Merkwürdig genug, daß es wirklich so kommt. Um 7 Uhr morgens passiren wir unter trübem Himmel dicht aneinander vorbei, um 8 Uhr schwimmen wir bereits wieder unter wolkenlosem Himmel und erfreuen uns eines prächtigen, windstillen Tages, während die amerikanische Corvette, mit welcher wir die übliche Höflichkeitsform des Flaggenzeigens ausgetauscht hatten, in dickem Regen hinter uns verschwindet. Da sich zur selben Zeit in unserer Nähe noch ein kleines Segelschiff, welches wahrscheinlich auf Seehundsjagd ist, befindet, so feiern wir ein gewiß seltenes Zusammentreffen in einer Gegend, wo oft monatelang kein Schiff passirt. Gegen 10 Uhr vormittags, nach Zurücklegung von etwa 30 Seemeilen seit dem Verlassen der Enge, rückt das Land allmählich wieder zusammen, und bereits um 11 Uhr steuern wir in den Wide-Kanal ein. Es ist dies ein 25 Seemeilen langer und 2-2½ Seemeilen breiter Hohlweg, welcher durch fast senkrecht aus dem Wasser aufsteigende nackte Felswände von etwa 300 m Höhe gebildet wird. Wie die ganze Magelhaens-Straße mit ihren angrenzenden Kanälen reich an Ueberraschungen ist, so stand uns auch hier eine bevor.
Mit dem Einlaufen in diesen Kanal kamen wir plötzlich in eine ganz andere Welt. Die Landschaft, durch welche während der letzten Tage unser Weg führte, hatte gewiß einen winterlichen Anstrich, die Temperatur war verhältnißmäßig niedrig, so niedrig, daß wir trotz Sonne und Windstille Winterkleider trugen; der empfangene Eindruck mahnte aber nicht an den Winter, wir waren vielmehr uns dessen wohl bewußt, daß wir in dem Sommer einer hohen Breite waren. Jetzt treten die schneebedeckten Gipfel zurück, wir sehen nur die Felswände des Hohlwegs, welche ebenso wie die unter Windstille liegende Flut von der vor und über uns im Mittag stehenden Sonne warm beschienen werden; die Temperatur ist höher als während der letzten Tage und hält sich auf 14° R.; wir befinden uns im Hochsommer auf einer Breite, welche Heidelberg entspricht, sind heute auch leichter bekleidet und trotzdem ist der Eindruck auf Auge und Gefühl eines jeden von uns der eines schönen, sonnigen Wintertages. Die Umgebung bietet nur wenig Abwechselung, und nur hin und wieder gestattet eine Schlucht einen Blick auf die ferner liegenden Schneeberge. Wie im Schiffe so herrscht überall sonntägliche Ruhe; einzelne hervortretende Punkte, welche das Schiff in seinem gleichmäßigen raschen Laufe passirt, werden zur Ortsbestimmung benutzt, die übrige Zeit gehört den Gedanken. Wo meine Gedanken weilen ist nicht schwer zu errathen: in der Heimat bei Weib und Kindern, welche nach ihrem Tageswerk jetzt wol beim Abendbrot sitzen. Meine Augen ruhen ohne zu sehen und ohne sehen zu wollen auf dem vor uns liegenden Bilde, das in seiner melancholischen Eintönigkeit den Menschen abstößt und ihn auf seine Gedanken allein verweist. Ein schnurgerader Hohlweg von solcher Länge, daß der Wasserhorizont noch vor den in weiter Ferne für das Auge zusammenstoßenden Seitenwänden liegt, unter uns ein schmaler Streifen blau-grauen spiegelglatten Wassers, zu beiden Seiten nackte und düster gefärbte Felswände von gleicher Höhe, über uns ein schmaler Streifen des wolkenlosen Himmels und in diesem die heißstrahlende Sonne. Auf solcher Scenerie kann das Auge wol ruhen ohne zu sehen, und doch ist plötzlich der Blick gefesselt, meine Gedanken kehren zum Schiffe zurück. An der Wassergrenze vor uns tauchen weiße Flecken auf, welche in grellem Contrast zu der hinter dem Horizont liegenden dunkeln Felsenwand stehen; wir sind in dem Kanal, welcher häufig Treibeis haben soll, und die neue Erscheinung kann nur Eis sein. Mit unserm Vorschreiten verwandeln sich denn auch die Flecken in Eisschollen, und bald läuft das Schiff in ein großes Eisfeld hinein, wirft die kleinen Schollen zur Seite, geht den großen aber vorsichtig aus dem Wege. Der ganze Kanal ist hier mit Treibeis der verschiedensten Formation bedeckt; einige Stücke sind krystallklar, andere milchig; die große Mehrzahl allerdings hat die schöne hellgrün-blaue Farbe der Gletscher. Einzelne dieser in phantastische Formen zusammengeballten Eisschollen sind kleine Eisberge von 6-10 m Dicke und wahre Prachtstücke in Bezug auf Formen und Schönheit ihrer Farben; ja sie suchen mit dem Glanz eines Edelsteins zu wetteifern, sobald sie von den Strahlen der Sonne getroffen werden.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das uns umgebende Eis sich von einem in der Nähe befindlichen Gletscher losgelöst hat; wir finden diesen auch bald in einer großen Bucht, welche er von den Bergen herunterkommend ganz mit Eis angefüllt und dieses in einer gewiß 5 m dicken Lage bis an den Hauptkanal vorgeschoben hat. Da wir nach Passirung dieses Gletschers kein Eis mehr im Wasser finden, so muß er naturgemäß auch die Quelle der treibenden Eisfelder gewesen sein.
Um 2½ Uhr nachmittags läuft das Schiff rechts in den Eiskanal ein und um 3½ Uhr mit einer scharfen Wendung nach links in den von hohen Felsen eng eingeschlossenen Grappler-Kanal. In den Eiskanal mündet ein 40 Seemeilen langer Sund, welcher, von ausgedehnten Gletschern umgeben, jedenfalls infolge der dort lagernden kolossalen Eismassen die Ursache ist, daß in dem Eiskanal eine von dem Sund herkommende regelmäßige kalte Luftströmung beobachtet wird, wegen welcher er seinen Namen erhalten hat. Als wir in den Eiskanal einsteuern, kommt uns ein leichter kalter Wind entgegen, die Temperatur fällt um 1,2° und steigt sofort wieder um 1,5°, sobald wir von hier in den Grappler-Kanal einlaufen.
Kurz nach 5 Uhr dampft die „Ariadne“ in eine Straße ein, die so voll sichtbarer und blinder Klippen ist, daß die größte Vorsicht nothwendig wird; die Fahrt des Schiffes wird daher sehr vermindert, um ein eventuelles Auflaufen auf eine Klippe nach Möglichkeit unschädlich zu machen. Hier im Indian-Kanal strandete auch vor Jahresfrist ein deutscher Dampfer.
Endlich finden wir auch Gelegenheit, den Seehund dieser Gewässer, welcher wegen seiner Größe gewöhnlich wol Seelöwe oder richtiger Seebär genannt wird, aus nächster Nähe in seiner Freiheit zu beobachten. Zwischen den vielen über Wasser liegenden Klippen, an welchen wir jetzt dicht vorbeidampfen, hausen ganze Heerden dieser Thiere, zeigen keinerlei Scheu vor dem Schiffe und lassen sich durch dasselbe nicht in ihrer Beschäftigung stören. Etwa 200 Schritt von uns entfernt wälzt sich im wahren Sinne des Wortes eine große Heerde in dem flachen Wasser, welches die Klippen umgibt, während ein kleineres Rudel, neugierig nach dem Schiffe hinsehend, unbeholfen auf den Klippen herumkriecht und kleine Trupps sich in tiefem Wasser und auch dicht beim Schiffe herumtummeln. Die in dem flachen Wasser spielenden Thiere bilden einen großen Knäuel von Köpfen und Schwänzen, da sie wegen der zu geringen Wassertiefe immer mit einem Theil ihres Körpers aus dem Wasser hervorschnellen müssen; die in dem tiefen Wasser befindlichen Thiere wetteifern, wie schon früher beschrieben, mit der Kunstfertigkeit der Tümmler; mit gekrümmten Rücken springen sie hoch aus dem Wasser hinaus und in elegantem Bogen wieder hinein. Waren wir vorher über die Identität dieser Thiere noch im Zweifel, trotzdem wir den Seehundskopf mit dem Fernrohr deutlich erkannt hatten, so mußten jetzt alle Zweifel schwinden; diese gelenkigen und eleganten Wasserbewohner sind dieselben Seehunde, welche auf den Klippen so grenzenlos plump und ungeschickt sind. Hier will ich noch anführen, daß der Seehund der Magelhaens-Straße, welcher den unsrigen so sehr an Körpergröße übertrifft, sich von diesem noch dadurch wesentlich unterscheidet, daß er ebenso neugierig wie dieser scheu ist. Auf diese stark ausgebildete Neugierde haben auch die Robbenschläger ihr eigenthümliches Jagdsystem gegründet. Sie betreiben die Jagd nur in kleinen Fahrzeugen, mit welchen sie dicht an und zwischen die Klippen kommen können. Werden sie nun einer Seehundsheerde ansichtig, dann steuern sie direct auf dieselbe los und machen dabei mit Pauken und Gongs so starken Lärm als sie überhaupt hervorbringen können, während ein Theil der Besatzung mit Repetirgewehren zum Schuß bereit steht. Der Seehund läßt sich merkwürdigerweise von dem ankommenden lärmenden Fahrzeuge nicht verjagen, sondern die ganze Heerde sammelt sich auf den Klippen, um das kuriose Ding, was da ankommt, anzuschauen, und gibt den Jägern so Gelegenheit, aus nächster Nähe so viele von ihnen niederzuschießen, als Patronen in den Gewehren vorhanden sind.
Um 7 Uhr abends langt das Schiff vor dem schwierigsten Theil unserer ganzen Kanalfahrt an. Wir stehen dicht vor der berüchtigten Enge (English narrows), welche allein viele Schiffe abhält diese Kanäle zu benutzen und in jedem Neuling ein wahres Grauen hervorbringen muß, da alle Bücher Vorsicht über Vorsicht empfehlen und mündliche Nachrichten mit Achselzucken begleitet werden, als ob der Berichterstatter sagen wolle: „Versuchen Sie es, es geht, ich übernehme aber keine Verantwortung.“ Mit einem chilenischen Corvetten-Kapitän und dem deutschen Kapitän eines chilenischen Dampfers, welch letzterer erst vor wenigen Tagen dort mitten zwischen Klippen gelegen hatte und es nur einem glücklichen Zufall zuschrieb, daß er ohne Schaden wieder freikam, hatte ich gesprochen. Beide führten nur kleine Schiffe und hielten die Passage schon für sehr bedenklich. Neuerdings ist sie auch den Postdampfern von ihren betreffenden Gesellschaften verboten worden, und doch kann es nicht so schlimm sein, da sie von englischen, französischen und amerikanischen Kriegsschiffen jeder Größe schon benutzt worden ist und noch benutzt wird.
Hier tritt nun einer jener Momente ein, welche im Seeleben häufiger vorkommen, als man vielleicht gemeinhin annimmt. Ein Moment, in welchem der Commandant eines Kriegsschiffes etwas wagen muß, was ihn in Conflict mit dem Strafgesetz bringt, sobald das unternommene Manöver unglücklich ausfällt. Die mit der Stellung verknüpften Pflichten sind aber höhere und verlangen die Uebernahme einer Verantwortung, welche man ablehnen könnte. Denn wie sollen die Offiziere die wirkliche Leistungsfähigkeit des Schiffes kennen lernen, wenn sie nicht Proben von derselben gesehen? Wie soll die Mannschaft das für den Moment der wirklichen Gefahr durchaus nothwendige Vertrauen zu ihrem Commandanten und ihren Offizieren erhalten, wenn sie nicht vorher schon gesehen hat, daß ihre Befehlshaber auch in schwierigen Lagen ihrer Aufgabe gewachsen sind?
Vor uns liegen durch eine kleine Insel getrennt zwei Passagen, die linke nahezu 300 m breit und frei von Untiefen, die rechte nur 70 m breit und durch eine unter Wasser liegende Sandbank so eng gemacht; mithin doppelt gefährlich, weil man den Feind nicht sehen kann. Auch liegen jenseit der engern rechten Passage Klippen in so geringer Entfernung, daß das Schiff gleich hinter der Passage fast auf der Stelle drehen muß, während die linke Seite einen bequemen Bogen gestattet. So sollte man meinen, daß zweifellos die linke Passage zu wählen ist, und doch neigt sich aus den vorher angegebenen die Wagschale nach der rechten Seite.
Mir ist höchst unbehaglich zu Muthe, denn es ist ein eigen Ding mit der Verantwortung über ein Kriegsschiff. Mein Herz pulsirt schneller — jetzt muß es kommen. Mit einem kleinen Bogen sind wir plötzlich vor einem aus vielen kleinen Inseln bestehenden Inselgewirre, welche sich an hohe, die Natur hier abschließende Bergketten anlehnt. Die Sonne steht schon so tief, daß sie die Schatten der Berge auf die Fluten wirft, wodurch alles vor uns Liegende, die Inseln, der auf den Klippen wachsende Seetang und das Wasser, eine übereinstimmende dunkelgrüne Farbe erhält: eine Beleuchtung, welche jede Distanzschätzung außerordentlich erschwert. Das Schiff dringt ganz langsam vorwärts; alles was gehen kann, ist auf Deck und lugt über die Brustwehr, um die Fahrt durch dieses Labyrinth mitanzusehen; die Offiziere schauen mehr nach der Commandobrücke als nach der Umgebung; ich blicke nach der noch 1½ Seemeilen entfernten kleinen Insel aus, welche als Wegweiser dient, und suche sie weit ab. Die Beleuchtung mahnt zur Vorsicht, die Insel ist in der Ferne nicht zu sehen, der scheinbar vor uns liegende kleine Humpel kann sie nur sein. Hier heißt es schnell und entschieden handeln; die kleinste Verzögerung kann die bedenklichsten Folgen haben. Der Mann, welcher eine Secunde vorher mit gebeugtem Kopfe unruhig und sorgenvoll auf der Commandobrücke hin- und hertrippelte, ängstlich nach der Karte schaute und dann wieder das umliegende Land studierte, fühlt jetzt seinen Herzschlag nicht mehr, die Beklemmungen sind geschwunden, er steht mit gehobenem Kopfe, gibt ein kurzes Commando nach dem Ruder, ein Avertissement nach der Maschine und ruft sorglos lachend den Offizieren zu: „Meine Herren, passen Sie auf, wie das Schiff sich durchzwängen wird!“ Das Ruder wird gedreht, der Bug wendet sich nach rechts, nach dem Fahrwasser, wo die Besatzung sehen kann, was ein gutes Schiff zu leisten vermag. Wir laufen so dicht an der kleinen Insel vorbei, daß die Raaen über dem Lande hängen; die Schiffsseite ist nur 3-4 m von der steinigen Küste entfernt, die Zweige der überhängenden Bäume können fast von dem Schiffe aus erreicht werden. Die Insel ist nur klein, viel Zeit zum Nachdenken ist nicht gegeben; noch während das Schiff an der Insel liegt, muß das Ruder schon gedreht werden, um sobald das Hinterschiff frei von der Küste ist, seine volle Kraft zur Geltung bringen zu können. Alles geht schnell und concentrirt sich auf Augenblicke; die Maschine erhält den Befehl, mit voller Kraft zu gehen, noch ehe das Schiff frei ist, hier müssen aber die Secunden, welche bis zur Ausführung des Befehls verstreichen, mit in Berechnung gezogen werden. Die Maschine schlägt mit voller Kraft an, das Schiff dreht sich wie ein Kreisel, das Ruder wird zurückgelegt und das Schiff schießt an den Klippen vorbei, um nach wenigen Minuten einen gleich scharfen Bogen zurückzumachen und dann in freiem Fahrwasser nach dem naheliegenden Hafen zu dampfen. Freies Fahrwasser? Unter gewöhnlichen Umständen würde man hier stets einen Lootsen nehmen, wenn man einen bekommen könnte, und würde nur mit langsamer Fahrt gehen. Nach dem, was heute hinter uns liegt, ist jedoch das vor uns liegende Fahrwasser so frei, daß es mit Volldampf nach dem Gray-Hafen geht, wo um 8½ Uhr abends unter einer dicht bewaldeten 6-700 m hohen Felsenwand geankert wird.
Es ist ein wahrhaft poetischer Abend. Vor uns liegt die mit dichtem Urwald bestandene hohe Felsenwand, welche das Himmelsgewölbe zu berühren scheint, sie sendet uns lange nicht mehr genossenen Blumenduft entgegen. Eulen lassen ihr geisterhaftes Geschrei vernehmen; mehrere über Felsen steil herabfallende Bergbäche ergießen sich mit einschläferndem Gemurmel in den Hafen, welcher, trotz der noch hellen Dämmerung, von der sich in den Fluten spiegelnden Felsenwand schon in dunkle Schatten gelegt ist. Zur Rechten öffnen sich die Berge und gestatten einen Blick auf einen weit abliegenden schneebedeckten hohen Vulkan, dessen Gipfelgestalt deutlich einen Krater erkennen läßt und dessen Schneedecke, wol durch übergestreute Asche, grau gefärbt ist. Hinter uns wird der Hafen durch eine niedrige dicht bewaldete Landzunge abgeschlossen, und über diese hinweg blickt das Auge auf einen von hohen Bergen eingeschlossenen, in tiefem Schlaf liegenden Alpensee, in welchem mit Genugthuung die Stelle erkannt wird, welche vor einer Stunde mit so banger Sorge passirt werden sollte und mit so frohem Gleichmuth passirt worden ist. Köstlicher Friede lagert über diesem anziehenden, in großartiger Ruhe daliegenden Bilde. Wir wissen, daß wir Hunderte von Meilen von menschlichen Ansiedelungen entfernt sind, daß wir, ebenso wie während der letzten Tage, uns in vollkommenster Einsamkeit befinden, und doch ist es hier anders — die Natur lebt, Blumenduft, Vogelstimmen und plätschernde Waldbäche athmen ein Leben aus, welches dem Menschen das Gefühl des vollständigen Verlassenseins benimmt und der Umgebung einen Zauberreiz verleiht, welcher sich wol empfinden aber nicht beschreiben läßt. Dieser kleine Hafen, welcher mit seinen Reizen zum Bleiben einladet, soll der letzte Halteplatz in diesen Straßen sein und ich habe für denselben einen Aufenthalt von drei Tagen in Aussicht genommen. Das noch vor uns liegende Fahrwasser bis zur freien See ist einfach und klar, alle schwierigen Stellen liegen hinter uns, die Distanz bis zum Ocean ist so gering, daß ein überfrühes Aufstehen nicht mehr nöthig wird; so kann ich also mit dem Bewußtsein zu Bett gehen, daß die Strapazen ihr Ende erreicht haben und einige Tage wohlthätiger Ruhe vor mir liegen.
Schon früh am Tage am 21. geht ein Theil der Mannschaft zum Holzfällen an Land. Ich beabsichtigte nach dem Frühstück auf den nächstgelegenen höchsten Berggipfel zu steigen, um von dort einen freiern Ueberblick über dieses noch so wenig erforschte, eigenthümlich wilde Land zu erhalten. Eine nähere Untersuchung ließ indeß alle Hoffnung schwinden. Die Bergwände sind so steil, daß sie nur mit Lebensgefahr und dann auch erst nach mehrtägiger Anstrengung zu erklimmen sind; daneben sind sie mit so dichtem Urwald, Gestrüpp und Schlingpflanzen bedeckt, daß ein Versuch, ohne Gebrauch der Axt nur wenige Schritte vorzudringen, als unausführbar aufgegeben werden muß. Ich entschließe mich daher, einen andern in Aussicht genommenen kleinen Ausflug zur Ausführung zu bringen. Einige Offiziere schließen sich an und bald sind wir in zwei Booten unterwegs. Von dem Hafen aus gelangen wir in einen Süßwassersee von einer Seemeile Ausdehnung, welcher sein Wasser von einem kleinen Fluß erhält, der wiederum von einem großen Wasserfall gespeist wird, welcher das Schneewasser von den Bergen in das Thal führt. Der See ist in Uebereinstimmung mit dem Charakter des ganzen Landes mit kleinen bewaldeten Inseln angefüllt, zwischen welchen einige Taucher hin- und herfliegen. Bald gelangen wir in den kleinen Fluß, wo auf den mit saftigem Laub bedeckten Ufern sich über hochrothen Blumen Schmetterlinge wiegen, ein vereinzelter Kolibri umherschwirrt und aus dem Gebüsch einige Papagaien ihre heisere Stimme vernehmen lassen. Auch finden sich hier die gemeine Pferdefliege sowie eine kleine schwarze Stechfliege ein und lechzen nach unserm Blute. Nach einer weitern Viertelstunde langen wir an dem schönen, zwischen Felsen aus dichtem Baumgewirre sich ergießenden Wasserfalle und damit an dem Ende unserer Fahrt an, da der Urwald ein weiteres Vordringen unmöglich macht. Eine leere Sardinenbüchse und ebensolche Mixed-Pickles-Flasche sind die einzigen menschlichen Spuren in dieser Wildniß.
Unsere Rückkehr bringt mir eine sehr unangenehme Ueberraschung. Einer der beim Holzfällen beschäftigten Leute hatte seine brennende Pfeife ausgeklopft und damit einen Waldbrand angefacht, welchen wir nicht mehr löschen konnten, diese Arbeit daher dem nächsten mitleidigen Regen überlassen mußten. Das Moos und Gestrüpp, sowie die aus früherer Zeit vom Holzfällen zurückgelassenen Astreste sind von einer solchen Dürre, daß, nachdem der brennende Taback das Moos erst entzündet hatte, ein Löschen schon nicht mehr möglich war. Das Feuer war zwar an der ersten Stelle gleich gelöscht worden, hatte sich aber in der 1-2 m dicken dürren Moosschicht so schnell fortgepflanzt, daß es gleichzeitig an zehn andern Stellen hervorbrach. Jetzt, eine halbe Stunde nach der ersten Entzündung, stand bei unserer Rückkehr zum Schiffe schon die ganze Landzunge in hellen Flammen. Die noch am Lande befindlichen Leute wurden sogleich zurückbeordert; eine kurze Ueberlegung sagt mir, daß das Schiff hier nicht bleiben darf. Springt der Wind um, was jeden Augenblick geschehen kann, dann wird der Aufenthalt hier wegen des Rauches nicht nur unleidlich, sondern bei der geringen Entfernung des Ankerplatzes von dem Herd des Feuers kann auch die größte Gefahr für das Schiff entstehen. Ich lasse daher Dampf machen, um nach dem nächsten nur drei Seemeilen entfernten Hafen zu gehen. Was ist aus der gestern erträumten dreitägigen Ruhe geworden?
Die Dampfpinasse wird mit einem andern Boot im Schlepptau vorausgeschickt, läuft zwar an dem ihr bezeichneten Eingange vorbei, hört die Signalschüsse nicht mehr und verschwindet um die nächste Ecke, sie wird aber zurückkehren, wenn sie das Schiff nicht folgen sieht, da dem Führer die erhaltenen Ordres ja bald sagen müssen, daß er zu weit gegangen ist. Um 4 Uhr nachmittags wird in dem nächsten, „Halt-Bay“ genannten Hafen geankert und dort gleich wieder mit Holzfällen und Wassereinnehmen begonnen. Dieser Hafen ist auch wieder eine köstliche kleine Idylle, das Ausbleiben der Dampfpinasse macht mir aber so viel Sorge, daß die Naturschönheiten jetzt ohne Reiz für mich sind. Das Holz ist gut, das Trinkwasser vorzüglich, ein Fischzug ergibt 146 Stück großer fetter Makrelen. Die Nacht bricht herein, der Himmel über dem Gray-Hafen ist von dem mächtigen Waldbrande blutroth gefärbt, und die Sorge um die verirrten Boote raubt mir den Schlaf. Das Schiff ist so mit Signallaternen behängt, daß es von außerhalb des Hafens gesehen werden muß, zum Ueberfluß lassen wir noch in gewissen Zwischenräumen eine Rakete steigen.
Beim ersten Tagesgrauen wird mir die Meldung gemacht, daß die Boote nicht zurückgekehrt seien; ich muß also mit dem Schiffe sie suchen gehen, da sie ohne Waffen und ohne Proviant zweifellos in Gefahr sind. Ich bin in sehr großer Sorge. Es ist zu häufig schon vorgekommen, daß in diesen Gegenden einzelne Boote von Indianern angegriffen, die Insassen ermordet und die Boote dann, um alle Spuren zu verwischen, vollständig vernichtet wurden; dies konnte also auch unsern Booten passiren. Um 4 Uhr morgens verläßt das Schiff den Hafen wieder und befindet sich in einer Stunde vor der nächsten tiefen Bucht, von welcher keine Karten existiren, in die ich daher ohne großen Zeitverlust und mögliche Gefahr für das Schiff auch nicht einlaufen kann. Der erste Offizier erhält daher den Auftrag, mit zwei bewaffneten Booten die Bucht abzusuchen, und das Schiff geht, nachdem Zeit und Ort der Wiedervereinigung angeordnet ist, weiter, um an der nächstgelegenen Küste nach den Verirrten zu suchen. Ich bin in wirklich ernster Sorge; sechs Menschen und zwei Boote auf solche Weise zu verlieren ist wahrlich keine Kleinigkeit. Das Schiff läuft kreuz und quer, alle Ferngläser sind in Thätigkeit, die obersten Sitze auf den Masten sind mit zuverlässigen und wegen ihrer scharfen Augen bekannten Männern besetzt, halbstündlich wird ein Signalschuß abgefeuert; doch alles ist vergebens, um 10 Uhr sind wir wieder ohne Resultat vor der erstgenannten Bucht, aus welcher auch bald die dahin entsandten Boote zurückkehren, ohne eine Spur von den Vermißten gefunden zu haben. Es waren zwar Fußspuren und verlassene Hütten von Indianern gefunden, die Fußspuren auch in das Innere verfolgt worden, doch wurden keinerlei Anzeichen gefunden, welche auf unsere Boote oder auf einen stattgehabten Kampf hätten deuten können. So blieb denn kein Zweifel, daß unsere verlorenen Boote hier und in dem Umkreis von 10 Seemeilen, welche das Schiff durchsucht hatte, nicht waren. Nun kam eine neue Sorge, nämlich die, daß, wenn die Boote weiter gegangen waren, sie leicht in ein 25 Seemeilen von Halt-Bay entferntes Labyrinth von unerforschten Kanälen eingelaufen sein konnten, weil von unserm Standort aus die Küste bis dahin keine Buchten mehr aufwies, die Boote also nur dort einen Liegeplatz finden konnten. Waren sie wirklich bis dahin gekommen und in jene unbekannten Straßen eingelaufen, dann waren sie meiner Ansicht nach verloren und mir blieb dann nur die Alternative, entweder mit großer Vergeudung von Zeit ein hoffnungsloses Suchen fortzusetzen, oder aber Menschen und Boote im Stich und ihrem Schicksal zu überlassen, weil ihnen meiner Ueberzeugung nach keine Rettung mehr zu bringen war. Nur eine Hoffnung war übrig. Der in der Dampfpinasse gewesene Kohlenvorrath konnte nach der Berechnung und unter Zugrundelegung der günstigsten Stromverhältnisse nur bis zum Eingang jenes Labyrinths gereicht haben, Holzfeuerung ist für diese Art Dampfkessel nicht geeignet; hat also nicht etwa ein tückischer Zufall die Geschwindigkeit der Boote beschleunigt, dann müssen sie noch vor der gefürchteten Stelle bewegungslos geworden sein und in irgendeinem kleinen Winkel an der Küste liegen.
Zu meiner Stimmung, welche ich wol nicht näher zu schildern brauche, paßt auch das Wetter. Im Laufe des Vormittags hat sich die ortsübliche Witterung eingestellt, es weht ein Sturm. Die ganze Straße ist in Wasserdampf eingehüllt; die vor dem Sturm hinjagenden Wolken legen sich schwer bis aufs Wasser und hüllen alles in dichten Nebel. Der Wind fegt die Straße allerdings so oft auf Augenblicke rein, daß man mit dem Schiffe sicher vorwärts gehen kann, immerhin ist solches Wetter aber schlecht geeignet, um weite Strecken, in welche das Schiff nicht eindringen kann, durch Boote absuchen zu lassen. Endlich um 12 Uhr mittags bin ich an der Stelle angelangt, wo es sich entscheiden soll, ob die verlorenen Boote gefunden oder aufgegeben werden. Die beiden Kutter werden fertig gemacht, mit Proviant und Waffen versehen und sollen eben von dem Schiffe absetzen, als aus der Takelage ein Boot unter Land in Sicht gemeldet wird und zwar in der Richtung zum Eingang in die unerforschten Kanäle. Das Schiff dampft gleich, soweit die Sicherheit dies erlaubt, näher heran und bald wird in dem Boot unsere Jolle recognoscirt, welche mit aller Anstrengung aber ohne Erfolg gegen Wind, Wellen und Strom anrudert. Hier waren also richtig die Boote festgelegt! Es ist keine Möglichkeit, daß die Jolle auf diese Weise zum Schiff herankommen kann; die Manöver des Schiffes, um das Boot zum Abhalten zu bewegen, werden auch nicht verstanden; so muß denn ein Kutter unter Segel hin, um das Boot zu holen und mit ihm, der empfangenen Weisung gemäß, mit dem Wind und dem Strom hinter eine Insel in ruhiges Wasser zu laufen, wo das Schiff sie aufnehmen wird.
Uebersichtskarte der Magelhaens-Straße.
Ich enthalte mich einer nähern Beschreibung der Mühen mit welchen die Herbeischaffung der Boote bei dem schlechten Wetter verknüpft war; der Umstand, daß die Jolle erst um 3 Uhr und die Dampfpinasse erst abends um 6 Uhr im Schlepptau eines Kutters zum Schiff zurückkehrte, sagt wol genug. Boote und Leute habe ich also gottlob! unversehrt wieder, nach dem in Aussicht genommenen Hafen kann ich aber wegen der vorgerückten Tageszeit nicht mehr kommen. Vielleicht ist es möglich, vor vollständiger Dunkelheit noch einen näher gelegenen Ankerplatz (Connor-Cove) zu erreichen. Also vorwärts mit dem Schiffe!
Bei Dämmerung wird noch die Stelle festgestellt, wo der Eingang zu dem kleinen Hafen liegen muß, und mit Volldampf geht es darauf los. In dunkler Nacht stehen wir vor einer hohen Wand, weder ein Eingang ist zu sehen, noch die am Eingang liegende, noch die in dem Hafen liegende kleine Insel. Soll ich umdrehen? Eine im Fahrwasser verborgene blinde Klippe macht den Aufenthalt dort bei Nacht gefährlich; noch ein Blick auf die dunkle Wand läßt eine leichte Senkung in den obern Contouren erkennen, darunter wird der Eingang wol liegen. Der Navigationsoffizier sitzt auf dem Bugspriet, um zu melden, wenn dieses die vor uns liegende Felsenwand berühren will. Das Schiff geht langsam vorwärts, immer dunkler wird es, das Vordertheil des Schiffes scheint sich schon in die Felsenwand einzubohren, zu beiden Seiten haben wir schon feste schwarze Massen: da meldet der Navigationsoffizier die kleine Insel am Eingang dicht voraus. Ich schaue mich um und sehe hinter uns in der Dunkelheit einen dunkler schattirten kleinen Fleck, welcher die Insel am Eingang, mithin die vorn gemeldete die im Hafen liegende sein muß. Ein Rundblick sagt mir, daß die Dunkelheit rund um uns her gleich tief ist, daß wir also nach allen Seiten hin annähernd gleich weit vom Lande abliegen — Fallen Anker! Der Navigationsoffizier mißt noch in einem Boote mit einer Leine die Entfernung nach vorn, hinten und beiden Seiten aus und bestätigt, daß das Schiff ohne Gefahr so liegen bleiben kann, da es sich ziemlich in der Mitte des Hafens befindet. — Die Seefahrt in der Magelhaens-Straße hat doch ihre ganz eigene Seite!
Stiller Ocean, 24. Januar.
Gestern morgens 5 Uhr verließen wir Connor-Cove wieder und ankerten nach drei Stunden im Inselhafen, um dort noch etwas Holz zu fällen und unsern Wasservorrath zu ergänzen. Heute nachmittags 3 Uhr war das Schiff nach Beendigung der Arbeiten wieder seeklar, verließ den letzten Hafen in der Magelhaens-Straße und steuerte abends 6 Uhr in den Stillen Ocean ein. Die große Wasserfläche vor mir berührt mich fremdartig, es ist mir als gewänne ich nach langer Einschließung die Freiheit wieder. Vor uns und zu beiden Seiten freies Wasser, keine Aufregung, keine besondere Anstrengung mehr, und hinter uns verschwindet in der hereinbrechenden Nacht allmählich das mächtige Felsenthor, aus welchem wir vor wenig Stunden wieder in das freie Leben eintraten.
Ein steifer Südwind treibt uns unter Segel mit 12 Seemeilen Geschwindigkeit in der Stunde unserm nächsten Ziele entgegen; aber weder diese schöne Fahrt, noch die auf ihren riesigen Schwingen hinter uns herschwebenden Albatrosse haben mich an den Schreibtisch geführt, sondern ein eigenthümlicher Wahn, welchem ich Ausdruck geben muß. Die Fahrt durch die Magelhaens-Straße hat die fixe Idee in mir hinterlassen, daß wir uns nunmehr schon auf dem Heimwege befinden. Die acht Tage, welche ich in jenen Straßen zubrachte, fassen eine solche Fülle von Anstrengung und Aufregung in sich, haben den für Erinnerung bestimmten Theil des Gehirns mit so viel großartigen Naturschönheiten und interessanten kleinen Zufällen angefüllt, daß es sorgsam vertheilt für ein ganzes Jahr ausreichen würde. So nahe die Zeit noch liegt, so fern ist sie mir schon gerückt; sie erscheint mir wie ein langes Ringen, nach welchem die Ruhe folgen muß. Ich habe 11000 Seemeilen oder nahezu 3000 deutsche Meilen jetzt schon zurückgelegt, der Weg durch den Stillen Ocean über Australien, Indien, Suezkanal, durch das Mittelmeer, weist nur noch 18000 Seemeilen auf, auf meiner eigentlichen Station werde ich höchstens sechs Monate sein: so macht das vor mir Liegende auch fast nur den Eindruck einer ununterbrochenen Reise nach der Heimat zu.