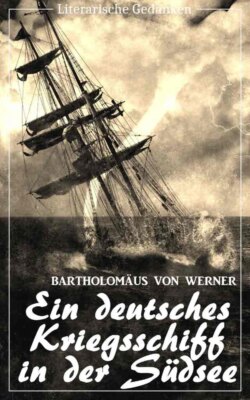Читать книгу Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee: Die Reise der Kreuzerkorvette Ariadne in den Jahren 1877-1881 (Bartholomäus von Werner) (Literarische Gedanken Edition) - Bartholomäus von Werner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4. – Die Marquesas-Inseln.
Оглавление18. Mai 1887.
Die Marquesas-Inseln liegen hinter uns und haben uns neben viel Schönem und Interessantem in der Hauptsache doch das gebracht, was wir erwartet hatten, nämlich — Enttäuschung. Die mit so großer Ueberschwänglichkeit geschriebenen Reiseberichte lassen von vornherein einige Uebertreibungen vermuthen; hier ist aber zu viel erdichtet, und man kann nicht anders annehmen, als daß die Reisenden infolge der fast übermenschlichen Entbehrungen, welche zu ihrer Zeit mit diesen langen Reisen in kleinen, übermäßig stark bemannten Segelschiffen verknüpft waren, beim Landen an diesen Inseln vollständig geblendet waren. Namentlich gilt dies für die Beurtheilung des weiblichen Geschlechts, denn man muß selbst monatelang von dem schönen Geschlecht abgesperrt gewesen sein, um zu verstehen, daß fast jeder Seemann nach jeder langen Seetour zunächst in jeder Schürze einen Engel sieht. Meines Erachtens hatten die Reisenden aber trotzdem keine Veranlassung mit so grellen Farben zu malen, weil das, was hier gefunden wird, immerhin interessant genug ist, um auch ohne Schönfärberei zu fesseln.
Ich wollte ursprünglich nur den Haupthafen Port Anna-Maria auf Nuka-hiva besuchen, änderte aber meine Disposition, als ich aus den Segelanweisungen ersah, daß die Franzosen, denen die Marquesas-Inseln nominell gehören, praktisch alle Controle über die Einwohner der Marquesas-Inseln aufgegeben haben und nur noch die Insel Nuka-hiva besetzt halten sollen. Da ferner die Berichte besagen, daß die Einwohner der Marquesas-Inseln am zähesten an ihren alten Gebräuchen festhalten, daß dieselben noch ziemlich auf demselben Standpunkte stehen wie vor hundert Jahren, und alle Missionare ihr Bekehrungswerk aufgeben mußten, entschloß ich mich, da es mir nur darauf ankam, zur Auffrischung unsers Speisezettels Früchte, Eier und Hühner einzunehmen, nach Omoa auf Fatu-hiva, der südöstlichsten Insel, zu gehen, um dort einen Einblick in die als so interessant geschilderten Verhältnisse zu erhalten und dann nur in Port Anna-Maria dem dortigen Gouverneur meinen Besuch zu machen, um seinen Machtbereich nicht besucht zu haben, ohne der Höflichkeit zu genügen. Erst hatte ich daran gedacht, auch die mittlere Insel Tahu-ata oder Santa-Cristina anzulaufen, weil sie früher von den Franzosen für der Befestigung werth gehalten worden war, gab diese Absicht aber auf, weil der Besuch doch zu viel Zeit gekostet hätte; ebenso verzichtete ich auf Dominica, weil dort nach den Segelanweisungen nichts zu holen ist, wogegen ich in Nuka-hiva allerdings erfuhr, daß die einzige größere Plantage in der ganzen Gruppe gerade auf dieser Insel liegt und — merkwürdig genug — in deutschen Händen ist.
In Bezug auf die politischen Verhältnisse ist zu bemerken, daß, wie schon gesagt, die Marquesas-Gruppe nominell französische Colonie ist, doch bekümmern sich die Franzosen mit Ausnahme von Nuka-hiva und ganz neuerdings auch Dominica aber so gut wie gar nicht um Land und Leute. Die Hoheitsrechte erwarb Frankreich im Jahre 1842 durch Ablösung, indem es Besitz von den Inseln nahm und dem ersten Häuptling von Nuka-hiva und dessen Erben eine monatliche Leibrente von 50 Frs. aussetzte, womit indeß ein Besitzrecht auf die andern Inseln nicht erworben werden konnte, weil nicht nur die einzelnen Inseln, sondern auch die verschiedenen Stämme auf jeder Insel ganz unabhängig voneinander sind. So kam es denn wol auch, daß die Franzosen überhaupt nicht versuchten, auf den verschiedenen Inseln festen Fuß zu fassen, sondern sich damit begnügten, nur auf Nuka-hiva eine Art von Regierung zu errichten und sich auf Tahu-ata zu befestigen, weil sie fürchten mußten, von dort ebenso vertrieben zu werden, wie sie von Huheine (eine der Gesellschafts-Inseln) durch die Eingeborenen vertrieben worden sind. An die andern Inseln haben sie sich wol zunächst überhaupt nicht herangewagt, denn wenn Dominica z. B. die bei weitem wichtigste und größte ist, so ist sie aber auch die am stärksten bevölkerte und zwar mit einem schwer regierbaren Menschenschlag.
Warum Frankreich diese Colonie überhaupt erworben hat, ist mir unverständlich geblieben. Wie aus der noch folgenden Beschreibung des Landes ersichtlich werden dürfte, war auf die Gewinnung von Landesproducten nicht zu rechnen, auch konnte bei der schwachen und namentlich armen Bevölkerung hier kein Absatzgebiet für französische Waaren vermuthet werden; somit bleibt der militärisch-politische Gesichtspunkt übrig. Die Inselgruppe ist aber geographisch so ungünstig gelegen, daß sie auch für militärische Operationen nie eine Basis abgeben kann, weil von hier bis zu dem nächsten Lande Distanzen zu durchlaufen sind, welche alle Dispositionen über den Haufen werfen müssen. Auch können die Inseln zu derartigen Zwecken schon deshalb keine Verwendung finden, weil für eine größere Zahl von Schiffen die Häfen fehlen; aber wären auch Häfen für große Flotten vorhanden, so bliebe immer noch die Frage zu beantworten, was die Flotten hier sollen, da in diesem unermeßlichen Wasserbecken, dessen Mittelpunkt die Marquesas-Inseln bilden, alle Angriffsobjecte fehlen. Die Inseln sind wegen ihrer abgeschiedenen Lage allerdings gut für Kaperschiffe gelegen, doch gibt es wiederum hier nichts zu kapern, weil dieses Meer so gut wie gar nicht befahren wird. Es bleibt daher für die Erwerbung dieser Colonie nur die Wahrscheinlichkeit übrig, daß es in jener Zeit für die großen Seemächte zum guten Ton gehörte, möglichst viele Colonien zu besitzen.
Die Marquesas-Inseln haben den Franzosen denn auch keinerlei Nutzen gebracht. Schiffahrt existirt hier nicht, weil die französischen Gesetze die Walfischfänger, welche nur allein und allerdings häufig hier anliefen, vertrieben haben. Diese Schiffe wurden mit so hohen Lootsengebühren belegt, daß sie das Anlaufen dieser Häfen aufgeben mußten. Dieses Ziel lag wol in der Absicht der Colonialregierung, denn es wurden französische Walfischfänger subventionirt, der Fang wurde auch mit schönen und guten Schiffen begonnen, bald aber wieder aufgegeben, wol weil dieser Erwerbszweig dem französischen Naturell nicht zusagt. Es gibt jetzt keine französischen Walfischfänger mehr, und diejenigen anderer Nationalität, welche wenigstens etwas Handel und Wandel brachten, sind verscheucht. Der einzige Schiffsverkehr wird zur Zeit durch den monatlich einmal hier anlaufenden Postschooner (Segelschiff), welcher zwischen San-Francisco und Tahiti fährt, hergestellt. Derselbe wird von Frankreich subventionirt und läuft die Marquesas nur auf dem Wege von Amerika nach Tahiti an; Briefe nach Europa müssen daher den großen Umweg über Tahiti machen und bleiben außerdem noch 14 Tage dort liegen, bis der Schooner wieder befrachtet ist. Die großen Geldzuschüsse, welche Frankreich an diese Colonie gezahlt haben soll, sind vermuthlich die Ursache einer später erfolgten Einschränkung gewesen. Die Regierung in Nuka-hiva wurde soweit vereinfacht, daß als Gouverneur nur ein lieutenant de vaisseau übrigblieb. Die Befestigungen auf Tahu-ata wurden verlassen und die Truppen zurückgezogen. Das Personal, welches jetzt übrig ist, wohnt auf Nuka-hiva und besteht aus dem genannten Gouverneur, einem untergeordneten Verwaltungsbeamten, einem frühern Bombardier als Wegebaumeister, einem gleichzeitig Lootsendienste versehenden Hafenmeister und vier Gensdarmen, welche zur Zeit auf Dominica sind, um die mit Chinesen bearbeitete deutsche Plantage zu beschützen, wie sie sagen. Da sie sich aber früher auf diese Insel nicht wagten, so glaube ich nicht an die gute Absicht, sondern eher daran, daß die Deutschen beaufsichtigt werden sollen, oder daß man ihnen eine hohe Steuer auferlegen und, durch den breiten deutschen Rücken gedeckt, auf der Insel sich überhaupt festsetzen will.
Der Gouverneur der Marquesas-Inseln steht unter dem Gouverneur von Tahiti, einem Stabsoffizier der französischen Marine, obgleich hier und dort ganz verschiedene Rechtszustände bestehen. Tahiti mit der Paumotu-Gruppe steht unter französischem Protectorat, während, wie erwähnt, die Marquesas-Inseln französische Colonie sind.
Der Unterschied besteht darin, daß der Gouverneur von Tahiti absoluter Herrscher ist, Gesetze nach augenblicklicher Laune erläßt und aufhebt, sofern nicht der etwa gerade anwesende Admiral des Südsee-Geschwaders ihm ins Handwerk pfuscht, während in der Colonie französisches Gesetz waltet.
Auf Nuka-hiva wird, um die Kosten der Verwaltung zu verringern, eine Kopfsteuer erhoben, von welcher die andern Inseln befreit sind, weil auf ihnen keine Autorität besteht, welche sie erheben könnte. Diese Kopfsteuer ist außerordentlich hoch und beträgt für jeden Mann 20 Frs. und für jeden Hund, obgleich derselbe seinem Herrn keinerlei Nutzen bringt, sondern nur aus alter Gewohnheit als Hausgefährte gehalten wird, 10 Frs. Ganz abgesehen davon, daß diese letztere Steuer die Eingeborenen sehr verbittert, werden sie aber dauernd noch durch die Art der Eintreibung der Steuer gereizt, durch welche der Gewinn der Steuer fast zu einem Nichts wird. Da der Eingeborene in der Regel kein Geld besitzt, muß er die Steuer abarbeiten, und wir sehen so die alten Frondienste hier wieder aufleben. Die Eingeborenen werden zum Straßen- und Brückenbau beordert und wird ihnen das Tagewerk zu 2 Frs. angerechnet; arbeiten müssen sie dann solange bis der Betrag ihrer Steuer und auch der ihres Hundes gedeckt ist. Die Arbeit wird von dem vorhergenannten Bombardier geleitet, welcher, wol infolge seines Unvermögens, die Arbeit richtig zu beurtheilen, keinerlei Autorität über die Eingeborenen zu haben scheint, und so kommt es, daß wenig gearbeitet und viel geschwatzt wird. Ich habe längere Zeit dem Wiederaufbau einer sehr nothwendigen, durch den starken Regen weggeschwemmten Brücke, bei welchem 10 Mann beschäftigt waren, zugesehen und konnte keinen Fortschritt der Arbeit wahrnehmen. Die Leute saßen zusammen, rauchten und unterhielten sich, während der Bombardier (ein Elsässer) mit uns eine deutsche Unterhaltung anfing. Ab und zu gingen 2 oder 3 Mann nach einem Stein, welchen bequem ein Mann hätte tragen können, und legten ihn behutsam mit viel Zeitaufwand in den Bergbach, anstatt ihn an seine Stelle zu werfen, und nahmen dann ihren alten Platz wieder ein. Ich bin der Ueberzeugung, daß dies auf 20 Frs. zu veranschlagende Tagewerk von einem fleißigen Arbeiter in einem halben Tage geschafft worden wäre.
Tahu-ata ist, wie schon erwähnt, seit vielen Jahren von den Franzosen wieder aufgegeben worden; von den Befestigungen und Blockhäusern konnte ich beim Passiren nichts mehr entdecken. Die Bauwerke sollen von den Eingeborenen längst abgetragen und das Material von ihnen zum Bau ihrer Hütten verwendet worden sein.
Das Besitzrecht auf diese, wie auf die andern thatsächlich unabhängigen Inseln wird dadurch aufrecht erhalten, daß alljährlich einmal ein französisches Kriegsschiff die verschiedenen Ankerplätze für ein bis zwei Tage anläuft. Eine Verbindung mit den Eingeborenen scheint aber auch dann nicht stattzufinden, wenigstens gehen in Fatu-hiva, nach Aussage der Eingeborenen, die französischen Offiziere und Mannschaften weder an Land, noch kommen die Eingeborenen auf das Schiff. Ein englisch sprechender Eingeborener in Omoa gab mir als Grund die Unmöglichkeit einer Verständigung an, weil auf den französischen Schiffen niemand englisch und von den Eingeborenen keiner französisch verstände; die Ursache liegt aber tiefer, da die französischen Seeoffiziere größtentheils so viel englisch verstehen, um sich verständlich machen zu können. Der Grund liegt einfach in dem ausgeprägten Haß, welchen die Insulaner gegen die Franzosen hegen und welchem sie auf den andern Inseln auch ungescheut Ausdruck geben. Der Sohn der sogenannten Königin von Nuka-hiva, ein Mann von etwa 25 Jahren, welcher in Paris erzogen worden ist, sprach sich einigen unserer Offiziere gegenüber dahin aus, daß sie das französische Joch sofort abwerfen würden, sobald sie auswärtiger Hülfe gewiß seien. Auch bestätigte ein dort lebender Däne, welcher wol nationaler Ueberlieferung gemäß mit französischem Wesen sympathisiren muß, das Vorhandensein einer sehr feindlichen Stimmung gegen die Franzosen; des abfälligen Urtheils eines Engländers will ich hierbei gar nicht Erwähnung thun.
Die Bodengestaltung der Inseln ist eine ganz merkwürdige und bei allen eine auffallend übereinstimmende. Die Marquesas-Inseln erheben sich nicht, wie dies in der Regel bei derartigen Inseln der Fall ist, kegelförmig aus dem Meere, sondern auf einer länglichen, nach den Enden spitz zulaufenden Basis steigt ziemlich genau in der Mittellinie ein Gebirgsrücken von 1000 bis 1250 m Höhe mit scharf gezacktem steilen Kamm an, welcher die Insel ihrer ganzen Länge nach in zwei voneinander vollkommen abgeschiedene Hälften theilt, da ein Uebersteigen dieses an seinen Endpunkten fast senkrecht nach dem Meere abfallenden Bergrückens unmöglich scheint und wol auch unmöglich ist. Nimmt man an, daß der Fuß des eigentlichen Bergrückens da beginnt, wo zwischen den nachher genannten Rippen, welche sich rechtwinkelig an den die Insel durchschneidenden Bergrücken anlehnen, das ebene Gebiet der kleinen Thäler aufhört, dann erhält man für diese obere Felsenwand eine Basis, welche an den schmäleren Stellen der Insel etwa gleich der Höhe ist, an den äußersten Enden die Höhe des Bergrückens lange nicht erreicht. Dies gibt der Insel das äußere Ansehen eines langgestreckten Keils, der für das Auge so scharf erscheint, daß man ihn unwillkürlich mit einer auf dem Rücken liegenden Messerklinge vergleicht, zumal der obere Kamm eine so geringe Dicke zu haben scheint, daß man nicht versteht, wie dieses Gestein Jahrtausenden trotzen konnte. Man hat das Gefühl, als ob ein Geschoß diese Felsenwand durchschlagen müßte, und wird in dieser Anschauung dadurch noch bestärkt, daß an verschiedenen Punkten nahe dem Gipfel sich dem Auge in der Felsenwand Durchbrüche oder Löcher bieten, an welchen man keine für das Auge meßbare Dicke des Gesteins feststellen kann.
Grundriß einer Marquesas-Insel.
Selbst die Natur scheint sich dessen bewußt gewesen zu sein, wie künstlich das von ihr hier aufgeführte Bauwerk ist, denn sie hat den Mittelrücken mit rippenähnlichen Strebepfeilern versehen, wie der Baumeister große Steinwände abstrebt. Diese Seitenrippen lehnen sich an den schmalen Enden der Insel unter sehr steilem Winkel an das Hauptgebirge an und reichen hier, wo der Mittelkamm eine geringere Höhe hat, bis zu dessen Gipfel hinan. Im allgemeinen indeß zweigen sie sich von der halben Höhe aus ab und laufen dann unter einem Winkel von etwa 45° nach dem Meere zu aus, wo sie kleine Buchten mit fruchtbaren Thälern bilden, wenn sie sich, allmählich abfallend, in das Wasser senken, aber sich in steile Klippen umwandeln, wenn sie plötzlich, wie absichtlich jäh unterbrochen, eine senkrecht nach dem Wasser abfallende Wand als Abschluß erhalten. In diesem letztern Falle hat man dann das äußere Bild der Giebelwände einer Reihe dicht nebeneinander gestellter Schuppen, da die Oberfläche der Rippen fast überall wellenartig gebildet ist, und die einzelnen Wellen fast gleiche Form und Höhe mit spitzem Winkel sowol am Kamme wie im Thale zeigen. Dieser Wechsel gibt der Landschaft großen Reiz, welcher noch dadurch erhöht wird, daß aus den Einschnitten der oft hoch über der Meeresfläche liegenden Giebel häufig sich kleine Bäche oder Wasserfälle ergießen und ihr Wasser direct in das Meer hinabstürzen lassen, ohne die senkrechten Felswände zu berühren.
Das Bild, welches sich dem Beschauer an der Leeseite der Inseln als Ganzes bietet, ist etwa das folgende.
An eine mächtige Felsenwand, welche in der Höhe nur mit Gräsern und kleinen Sträuchern bewachsen ist, zwischen denen hier und da eine vereinzelte Kokospalme, von welcher man nicht weiß wie sie dorthin kommt, sich erhebt, lehnen sich Bergabhänge, welche auf ihrem Rücken in der Regel keinerlei Cultur zeigen, daher auch wol nicht culturfähig sind, wahrscheinlich aus Mangel an Erde und Wasser, sowie wegen Ueberfluß an Sonne. Die zwischen den Abhängen liegenden Thäler, welche selten eine große Tiefe haben, zeigten zu unserer Zeit eine Ueppigkeit der Vegetation, wie sie nicht reicher gedacht werden kann. Die Thäler waren mit solchen Laubmassen angefüllt, daß man hätte wähnen können, die hohen Bergwände seien eines reichen Laubschmucks entkleidet worden und das ganze abrasirte Laub habe sich in dicken Wolken in den Thälern abgelagert. Auch am Lande konnte dieser Eindruck keine wesentliche Aenderung erfahren, weil der aus Brotfruchtbäumen, Kokospalmen, Orangen- und andern Fruchtbäumen verschiedener Art gebildete Wald ein so dichtes Laubdach hatte, daß die Sonnenstrahlen nur sehr vereinzelt Durchgang fanden. Immer wird hier die Vegetation jedoch nicht in so überreicher Fülle prangen — glücklicherweise, darf man sagen, denn die letzten zehn Monate waren eine ununterbrochene scharfe Regenzeit, welche das Laub zu seltener Kraft und Schönheit getrieben, die Früchte aber vom Reifen abgehalten hatte. So haben wir, die wir zur richtigen Reifezeit hier waren, nur halbreife Früchte erhalten können. In der Regel sollen die Marquesas-Inseln vorzugsweise an Dürre, welche oft einen an Hungersnoth grenzenden Zustand erzeugt, leiden, doch sollen geregelte Jahreszeiten überhaupt selten sein. Entweder herrschen unaufhörliche schwere Niederschläge, oder das Wasser fehlt ganz.
Ich kehre zu meinem Bilde zurück. Von den höhern Regionen des Mittelgebirges stürzen Wasserfälle in die Thäler hinab, welche während der wolkenbruchartigen Regengüsse oft von großer Schönheit sind, ihre Kraft und ihr ganzes Ansehen aber sofort verlieren, sobald der Regen aufgehört hat. An der Südküste von Nuka-hiva, welche ich in ihrer ganzen Länge passirte, habe ich mit Ausnahme des einen besonders großen Wasserfalls keinen der von Krusenstern enthusiastisch geschilderten Wasserfälle entdecken können, obgleich wir in der stärksten Regenzeit dort waren.
Die schmalen Enden der Inseln werden durch steilabfallende Felswände gebildet und man sieht hier häufig schroffe, dunkelgefärbte Steingebilde, welche, von dem Hauptlande abgelöst, der Landschaft an diesen Stellen ein wildzerrissenes Ansehen geben, während die Inseln im allgemeinen und für die Hauptmasse des Landes diese Bezeichnung nicht verdienen.
Ueber die Ertragfähigkeit des Landes glaube ich mich erschöpfend dahin aussprechen zu können, daß das Land wol im Stande wäre, viele Kokosnüsse zu liefern, weil der Baum insofern sehr genügsam ist, als er eigentlich nur Seeluft beansprucht. Je näher am Strande, desto besser für ihn; ob er dort fetten Boden oder magern Sand findet, ist ihm gleichgültig; ja es wird sogar behauptet, daß der unvermischte Korallensand ihm am zuträglichsten sei. Die Eingeborenen arbeiten aber nicht und so bleibt diese Ertragsquelle unausgenutzt. Baumwolle wird auch in guter Qualität gewonnen, es ist aber mit Ausnahme von Dominica und in beschränkterm Maße auch Nuka-hiva nicht genügend Land verfügbar, um nutzbringende Baumwollpflanzungen anlegen zu können, weil das vorhandene Land ganz für die den Lebensunterhalt der Eingeborenen bildenden Früchte in Anspruch genommen wird.
Handel wird zur Zeit eigentlich nicht getrieben, weil man die jährlich nur aus einigen kleinen Schoonerladungen bestehenden Producte wol nicht als solchen rechnen kann.
Die Bevölkerung der Marquesas-Inseln zeigt keinen einheitlichen Typus, man findet vielmehr auf jeder Insel, ja sogar in jedem Thal einen andern Menschenschlag, und wenn der Unterschied zuweilen auch nur gering ist, so ist er immerhin doch in die Augen fallend. Ich selbst kann allerdings nur von den Eingeborenen von Nuka-hiva und Fatu-hiva sprechen, doch wurde mir berichtet, daß die Eingeborenen von Dominica einer ganz andern Rasse angehören. Auf Fatu-hiva habe ich die beiden Hauptthäler besucht, auf Nuka-hiva nur oberflächlich die Bewohner von Port Anna-Maria gesehen, wie denn ja meine Beobachtungen überhaupt nur ganz oberflächliche sind und keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth erheben können. Wäre die Annahme richtig, daß die Inseln der Südsee, wie von verschiedenen Seiten behauptet wird, Ueberreste eines versunkenen Continents und die Bevölkerungen der verschiedenen Inseln die Nachkommen derjenigen sind, welche sich bei der Katastrophe auf die Berggipfel gerettet haben, dann könnte man behaupten, daß in altersgrauer Zeit ein fremder Volksstamm einen Einfall in das jetzige Gebiet der Marquesas-Inseln gemacht habe, von der Katastrophe überrascht worden sei und sich mit den Einheimischen auf die Berge rettete, um sich später mit ihnen in die übriggebliebenen Inseln zu theilen. Andernfalls bleibt nur die Annahme übrig, daß die Ursache der Verschiedenheiten in vielfachen Kreuzungen mit hierher verschlagenen Bewohnern anderer Inseln, sowie mit den früher hier verkehrenden Walfischfängern liegt, weil Frauen wie Mädchen dieser Inseln dem Fremden als ein Gebot der Gastfreundschaft zur Verfügung gestellt werden.
Was das Aeußere betrifft, so haben mir die Bewohner von Omoa am besten gefallen; ich bemerkte unter diesen einige wirklich schöne Menschen, doch fand ich im Widerspruch mit den frühern Berichten die Männer schöner wie die Frauen. Unter ihnen waren viele wirklich auffallend hübsche Gestalten mit schön geformten und muskelkräftigen Gliedern. Die Gesichter zeigten auch schöne Züge, und so wild und verwegen diese Leute infolge ihrer reichen Tätowirung auch aussahen, so entdeckte man doch, wenn man sie schärfer betrachtete, die gutmüthigsten Züge. Auf die Tätowirung wird hier außerordentlich viel Werth gelegt, und ich muß gestehen, daß diese fast ganz nackten Menschen durch ihre eingeäzte reiche Malerei eigentlich anständig angezogen sind. Ich hatte das Gefühl, daß diese Leute in ihrer Nationaltracht sich in jeder europäischen Stadt auf der Straße zeigen könnten, ohne daß der Mangel an Kleidung auffallen würde; jedenfalls verhüllt diese musterreiche Malerei mehr, wie ein einfarbiges Tricot dies zu thun vermag. Ich kann nicht leugnen, daß diese tätowirten Menschen einen tiefen Eindruck auf mich gemacht haben und ich es bedauern würde, wenn diese Sitte abkäme; ich kann daher auch nicht verstehen, wie der Commodore Powell diese Leute als durch Tätowirung entstellt bezeichnen kann, doch dies ist Geschmackssache. Ich kann mir wol denken, daß man mit diesen bunten, wild aussehenden Gesichtern unsere Kinder schrecken kann, scheußlich sehen die Köpfe deshalb aber noch nicht aus. Daß die hier lebenden Europäer gegen das Tätowiren eifern, hat den einfachen praktischen Grund, daß mit dem Aufhören dieser Sitte die Sitte des Kleidertragens einzieht und die Kleider nur von den Weißen bezogen werden können. Die englischen Missionare und die Kaufleute ziehen hier an demselben Strang, denn beide leben vom Handel. Der Eingeborene hat keine Verwendung für Geld; Taback und gleichartige Genußmittel schaffen zu wenig, Eisenwaaren haben einen zu langen Bestand, Branntwein geht gegen die eigenen Interessen, weil man den Eingeborenen arbeiten sehen will, um die Früchte seines Fleißes einzuheimsen. Da sind nun Kleider das beste Tauschobjekt. Für wenig Geld erhält man von Europa ein großes Stück leichten Stoffes, und ist die Sitte der Bekleidung allgemein eingeführt, dann bringt diese durch die Masse den Gewinn, weil Männer, Frauen und Kinder dieser bald sehr strengen Sitte gleichmäßig unterworfen sind. Soll ein Handelsartikel gefunden werden, welcher den Europäern Gewinn bringt und die Eingeborenen gleichzeitig zur Arbeit erzieht, dann ist der eingeschlagene Weg wol richtig; aber eine religiöse Nothwendigkeit zum Kleidertragen liegt für diese Menschen nicht vor, weil das Schamgefühl in so hohem Grade ausgebildet ist, daß es uns Europäern geradezu lächerlich vorkommt. Denn es werden z. B. zwei gleichalterige Männer, wenn sie auch ganz allein unter sich sind, nie beim Baden sich ganz entkleiden, wie es bei uns doch sehr häufig vorkommt. Ich beobachtete einmal in Omoa zwei Männer, welche in ihrem Kanu vom Fischfang kamen und in ziemlich großer Entfernung von dem Dorfe, wo ich mich befand, mit der Brandung auf den Strand liefen, um das leichte Fahrzeug nach dem ersten Auflaufen auf den Strand schnell vor der Rückkehr der Brandung ganz aufs Trockene zu ziehen. Da die Brandung fortwährend über das Kanu und dessen Insassen hinwegbrach, so hatten die beiden Männer sich ihrer dürftigen Kleidungsstücke auch noch entledigt und dieselben um den Kopf gewunden. Der hinten im Boot sitzende Mann hatte sich aber einen Lappen vorgebunden und der vorn Sitzende kehrte dem andern während der ganzen Landung stets den Rücken zu, sofern er nicht anderweit gedeckt war, bis sie ihre Kleidung wieder angelegt hatten. Wenn somit aus moralischen Gründen die Sitte des Kleidertragens nicht erforderlich ist, so würde es doch ein gutes Werk sein, wenn man die Eingeborenen hierfür gewinnen könnte, weil meiner Ansicht nach der Mangel an Kleidung die Hauptursache des Aussterbens dieses Menschenstammes ist. Ich will dies zu beweisen versuchen.
Es wird behauptet, daß an der rapiden Abnahme der Bevölkerung der Marquesas-Inseln die folgenden Ursachen Schuld tragen:
1. Die Sitte der Vielmännerei bei den Frauen. Dieselbe ist nicht in der Weise vorhanden, wie nach Berichten angenommen werden muß. Die Leute leben vielmehr in unserer Ehe ähnlichen Verhältnissen, d. h. ein Mann und eine Frau leben in der Regel zusammen und sorgen für ihre oder für fremde Kinder. Die Ehe wird indeß nicht auf Lebenszeit geschlossen, sondern kann jederzeit dadurch gelöst werden, daß entweder der Mann seine Frau wegschickt oder die Frau ihren Mann verläßt. Beide Theile sind in dieser Beziehung frei und ganz gleichberechtigt. Die Frau kann sich weder der Ausweisung widersetzen, noch kann der Mann seine weggegangene Frau zurückfordern oder mit Gewalt zurückholen. Eheliche Treue ist keine Tugend, weil das Verhältniß jederzeit gelöst werden kann, wenn der eine Theil dies wünscht. Die Kinder scheinen, sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, Gemeingut zu sein, jedenfalls werden sie von jedermann gut behandelt und beschützt. Die Leute eines Dorfes oder Thales bilden somit gewissermaßen eine große Familie, in welcher die einzelnen Glieder gewohnheitsmäßig paarweise zusammenleben, solange Neigung sie zusammenhält. Vielmännerei kommt zwar insofern vor, als die nicht verheiratheten Männer zeitweise mit der Frau eines Andern und zwar mit dessen Einwilligung für eine bestimmt verabredete Zeit zusammenleben, aber nur dann, wenn keine Mädchen vorhanden sind, welche mit diesen Junggesellen die Probe machen, wie es im Ehestande hergeht. Ob diese Freiheit der Sitten nun wirklich von nachtheiligem Einfluß auf das Wachsthum der Bevölkerung ist, wird schwer zu entscheiden sein, da die Zahl der prächtig aussehenden Kinder zur Zeit eine recht große ist. Muß der nachtheilige Einfluß aber nach unumstößlichem Naturgesetz vorliegen, dann wird eben von der bestehenden Freiheit sehr wenig Gebrauch gemacht, und ich glaube das letztere. Es ist allerdings eine Thatsache, daß die Männer ihre Frauen auf die früher hier häufiger zu Anker kommenden Walfischfänger geschickt und sie zwei bis drei Tage auf dem Schiff belassen haben, weil sie dann manches Werthvolle für die Gemeinde mit ans Land gebracht haben, die Schiffe kamen aber doch immerhin so selten und sind so schwach bemannt, daß dieser Einfluß kein einschneidender gewesen sein kann.
2. Die fast ununterbrochenen Kriege zwischen den benachbarten Thälern. Wie mir ein deutscher katholischer Missionar und ein englisch sprechender Eingeborener übereinstimmend versicherten, kommen diese sogenannten Kriege, wenn auch nicht häufig, zwar immer noch vor, verlaufen aber stets unblutig. Die ursprünglichen Waffen existiren gar nicht mehr und es werden nur noch Feuerwaffen gebraucht, zu denen aber entweder die Munition fehlt, oder die Waffen sind in so verkommenem Zustande, daß sie kaum noch gebrauchsfähig sind. Die Kriege entstehen gewöhnlich durch Landstreitigkeiten und werden in der Weise durch Verrath entschieden, daß die eine Partei die andere überrascht und Sieger wird, mithin die Bedingungen stellen kann, welche die unterliegende Partei annehmen muß. Diese Kriege können daher unmöglich die Ursache der allmählichen Entvölkerung sein.
3. Der übermäßige Genuß von Branntwein. Der Trunk scheint hier allerdings das alles beherrschende Laster zu sein, welchem vorzugsweise die rasche Abnahme der Bevölkerung zugeschrieben werden muß, wenn eine Abnahme wirklich stattfindet; letzteres kann noch angezweifelt werden, da der deutsche Missionar, dessen Angaben ich vollen Glauben schenke, vor sechs Monaten auf Fatu-hiva über 700 Seelen gezählt hat, während der englische Commodore Powell im Jahre 1867 nur 500 als die Einwohnerzahl dieser Insel angibt. Aber wirklich angenommen, daß die stets sich wiederholenden Klagen über das Aussterben dieser Eingeborenen begründet sind, so liegt die Ursache hier nicht in den directen Folgen der Trunksucht, sondern der Trunk tödtet meiner Ansicht nach nur auf indirectem Wege. Vor allen Dingen muß hervorgehoben werden, daß die Leute auf diesen Inseln, wo keine Europäer leben, sich ihren Rausch nicht in europäischem oder amerikanischem Schnaps, von welchem in Port Anna-Maria die ganze Flasche nur 10 Pfennig kostet, antrinken, sondern in einem selbstbereiteten berauschenden Getränk, welches aus gegorener Kokosmilch gewonnen wird und wegen fehlender Beimischungen der Gesundheit sehr viel weniger schädlich ist, als die billigen, von den klugen Weißen zusammengebrauten Höllentropfen es sind. Erwägt man, daß die Männer sich allabendlich gemeinsam bis zur vollsten Besinnungslosigkeit betrinken, so müßte man nach unsern Erfahrungen über Säufer jedenfalls annehmen, daß die große Mehrzahl der Männer die äußern Merkmale des Säufers tragen müßte, daß sie nicht nur des Abends sondern auch am Tage trinken würden, und schließlich, daß jede Nachkommenschaft ausgeschlossen wäre. Von alledem ist hier aber nichts zu merken. Die äußerlichen Merkmale des Säufers habe ich bei keinem entdecken können, wenngleich mein Gewährsmann, der englisch sprechende Eingeborene, mir sagte, daß er arbeite und dies nur könne, weil er sich nicht betrinke, obgleich er auch ganz gern trinke, aber stets Maß halte, während die andern so viel tränken, daß sie am andern Tage nicht arbeiten könnten. Ferner trinken die Leute nur des Abends und bleiben am Tage der Flasche fern, können aber auch am Abend enthaltsam sein, wie sie es während unsers Aufenthalts in Omoa durchgeführt haben, und zwar aus einem gewissen Schamgefühl vor uns, wie zwei zu verschiedenen Zeiten befragte Eingeborene übereinstimmend versicherten. Sei es nun, daß wirklich Scham sie vom Trinken abgehalten, oder daß die Ankunft des Schiffes die Geister so angeregt hatte, daß sie auf das gewohnte Gelage verzichteten, Thatsache bleibt es, daß das Trinken noch nicht die Form des gewohnheitsmäßigen Betrinkens angenommen hat. Ich glaube überhaupt nicht, daß die Leute trinken um zu trinken, sondern nur um den langen Abend zu verkürzen und einen Schlaftrunk zu nehmen — sie trinken aus Langeweile. Man muß bedenken, daß hier tagaus tagein die Nacht um 6 Uhr abends und der Tag erst 6 Uhr morgens beginnt, also Tag für Tag 12 Stunden Nacht. Da nun Arbeit unbekannt ist und die Leute den ganzen Tag träge im Nichtsthun hinbringen, so fehlt ihnen am Abend die körperliche Abspannung, um 12 Stunden schlafen zu können. Da ferner die Eingeborenen jedes Thales auf sich angewiesen sind, Schiffe hier nicht anlaufen, Kindererziehung überflüssig ist, keine Person etwas thun kann, was nicht jeder sieht, so fehlt aller Unterhaltungsstoff, nicht einmal klatschen können sie. Schließlich fehlt ihnen auch noch der Taback, um die Zeit mit Rauchen zu vertreiben, und so bleibt diesen bedauernswerthen Menschen, solange die französische Regierung nicht für Handel und Wandel sorgt, weiter nichts übrig als das Trinken. Daß der Abendtrunk nur als Schlafmittel gebraucht wird, kann vielleicht auch daraus gefolgert werden, daß das Getränk nahezu geschmacklos ist, also auch der Kitzel der Geschmacksnerven nicht in Rechnung zu ziehen ist.
Das Getränk wird gleich für das ganze Gemeinwesen bereitet und in einem großen Bambusrohr aufbewahrt, welches am Strande liegt und jedermann zugänglich ist. Das Herausziehen eines Stöpsels genügt, um sich die neben der großen Flasche liegende Kokosnußschale füllen zu können. Abends nach Sonnenuntergang versammeln die Männer sich um ein Feuer, und auch die Frauen kommen, um ihnen für einige Zeit Gesellschaft zu leisten; die Männer trinken solange bis sie liegen bleiben, während die Frauen Maß halten und sich nach einiger Zeit zurückziehen, um die Nacht in ihren Hütten zu verbringen. Hierbei wird nun meines Erachtens der Keim zu vielen unheilbaren Krankheiten gelegt. Das Klima, welches in der trockenen Jahreszeit ja so heiß ist, daß man froh sein muß, wenn man möglichst leicht bekleidet herumlaufen kann, ist in der Regenzeit frisch und während der Nacht viel zu rauh, um unbekleidet schlafen zu können. Die Leute müssen bei dem Mangel an Kleidung und dem Fehlen aller schützenden Hüllen, wie Decken oder Matten, daher des Nachts schon in ihren Hütten unter der Kälte leiden, und müssen geradezu frieren, wenn der Rausch sie verhindert, das wenigstens etwas schützende Dach aufzusuchen, und sie statt dessen unter freiem Himmel liegen bleiben, wo ihre nackten Körper nicht nur dem kalten Regen, sondern auch der rauhen Nachtluft voll ausgesetzt sind. So wird der innere Organismus dieser Menschen nicht direct durch den Trunk zerstört, sondern dadurch, daß durch häufige Erkältungen und danach durch mangelnde Pflege lebensgefährliche Krankheiten und in erster Reihe viele Fälle von Lungenschwindsucht entstehen. Zu unserer Zeit war die ganze Bevölkerung erkältet, Weiber und Kinder hatten den Schnupfen, die Männer husteten stark, und der Schiffsarzt will aus dem von allen Seiten ertönenden Husten vornehmlich Schwindsuchtshusten herausgehört haben. Nach allen Berichten soll Lungenschwindsucht hier auch sehr verbreitet sein.
Alte Männer habe ich in den beiden von mir besuchten Thälern auf Fatu-hiva nur drei gesehen, alte Frauen mehrere; ich glaube daher, daß die Weiber, welche mehr bekleidet sind und sich nachts in ihren Hütten aufhalten, den schädlichen Witterungseinflüssen weniger unterworfen sind und aus diesem Grunde ein höheres Alter erreichen. So wird aller Voraussicht nach dieser in sich abgeschlossene Menschenstamm in nicht zu langer Zeit infolge der Erblichkeit der Lungenschwindsucht ausgestorben sein. Wie sehr diese Menschen zeitweise unter der rauhen Witterung leiden, dürfte auch daraus hervorgehen, daß diese Leute, welchen die größte Gleichgültigkeit gegen das Tragen von Kleidern nacherzählt wird, während unserer Anwesenheit nur danach trachteten, alte Kleider zu erwerben. Für Geld war nichts, für alte Kleider alles zu haben. Ein nackter Eingeborener kam mit seinem ganzen, aus nahezu 100 Dollars bestehenden Vermögen an Bord, um dafür alte Kleider zu erwerben, und daß er gleich eine so große Summe mitbrachte, zeigt jedenfalls, welch geringen Werth er auf das Geld und welch hohen er auf Kleidungsstücke legte. So könnte eine wohlwollende Regierung oder Missionsgesellschaft gewiß leicht die Sitte der Bekleidung einführen, wenn zur richtigen Zeit eine verhältnißmäßig unbedeutende Summe gespendet und versucht würde, die Eingeborenen zunächst zur Arbeit zu erziehen, anstatt sie mit Lesen und Schreiben zu belästigen, was sie nicht gebrauchen, und ihnen christliche Lehren zu predigen, welche sie noch nicht verstehen. Da aber voraussichtlich aus dieser Insel Fatu-hiva, von welcher ich hauptsächlich spreche, nie ein Gewinn zu ziehen sein wird, läßt man die Eingeborenen verkommen, anstatt ihnen aus christlicher Liebe zu helfen. —
Ich will nun zu meinen eigenen Erlebnissen übergehen, bei deren Erzählung noch mancherlei zu Tage treten wird, was das Vorstehende ergänzt.
Nach ziemlich vierwöchentlicher Fahrt waren wir am 13. Mai abends der südlichsten der Marquesas-Inseln so nahe gekommen, daß es nöthig wurde, während der Nacht mit kleinen Segeln zu laufen, um das Land nicht vor Tagesanbruch zu erreichen. Vorsicht war um so mehr geboten, als es stürmisch war, die See hoch ging und der Mond durch dickes Gewölk verdeckt wurde. Mit Tagesanbruch am 14. wurden die Segel wieder gesetzt, und gegen 8 Uhr vormittags traten aus dickem Regengewölk die Umrisse der Insel hervor. Unsere Position war genau richtig, was bei einer Reise von 3000 Seemeilen, ohne Land gesehen zu haben, immer etwas zweifelhaft ist, weil die Chronometer doch auch zuweilen ihre Mucken haben und man so ziemlich auf diese allein angewiesen ist, wenn es sich um die Richtigkeit der Länge handelt. Wir waren zunächst an der Wetterseite der Insel, welche mit ihren 1200 m hohen Bergwänden die von dem Passatwind angetriebenen Wolkenmassen auffängt und hierdurch an dieser Seite fast bis zum Wasserspiegel in dichtes Gewölk eingehüllt ist, eine Erscheinung, welche sich bei allen in der Passatregion liegenden hohen Inseln während der Regenzeit wiederholt. Mit dem Näherkommen wird der Wolkenschleier allerdings durchsichtiger, doch nicht genügend, um eine Totalansicht der Insel erhalten zu können. Immerhin löst sich wenigstens die Südspitze der Insel aus dem Gewölk heraus und bietet uns einen schönen Blick. Wie die Ansicht der Südspitze von Fatu-hiva mit dem Thal Omoa zeigt, erhebt sich hier der Mittelkamm der Insel nahezu senkrecht aus dem Wasser, steigt in seltsam gezackter Linie beinahe 700 m hoch und zieht sich, allmählich bis zu einer Höhe von 1200 m anwachsend, durch die ganze Insel hindurch. Es ist ein außerordentlich fesselndes Bild.
Aus den schönen blauen Fluten, welche in hohen Wogen mit mächtigen weißen Schaumköpfen gegen das Land heranrollen, erhebt sich in majestätischer Ruhe diese wunderlich geformte Klippenwand. An ihrem Fuße bricht sich die Kraft der Wogen, welche zu weißem dampfenden Gischt gepeitscht an diesem ehernen Wunderwerk hinauflecken und brodelnd und schäumend den Fuß zu unterwühlen suchen. Unten ewige Unruhe, fortwährendes Anstürmen der Meeresgewalten, oben feierliche Ruhe. Hier steht diese Felsenwand, wie sie schon seit Jahrtausenden dagestanden hat, überall, wo überhaupt nur etwas wachsen kann, mit grünem Gras und Moos bewachsen, und nur dort kahl und finster, wo von den vorspringenden Steinrücken der jahraus jahrein wehende Passatwind jedes Stückchen Erde, jedes Samenkorn wegfegt und sie in die geschützteren Schluchten schleudert, wo die Erdkrumen Ruhe, die Samenkörner Gedeihen finden. So kommt es, daß die Steinpfeiler sich besonders scharf aus dem Landschaftsbilde herausheben, weil ihre Rücken schwarz sind, die umliegenden Wände aber ein grünes Kleid haben. Oben auf den einzelnen Zacken der Felsenwand stehen Sträucher, auf dem Kamm einige Kokospalmen, welche sich scharf von dem blauen Himmelshintergrunde abheben und ihre großen Blätter in dem frischen Winde spielen lassen. Dieses an saftigen frischen Farben, sowie an schönen und kühnen Linien so reiche Bild wird noch anziehender durch den Contrast, welchen es mit seiner nächsten Umgebung zeigt. Denn während dieses Stück Land von der Sonne hell beschienen wird, der blaue Himmel sich über ihm wölbt, wird das dicht daneben liegende Land von Regenwolken vollkommen eingehüllt und der ganze Horizont ist mit festen Wolkenmassen, welche an verschiedenen Stellen wolkenbruchartige Regengüsse entsenden, umlagert.
Der Passat weht frisch, unser Schiff hat schnellen Lauf, das Land rückt rasch näher, es ist nicht mehr weit bis zu der Cap Venus genannten Südspitze der Insel, und der Ankerplatz liegt gleich auf der andern Seite des Caps, unsern Augen fast bis zu dem Augenblick des Ankerns verborgen. Von Menschen ist vorläufig noch nichts zu sehen, weil dieselben die Wetterseite der Inseln nicht bewohnen und Cap Venus die ganze Südseite von Fatu-hiva nach der Seite, von welcher wir kommen, abschließt, sonst auch kein Weg und Steg um dieses Cap herumführt, weil die Natur hier die Anlage eines Weges verbietet. Den Bewohnern bleibt daher auch die Ankunft eines von Osten kommenden Schiffes bis zum letzten Augenblick verborgen. Ich hätte dem Schiff vorher so viel Fahrt geben können, um von dem Cap an ohne Segel bis auf den Ankerplatz zu schießen; die Karten sind aber noch nicht ganz zuverlässig, auch ist es nicht gerathen, ohne Lootsen einen ganz fremden Platz anzulaufen, ohne ihn zuerst aus gewisser Entfernung zu besichtigen und sich zu orientiren. So ging ich nicht dicht unter das Land, sondern blieb weiter ab und versuchte mit kleinen Segeln den noch auf tiefem Wasser liegenden Ankerplatz zu erreichen. Ich lief damit Gefahr, nicht sofort zu Anker zu kommen, da man an der Leeseite solch hoher Inseln gewöhnlich unstete Winde trifft, doch blieb mir mit Rücksicht auf die Sicherheit des Schiffes keine Wahl. Das Cap wird umschifft, ein köstliches Thal öffnet sich vor unsern Blicken, dessen genauere Besichtigung mir aber noch nicht erlaubt ist, weil die Führung des Schiffes mich ganz in Anspruch nimmt. Langsam geht es dem Ankerplatz zu, die Segel sind schon weggenommen, da stößt der Wind von vorn und drängt uns wieder hinaus. Es ist gerade 12 Uhr mittags und keine Aussicht bleibt, unter Segel allein den Ankerplatz vor dem Abend zu erreichen. Ich lasse daher in einem Kessel Dampf machen, das Schiff wird unter den wieder gesetzten kleinen Segeln beigedreht und die Mannschaft zum Essen geschickt. Nun wird mir Gelegenheit, das Thal Omoa oder Bon Repos-Bai, wie die Franzosen es nennen, mit Muße zu betrachten.
Cap Venus mit Thal Omoa auf Fatu-hiva (Marquesas-Inseln).
Die das Cap Venus bildende Klippe fällt an dieser Seite ebenso steil ab wie an der andern, zeigt auch dieselben Umrisse, zieht sich aber halbkreisförmig zurück und bildet einen Kessel, welcher durch malerisch gruppirte Höhenzüge, schöne Thäler und überreiche Vegetation ausgefüllt, ein Bild abgibt, welches jeden packen muß. Besonders malerisch treten auf einem Höhenzuge einige Felsnadeln hervor, welche in ihrer Form so sehr den Pappeln ähneln, daß man sie für riesige Bäume dieser Art halten könnte, zumal das auf ihnen wachsende Gras und Moos ihnen auch das grüne Kleid gibt. Unten im Thal öffnet sich der Strand, einige Hütten leuchten aus dem überreichen Pflanzenwerk hervor, mit dem Fernrohr sind auch Eingeborene am Strande zu erkennen, sie können indeß das vor uns liegende Bild nicht beleben, weil unsere Entfernung von ihnen zu groß ist.
Während wir angesichts des Ankerplatzes liegen und darauf warten müssen, daß die Maschine Dampf bekommt, stößt ein Kanu vom Lande ab und kommt auf uns zu. In demselben befinden sich sechs Personen, welche alle hintereinander sitzen, weil das Fahrzeug so schmal ist, daß in der Breite nur ein Mensch Platz findet. Das Fahrzeug nähert sich schnell, die muskulösen Ruderer geben ihm durch das Arbeiten mit den kurzen Rudern, welche mit beiden Händen gefaßt senkrecht in das Wasser eingetaucht und dicht an dem Bootskörper entlang durch das Wasser gezogen werden, eine große Geschwindigkeit. Wie ein Seevogel schießt das zierliche elegante Fahrzeug über die hohen Wellen hinweg. Die vordere Hälfte liegt in der Luft, wenn es oben über den Wellenkamm klettert, kippt dann nach vorn herunter, und bergab schießt das gebrechliche Ding, um für kurze Zeit im Wellenthal zu verschwinden. Die Ruderer bücken sich mit kurzer schneller Bewegung weit nach vorn, die Ruder senken sich ins Wasser, die Männer heben sich wieder und das von den Rudern nach hinten geworfene Wasser spritzt hoch auf; der Vordertheil des Fahrzeugs ist in Wasserstaub eingehüllt, wenn er aus der Luft in das Wasser zurückfällt, sonst sieht man an dem Bug nur eine leicht gekräuselte, nach hinten verlaufende Linie, an welcher der Kenner sieht, daß das Fahrzeug sich außerordentlich schnell durch das Wasser bewegt und wol eine Geschwindigkeit von 1½ deutschen Meilen und mehr in der Stunde hat. Die in demselben befindlichen Personen sind anscheinend vier Europäer und zwei Eingeborene, denn vier sind bekleidet und zwei sind nackt.
Mit den Europäern hatte ich mich indeß getäuscht. Das Kanu kommt längsseit und wir sehen schon an den Gesichtszügen, daß alle Insassen Polynesier sind. Ein Mann steigt als erster aus und kommt an Bord, eine große kräftige Gestalt in dunkeln Hosen, darüber flatternd ein reines, mit braunen Blumen besprenkeltes weißes Hemd, ein schwarzer Filzhut auf dem Kopf und unten barfüßig. Er hat angenehme Gesichtszüge, sein Nasenschnitt erinnert an denjenigen der nordamerikanischen Indianer, sein langes Haar ist sehr voll und leicht gekräuselt, das Gesicht bartlos, die Hautfarbe braungelb und ziemlich hell, und vor allem ist der Mann sauber. Ein zweiter folgt, ist ähnlich gekleidet, hat kürzeres Kopfhaar, etwas Bart, einen schwermüthigen Zug im Gesicht, gebogene schmale Nase, spricht englisch und gibt sich als geborener Tonganer zu erkennen, welcher längere Zeit in San-Francisco gewesen ist und die deutsche Flagge kennt. Diesem haben wir wol den freundlichen Empfang zu verdanken, welcher uns später wurde. Er stellt den zuerst aufs Schiff Gekommenen als den Häuptling von Omoa vor. Der dritte ist ein kleiner, pfiffig aussehender Geselle, welcher sein Hemd schon in die Hosen eingesteckt trägt. Er ist Kajütsjunge auf einem amerikanischen Walfischfänger gewesen und spricht ebenfalls englisch. Der vierte, etwas reducirt in seiner Kleidung, schon älter an Jahren, mit intelligentem Gesicht, ist ein Sandwich-Insulaner und spricht auch englisch. Der fünfte und sechste sind prächtige nackte Kerle, nur mit dem Maro bekleidet, einem Kleidungsstück, welches auch von den japanischen Kulis getragen wird. Ein als Gürtel zusammengedrehtes Stück Zeug ist um die Hüften geschlungen und dient zur Befestigung eines zweiten Zeugstücks, das vom Nabel ausgehend, zwischen den Beinen durchgenommen und hinten an dem Gürtel wieder befestigt wird. Bei diesen Leuten, welche die richtigen Repräsentanten des hiesigen Menschenschlags sind und zwei ausgesucht schöne Exemplare zu sein scheinen, muß ich etwas länger verweilen.
Marquesas-Insulaner.
Die Haare sind seitlich gescheitelt und werden, mit Ausnahme zweier Zöpfe, welche von den Ohren aus herabhängen, lang und weit abstehend getragen. Der ganze Körper ist tätowirt und theilweise mit wirklich künstlerischen Mustern versehen, welche dem Menschen ein ganz eigenartiges Aussehen geben. Namentlich tritt dies grell bei dem Gesicht hervor, weil die Malerei hier ganz unsymmetrisch angeordnet ist. Scheinbar zwischen den Haaren herauskommend, bedeckt ein blaues Dreieck die eine Seite der Stirn; unter diesem Dreieck läuft ein blaues Band horizontal über die Augen, welches oberhalb der Augenbrauen beginnt und sich bis zum halben Nasenrücken erstreckt. Innerhalb dieses Bandes ist mit Ausnahme der gelblich-weißen Hornhaut des Auges kein heller Fleck zu finden, weil sogar die Augenlider mit großer Sorgfalt ganz blau gebeizt sind. Daß die aus solch blauer Umgebung keck und frisch hervorleuchtenden großen schwarzen Augensterne beim ersten Anschauen einen wilden Ausdruck zu haben scheinen, liegt auf der Hand; das erste Befremden schwindet aber, sobald man sich erst gewissermaßen eine geistige Brille aufgesetzt hat, um die eigentlichen Augen herauszufinden, und hat man sie gefunden, dann lacht einem ein gutmüthiger Schalk entgegen. Etwas oberhalb der Nasenspitze beginnt ein zweites Band, welches bis unter die Unterlippe reicht. Dieses ist jedoch nicht ganz blau, sondern hat willkürlich offen gelassene helle Flecken, welche kleinere Muster in sich tragen, wie denn auch das in der Mitte des Gesichts quer über die Nase laufende helle Band mit kleinen Mustern verschiedener Art ohne bestimmte Ordnung ausgefüllt ist. Die Malerei des Gesichts erhält ihren Abschluß am Kinn durch ein dem Stirndreieck diametral gegenüberliegendes kleines Dreieck. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Gesicht, welches durch seine natürliche hellbraune Farbe, durch frisch-rothe Lippen und schöne weiße Zähne noch bunter wird, das äußerste Befremden erregt, zumal wenn der Eigenthümer einer solch bunten Musterkarte dieselbe noch zum Lachen verzieht und seine Augen fröhlich hin- und herlaufen läßt. Das Auge des Beschauers findet in solchem Gesicht nirgends Ruhe, alles ist darin unregelmäßig und daher sowol scheinbar, wie auch in Wirklichkeit in fortwährender Bewegung. Während in einem natürlich gefärbten Gesicht Muskelbewegungen schon stärker sein müssen, um einen andern Ausdruck hervorbringen zu können, genügt hier die geringste Bewegung, um die Malerei zu verändern und das Gesicht zu einem andern werden zu lassen. Ueber die Tätowirung des übrigen Körpers ist nur zu sagen, daß sie mit großer Sorgfalt durchgeführt ist und manch schönes Muster enthält. Besonders bevorzugt sind dabei Arme und Hände, Unterschenkel und Füße; auf den Armen findet man in der Regel auch noch den eigenen Namen, sowie solche naher Freunde.
Das Kanu, in welchem die Leute gekommen sind, ist ein außerordentlich zierliches, leichtes Fahrzeug. Es ist aus zwei Stämmen des Brotfruchtbaumes zusammengesetzt; der eine Stamm gibt den Boden, der andere auseinandergeschnitten die Seitenwände. Da dieses lange, schmale und flache Fahrzeug nun aber gar keine Stabilität hat und daher auf See stets umschlagen würde, so haben diese Naturvölker sich eine sehr sinnreiche Sicherung angebracht. Auf ein Viertel der Länge von vorn und ein Viertel von hinten ist je ein leichter Baumstamm quer über dem Boot befestigt, welcher an der einen Seite etwa 1 m über das Boot hinausreicht, an der andern mit der Seitenwand des Fahrzeuges abschneidet. An den Enden der über das Boot hinausreichenden Arme sind (meistens senkrecht) nach unten Stäbe befestigt, welche ebenso lang wie das Boot hoch sind und an ihren untern Enden einen mit dem Boot nahezu parallel laufenden, nach vorn etwas divergirenden Balken von ungefähr zwei Drittel der Bootslänge tragen. Die Schwimmkraft dieses Balkens ist so groß, daß das Boot nach der Seite, welche den Schwimmer trägt, nicht umschlagen kann, andererseits ist das Gewicht des Schwimmers ausreichend, um das Umschlagen desselben nach der andern Seite zu verhindern, solange es nicht gar zu ungeschickt behandelt wird und die Befestigung des Hebelbalkens hält. Die Arbeit an dem Kanu ist roh, alle die schönen Zierathen, welche man häufig auf Bildern findet, fehlen hier, die Formen des 10 m langen und 1 m breiten Fahrzeuges sind aber sehr gefällig und das ganze Kanu sieht aus einiger Entfernung zierlich und elegant aus.
Boot mit Auslieger.
Bootsriemen.
Querschnitt des Bootes.
Nachdem wir uns gegenseitig begrüßt hatten, gingen die Eingeborenen zunächst durch das ganze Schiff, um sich dasselbe anzusehen, und bekamen dann, als sie auf das Deck zurückgekehrt waren, etwas zu essen. Eine große Schüssel voll Bohnen wurde auf eine auf dem Deck ausgebreitete Presenning gesetzt, Corned-beef und Brot dazu gethan, die Insulaner herbeigeholt und jedem von ihnen ein Löffel in die Hand gegeben, nachdem vorher einige Aufpasser bestellt waren, welche diese als diebisch bezeichneten Menschen stets unter Aufsicht halten sollten. Hätte ich bei dieser Gelegenheit schon, wie wenige Stunden später, gewußt, welch großen Werth die Leute auf äußere Formen legen, ich hätte ihnen zu dem Zweck einen abgeschlossenen Raum angewiesen, so aber stand ich noch unter dem Eindrucke der Reiseberichte und glaubte, diese Leute dementsprechend behandeln zu müssen. Sie gruppirten sich hockend um die Schüssel, ließen dem Häuptling ziemlich viel Platz, indem die andern dicht zusammenrückten, und schienen sich an dem Gericht recht zu erlaben. Ohne Gier, mit Würde und Anstand aßen sie die für zehn Mann berechnete Portion ziemlich schnell auf, ließen aber doch von jeder Speise etwas zurück, legten dann die Löffel, welche sie mit Geschick gebraucht hatten, ordentlich zusammen und verließen den Speiseplatz. Die vier bekleideten Honoratioren kamen auf die Commandobrücke, um sich zu bedanken; die beiden andern kletterten wieder in ihr Kanu.
Gegen 1½ Uhr hatte die Maschine Dampf, die Segel wurden festgemacht, und unter Annahme der Lootsendienste, welche die Eingeborenen anboten, ging es nach dem Ankerplatz, wo wir gegen 2 Uhr ankerten. Ich entschloß mich, sogleich an Land zu gehen, um den Ort zu besichtigen und namentlich zu versuchen, für meine Mannschaften einigen frischen Proviant zu erhalten. Vorher wollte ich dem Häuptling noch eine Freude machen und rief ihn in die Kajüte, um ihm ein wollenes Hemd zu schenken. Die drei andern kamen natürlich mit und ich mußte nun, ehe ich mein Geschenk los werden konnte, Zeuge einer sehr komischen und doch zu ernstem Nachdenken anregenden Scene sein.
In der Vorkajüte stehen an einer Wand auf Sockeln drei Statuetten nebeneinander, in der Mitte die Ariadne von Dannecker, in ein Drittel Lebensgröße, rechts die Venus Kallipygos, links die Mediceische Venus, beide in ein Viertel Lebensgröße. Die Blicke der Insulaner schweifen an den Wänden entlang, über die dort hängenden Bilder hinweg und bleiben dann beim Umwenden plötzlich an diesen Statuetten hängen. Mit offenem Mund und weit geöffneten Augen stehen die Leute stumm da, sehen mich einen Augenblick an, richten aber ihre Blicke wieder schnell auf die Bildwerke und stoßen, mit halberstickter Stimme nach Athem ringend, nur den Staunensruf „Ai! A-i!“ aus. Die einzige Frage, welche sie noch zu stellen wagen, ist die, ob das Thier, auf welchem die Ariadne sitzt, wirklich ein Bär sei. Von den Männern wilder oder halbcivilisirter Völkerschaften darf man ja nie äußere Zeichen des Staunens erwarten, weil es bei ihnen zum guten Ton gehört, gegen Fremdes Gleichgültigkeit zu heucheln; die Sinne dieser Männer mußten daher sehr gefesselt sein, wenn sie sich soweit vergaßen, wie sie es gethan haben. Ich war nun aber nicht sicher, ob das Erstaunen nur der künstlerischen Arbeit oder den schönen classischen Formen galt, wollte jedoch Gewißheit haben. Ich rufe die Leute daher in mein Arbeitszimmer, wo zwei colorirte Bilder hängen, welche zwei duftige leichtbekleidete Mädchengestalten mit bunten Bändern im Haar darstellen. Auf den Zehenspitzen folgen sie mir, das ganze Gesicht nur Staunen und Verwunderung. Ich fordere sie auf sich umzudrehen, und in stiller Andacht bleiben sie vor diesen zarten Mädchenblumen stehen, welche durch weiter nichts als durch ihre feinen Farben zur Geltung kommen. Kein Auge wenden sie von den Bildern, als ob sie dieselben sich für immer einprägen wollten, und ich muß sie schließlich hinausdrängen. Nur mit Widerstreben folgen sie, und ihre etwas verdüsterten Mienen hellen sich erst wieder auf, als sie in der Vorkajüte die Puppen wiederfinden und ich sie auffordere, dort solange Platz zu nehmen, bis ich meinen Anzug für den Landgang in Ordnung gebracht habe. Ich unterließ aber nicht, die Thüre zwischen uns offen zu halten, um diese angeblich diebischen Menschen beobachten zu können, obgleich die offenen, ehrlichen Gesichter eigentlich jeden Verdacht beseitigen müssen. Die Statuetten haben es den Naturkindern aber so sehr angethan, daß sie heute keine Zeit zum Stehlen finden, wenn sie auch sonst Neigung dazu verspüren sollten — nur diese ziehen magnetisch ihren Blick an, alles andere ist für sie nicht vorhanden.
Als ich fertig war, rüttelte ich meine Gäste auf, gab dem Häuptling das ihm zugedachte Hemd, welches er kurzer Hand über sein anderes zog, und nun ging es in mein Boot, nachdem die Eingeborenen jede Vergütung für die dem Schiffe geleisteten Lootsendienste entschieden abgelehnt hatten. Einige Offiziere schlossen sich dem Landgange noch an und wir mußten eilen, wenn wir noch etwas am Lande sehen wollten, weil der Weg zum Dorfe weit war und bei Dunkelheit unpassirbar sein soll, wir aber jedenfalls vor Abend wieder auf dem Schiff sein mußten, wollten wir nicht mit einem sehr unbequemen Nachtlager vorlieb nehmen. Das Landen mit schweren Schiffsbooten ist hier stets sehr beschwerlich, weil man nur an einer Klippe landen kann und hier die See immer hoch geht. Die leichten Kanus laufen einfach auf den beim Dorfe liegenden Sandstrand, lassen sich von den hoch auflaufenden Wellen wie eine Blase auf den Sand werfen und werden dann schnell ganz aufs Trockene gezogen; die Leute sind dabei aber auch gewöhnlich ganz im Wasser, weil die Brandung so stark ist, daß das Fahrzeug, ehe es das Land erreicht, durch den Gischt der Brandung hindurch muß. Mit den Schiffsbooten kann man eine solche Landung nicht wagen und für diese liegt die Landungsstelle weitab vom Dorfe an den Felsen, wo an der am weitest vorspringenden Stelle ein platter Stein aus dem Wasser hervorragt. Die See bricht merkwürdigerweise nur sehr selten über diesen Stein weg, sondern zertheilt sich vor demselben und läuft an beiden Seiten vorbei. Diese Eigenthümlichkeit gestattet den Booten so dicht heranzugehen, daß man vom Boot aus auf den Stein springen kann, doch ist auch hierbei Vorsicht nöthig, weil das Auf- und Niederwogen des Wassers immerhin so stark ist, daß das Boot, wenn es durch eine ungeschickte Bewegung an den Felsen geworfen wird, auch an ihm zerschellt. Ohne die Hülfe der Eingeborenen hätten wir an diesem Tage, weil der Seegang infolge des starken Windes der letzten Tage sehr hoch war, überhaupt nicht landen und auch kaum den Weg nach dem Dorfe machen können, denn wahrscheinlich wären wir sehr bald durch die Brandung von den Felsen heruntergerissen worden. Die Leute waren wirklich rührend sorgsam mit uns und führten und leiteten uns, wie die Mutter ihr Kind, wobei man es ihren Gesichtern ordentlich ansah, wie besorgt sie waren, daß wir nicht zu Schaden kämen.
An der Landungsstelle angekommen, sahen wir wol, daß mit einem geschickten Sprung ans Land zu kommen ist, wir fanden aber auch, daß ein Fehlsprung sicher ins Wasser führt und daß man bei dem Sprung auf den glatten Stein auch nicht das Gleichgewicht verlieren darf, denn sonst schlägt man auf die scharfen Felsen und kann sicherlich auf eine erhebliche Verwundung rechnen. Unsere Freunde wissen das auch zu beurtheilen, denn als ich von dem bei solchen Gelegenheiten etwas zweifelhaften Vorrecht des Aeltesten, als erster den Vortritt zu nehmen, Gebrauch machen will, werde ich festgehalten und neben mir springt der Sandwich-Insulaner zwar nicht auf den Stein, aber mit seinem einzigen Anzug auf dem Körper in das Wasser und schwimmt wassertretend wie ein Frosch vor dem Felsen. Ich verstand nicht, was der Mann beabsichtigte, der Stein hat vollkommen senkrechte glatte Wände und das Niveau des Wassers liegt etwa 1½ m unter der Plattform des Steins, sodaß ein Erreichen des Steins vom Wasser aus unmöglich erscheint. Der Mann kennt die Situation aber besser. Nach kurzer Frist steigt das Wasser plötzlich 2-3 m, flutet über den Stein weg, fließt ab und unser Insulaner steht auf dem Stein, um uns nunmehr die Hand zu reichen. Nach und nach, je nachdem das Auflaufen der Wellen das Boot zum Abrudern zwingt oder ihm gestattet nahe heranzukommen, werden alle Personen glücklich gelandet und wir betreten einen Weg, wie man ihn nicht oft in seinem Leben geht. Da die Bergwände zu steil sind, um auf ihnen ohne gebahnten Pfad gehen zu können, die Eingeborenen in einem solchen Weg aber keinen Nutzen sehen, weil die vorhandenen ihnen genügen, so war für uns auch nur der eine Weg am Strande entlang über die Klippen vorhanden. Das Stück, welches wir auf diese Weise zurückzulegen hatten, betrug etwa 40 Minuten, weit genug, um ohne Zaudern loszumarschiren, wenn wir vor Eintritt der Dunkelheit zurück sein wollten.
Ein solcher Klippenweg hat die Eigenthümlichkeit, daß man nicht eben weggehen kann, sondern unausgesetzt die Richtung ändern muß. Einmal muß man sich nach links wenden, dann nach rechts, wie die vorspringenden Steinspitzen gerade am bequemsten liegen, oft muß man mehrere Fuß tief hinunterspringen und dabei gut darauf achten, den richtigen Stein zu treffen, dann muß man das wieder mühsam hinaufklettern, was man vorher hinuntergesprungen ist. Hat man nun hierbei nur auf den Weg zu achten, dann geht es noch, hier heißt es aber noch unausgesetzt die Brandung im Auge zu behalten. Dieses Zusammentreffen der ruhelos auflaufenden Brandung mit einem an sich schon beschwerlichen Wege macht diesen geradezu gefahrvoll, und hier erwiesen sich die Eingeborenen in so sorgsamer Weise nützlich. An diesen Weg gewohnt und mit ihren nackten Füßen sehr viel sicherer auf den Beinen, sind sie mehr befähigt, auf Weg und Brandung zugleich zu achten, und verstehen auch zu beurtheilen, wie weit das Wasser jedesmal steigt. So lassen sie uns zeitweise plötzlich halten, und dicht vor uns werden höher liegende Felsen als diejenigen, auf welchen wir stehen, von der hellen klaren See überspült; dann wieder lassen sie uns auf einen andern Stein springen oder gar in eine Vertiefung, und um uns herum steht alles in voller Brandung, während wir trocken bleiben, müssen dann aber schnell auf einen der eben erst bespülten Steine flüchten, weil das abfließende Wasser nun unsern letzten Zufluchtsort ausfüllt. So kommen wir endlich zu dem Dorfe, zwar ohne von dem Seewasser durchnäßt zu sein, trocken sind wir aber nicht, denn die Anstrengung des Weges hat allen Schweiß aus unserm Körper herausgepreßt, den er überhaupt abgeben konnte. Trotz des einsetzenden starken Regens benutzen wir unsere Regenschirme nicht, weil wir ja doch schon durch und durch naß sind. Das Anerbieten unserer Führer, uns durch einen ein Fuß tiefen Fluß zu tragen, lehnen wir auch ab, weil es für unsere brennenden Füße eine Wohlthat ist, dieselben in dem kühlern Wasser zu erfrischen. Von dem Dorf und seinen Bewohnern sehen wir zunächst nichts, weil ein wüthend brennender Durst erst nach irgendwelchem Getränk verlangt.
Der Häuptling führt uns zunächst in seine Wohnung, wo seine Frau uns empfängt. Um uns herum kribbelt und krabbelt es, mit der Gesellschaft in Ordnung kommen können wir aber erst, nachdem wir mit großer Gier die Milch einiger frischer Kokosnüsse getrunken haben. Endlich sind wir wieder Menschen und können nun Umschau halten. Wir sind in einem Holzhäuschen, welches aus einem Flur mit zwei daranstoßenden Zimmern besteht; die drei obersten von uns sitzen auf Stühlen, ein Holztisch ist vorhanden, an der Wand hängt ein Crucifix. Auf unsere Verwunderung über dieses behagliche Häuschen wird uns die Antwort, daß es das Haus des frühern Missionars ist und nach dessen Abgang mit sämmtlichem Inventar in den Besitz des Häuptlings übergegangen ist. Der Häuptling sitzt, nur mit Hosen bekleidet, auf einer Kiste, die beiden Hemden hat er also inzwischen schon ausgezogen; sein Oberkörper ist nur wenig tätowirt. Des Häuptlings Frau sitzt neben mir; sie ist von mittlerer Statur, hat eine schmale gebogene Nase, brennende Augen, bis zur Schulter reichendes schlichtes Haar und eine hellbraune Hautfarbe; ihr angenehmes und hübsches Gesicht hat einen schmerzlichen Zug. Ihre Kleidung besteht aus einem langen, bis zu den Knöcheln reichenden und mit Aermeln versehenen rothen Gewand, unter welchem sie noch ein gelbes, hemdartiges Kleidungsstück und darunter den Maro hat, welchen die Frauen ebenso wie die Männer, Mädchen und Kinder tragen. Ihre Beine und Arme sind tätowirt; Arm und Schulter zeigt sie uns auf Verlangen und würde uns wol auch ihr Bein gezeigt haben, wenn wir danach verlangt hätten. Als Begrüßung reicht sie uns die Hand, nickt graziös mit dem Kopf und verzieht das Gesicht zu einem angenehmen Lächeln; die ganze Begrüßung ist nach europäischem Geschmack so vornehm und fein, daß manche europäische Dame sich ein Beispiel daran nehmen könnte. Ich biete meiner freundlichen Nachbarin meinen ganzen Cigarrenvorrath an, welches Geschenk sie aber erst nach erfolgter Aufforderung ihres Mannes annimmt; sie zündet sich eine an und vertheilt die übrigen an die Anwesenden, welche nur aus Männern und Jungen bestehen, aber was für Männer und Jungen! Ein Maler würde in dieser Modellsammlung schwelgen. Die Erwachsenen sind durchweg kräftige, aber elegante schlanke Gestalten von über Mittelgröße, alle Glieder schön und ebenmäßig; die Gesichtszüge sind wegen der Tätowirung schwer zu erkennen, doch sieht man so viel, daß dieselben im Durchschnitt hübsch sind und Intelligenz verrathen, jedenfalls in der letztern Beziehung hoch über dem Ausdruck der Gesichter unserer niedern Volksklassen stehen, obgleich die Leute keine Schulzeit durchgemacht haben. Die Tätowirung des Körpers ist so stilvoll durchgeführt, daß man, wie früher schon erwähnt, die mangelnde Kleidung nicht vermißt; die Leute sind entschieden, so wie sie sind, anständig angezogen. Die Männer tragen auch noch Schmuck, entgegengesetzt unserer Sitte, während die Frauen sich hier nur mit Blumen zieren. Der Schmuck besteht aus Halsketten von bunten geschliffenen Glasperlen, nachgeahmten Korallen, auch zusammengereihten bunten Früchten, aus goldenen Ringen und Ohrringen, Blumen im Haar und in den an 1 cm großen Löchern der Ohrläppchen; als besonderer Schmuck wird auch noch ein Schlüssel angesehen, der um den Hals gehängt wird. Einige tragen Matrosenmesser; Waffen sind sonst nicht zu sehen, weil sie, wie schon erwähnt, einheimische Waffen nicht mehr besitzen. Die anwesenden Jungen im Alter von 6-14 Jahren sind wahre Prachtbengel, nur mit dem Maro bekleidet, daher ziemlich nackt, weil sie noch nicht tätowirt sind. Sie sind von heller braun-gelber Hautfarbe und haben offene, freundliche und hübsche Gesichter, in welchen sich schon ein gewisses Selbstbewußtsein ausspricht, denn sie dürfen mit den Männern zusammen sein, zu denen sie gehören und mit welchen sie schon alles theilen. Man sieht es diesen Jungen an, daß sie gut behandelt werden; unsere Dolmetscher bestätigen auch, daß die hiesigen Eingeborenen viel auf Kinder halten und sie gern haben. Ich stelle sie auf die Probe und frage, ob ich nicht einen Jungen kaufen oder eintauschen könne, erhalte aber nur eine freundliche, jedoch ganz bestimmte Abweisung. Da sich unter den Knaben auch einer mit hellerer Hautfarbe und blondem Haar befindet, welcher nach Angabe des Dolmetschers einen Weißen zum Vater hat, so frage ich, ob ich denn nicht diesen Bastard einhandeln könne. Die Antwort war, daß schon der Kapitän eines Walfischfängers sich alle erdenkliche Mühe gegeben habe, dieses Kind zu erhalten, der Adoptivvater (augenblicklicher Mann der Mutter) wolle es aber nicht hergeben und halte mehr von ihm wie von seinen eigenen Kindern.
Im allgemeinen fällt mir der nette, liebenswürdige Verkehr unter diesen Eingeborenen auf. Man sieht nur freundliche Gesichter; eine freundlich gestellte Bitte von einem Erwachsenen an einen andern, von einem Erwachsenen an einen Jungen, oder umgekehrt, wird sofort ohne Zaudern mit freundlichem Gesicht gewährt. So stehen und hocken die Männer und die Jungen an den Wänden, verhalten sich anständig und im ganzen ruhig, weil wir ja ihr Interesse vornehmlich erwecken.
Während wir hier im Hause des Häuptlings sitzen, werden Geschenke für mich herbeigebracht. Der Häuptling und der Tonganer schenken mir jeder einen Strauch Bananen; von dem kleinen Pfiffigen erhalte ich zwei Hühner, fünf Eier und einige Apfelsinen. Auf meine Frage, welches Gegengeschenk ich zu geben habe, wird mir die Antwort, daß sie kein solches erwarten; wolle ich ihnen aber etwas schenken, dann würde alles, was ich nicht mehr gebrauchen könne, dankbar angenommen. Ich schenkte später den Leuten ein Messer, eine Flasche Rum, einen Sack Hartbrot, Cigarren, Streichhölzer und noch einige Kleinigkeiten.
In dem Hause war es mittlerweile unerträglich warm geworden, und da wir auch noch etwas sehen wollen, entschließen wir uns zum Aufbruch und werden nun, infolge des anhaltenden Regens, vorläufig in ein anderes Haus, eine unverfälschte ortsübliche Hütte geführt, wo wir auch Damengesellschaft finden. Die Hütten sind alle gleich, und so genügt es eine zu beschreiben.
Auf eingegrabenen Pfählen ruht ein Dach, dessen Sparren aus Bambusstäben bestehen und dessen Decke durch eine aus Palmblättern geflochtene Matte gebildet wird, welche ziemlich regendicht ist und 5-6 Jahre vorhalten soll. Mit ebensolchen Matten sind die Längswände der Hütte geschlossen, die Schmalseiten sind offen. Die Hütte ist ungefähr 10 m lang, 3 m breit und in der Mittellinie 4 m hoch. Der Fußboden der Hütte liegt etwas mehr als 1 m über dem ihn umgebenden Erdboden und wird in der Weise hergestellt, daß der innerhalb der Pfähle liegende Raum bis zu der genannten Höhe mit großen glatten Steinen ausgefüllt wird, sodaß das etwa durch das Dach sickernde Wasser zwischen den Steinen ablaufen kann; auch wird das Ungeziefer, wie Ameisen u. s. w., wol die glatten Steine meiden. In solcher Hütte sitzt man luftig, kann aber die andachtvolle Ruhe und die herrliche Scenerie nicht genießen, denn der Schöpfer hat dafür gesorgt, daß diese Menschen, welche sonst in paradiesischer Trägheit ihr Leben verbringen, auch Bewegung finden. Denn wie bei uns die Thiere im Walde und auf der Weide durch allerlei Geschmeiß zu fortwährender Bewegung getrieben werden, so peinigen hier ungezählte Massen von Fliegen die Menschen. Sie sind eine wahre Landplage, und alles Fächeln unserer braunen Freunde hält sie von ihren eigensinnig wiederholten Angriffen nicht ab. So begrüßen wir es als eine wahrhafte Erlösung, als es endlich aufhört zu regnen. Das Anerbieten des Tonganers, mich auf die nächste Höhe zu führen, um von dort aus einen Ueberblick über das ganze landschaftliche Bild zu erhalten, mußte ich der vorgerückten Zeit wegen ablehnen und wir gehen statt dessen an den Strand zu den dort liegenden Hütten und der dort in größerer Zahl versammelten Damenwelt. Wir werden überall freundlich empfangen, die Verständigung erfolgt durch Zeichen und Lachen, und die so geführte Unterhaltung hält sich in den Grenzen feinen Anstandes; die berichtete Schamlosigkeit und Gemeinheit können wir hier nicht entdecken.
Der Anzug der Frauen besteht theilweise, und wol nur bei den Wohlhabenderen, aus dem bei der Häuptlingsfrau schon beschriebenen langen Hemde, in der Regel aber nur aus einem Stück Zeug aus Baumwolle oder selbstfabricirtem Stoff, welcher aus der Rinde des Maulbeerbaumes gefertigt wird. Der Anzug wird mit diesem in der Weise hergestellt, daß das Zeug unter den Armen um den Leib geschlungen wird und dann bis zur Erde reicht, beim Sitzen aber bis zu den Hüften heruntergleitet.
Ich unterscheide unter den hier versammelten Frauen vier verschiedene Typen, welche wahrscheinlich durch wiederholte Kreuzung entstanden sind. Die große Mehrzahl hat stark krauses schwarzes Haar, welches bis zur Schulter reicht und nach allen Seiten ungefähr 15 cm weit absteht, große schwarze brennende Augen, breite aber wohlgeformte Nase, großen Mund und hellbraune Hautfarbe. Eine zweite Klasse hat dasselbe Haar, jedoch mit röthlichen Strähnen durchzogen, kleinere Augen und Nase und ist kleiner an Körper. Die dritte Klasse hat schlichtes schwarzes Haar, welches auch nur bis zur Schulter reicht und wol der Mode halber abgeschnitten ist, eine schmale schöne Nase, stimmt jedoch sonst mit der ersten Klasse überein. Die vierte Klasse hat nur einige wenige Vertreterinnen; sie haben schlichtes schwarzes Haar, große schwarze sinnende Augen, feine leicht gebogene Nase, kleinen Mund und eine ganz hellgelbe Hautfarbe. Bis auf die zweite Klasse sind alle über Mittelgröße, einige sind sehr groß. Die Körperformen sind bei allen ebenmäßig und schön; alle sind gut gewachsen und haben volles üppiges Fleisch. Die der Insel ursprünglich angehörige Rasse glaube ich in der ersten Klasse zu finden, wogegen die vierte Klasse, welche man für Südeuropäer halten kann, wahrscheinlich viel weißes Blut hat. Ehe ich zu beweisen suche, weshalb man bei den Männern nicht so scharf ausgeprägte Typen unterscheiden kann, muß ich noch einer Frau der vierten Klasse Erwähnung thun. Auf dem hochgelegenen Fußboden eines Hauses saß halb mit dem rechten Bein, das linke auf dem Erdboden, an dem äußern Rand eine lichte Gestalt in unnachahmlicher Grazie, den rechten gekrümmten Arm gegen einen Pfahl lehnend, den schön tätowirten linken Arm mit der Hand im Schoß, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Der obere Theil ihres Gewandes ruhte auf den Hüften. Sie war eine vollendete Schönheit und sollte, soweit die Eingeborenen rechnen können, 35 Jahre alt sein. Ich konnte dem von ihr ausgehenden Zauber nicht widerstehen und trat mit dem Dolmetscher näher heran, zumal ich auch nicht glauben konnte, daß dieses zarte feine Gesicht und der jugendlich üppige Körper in diesem Klima schon 35 Sommer gesehen haben sollen. Trotz ihrer freundlichen Begrüßung lag im Auge der Frau so viel Abweisendes, als ob sie sagen wollte: „Rühre mich ja nicht an!“ Ich ließ ihr durch den Dolmetscher sagen, daß ich mir gern ihren tätowirten Arm ansehen möchte, worauf sie mir mit zufriedener Miene ihre kleine, schön geformte Hand reichte, damit ich mir das Muster, welches ich weiter unten beschreiben werde, genau ansehen konnte.
Daß man in dem Aussehen der Männer so wenig Verschiedenheit findet, liegt wol hauptsächlich in der Tätowirung. Die früher genannten vier Insulaner in europäischer Kleidung, welche sämmtlich nicht im Gesicht tätowirt sind, haben dagegen ganz verschiedene Gesichtszüge, doch gehören nur zwei von ihnen dieser Insel an, und von diesen ist der Häuptling groß mit breiter gebogener Nase, der Pfiffige klein mit langer schmaler Nase. Dies beweist aber auch noch nichts, weil auf den Südsee-Inseln die Häuptlinge immer größer an Gestalt sind und andere Gesichtszüge haben, als ob sie einer andern Rasse angehörten. Als besonders auffällig erschien mir bei unserm kurzen Besuch, daß sowol die nackten tätowirten Männer als auch die Jungen unter sich alle gleich aussehen. Die Männer haben durchgehends krauses schwarzes Haar, dunkle Augen, theilweise gebogene, theilweise breite Nasen, und man muß sehr genau hinsehen, um aus diesen bunten Gesichtern überhaupt bestimmte Formen herausfinden zu können. Die Jungen haben schlichtes kurzes Haar, große Augen, großen Mund und ebenfalls theilweise gebogene, theilweise breite Nasen.
Noch einmal auf die Frauen zurückkommend muß ich erwähnen, daß sie das Haar in der Mitte gescheitelt tragen und anscheinend in guter Pflege halten, denn bei ihnen waren ebenso wenig wie bei den Männern Spuren von Ungeziefer zu entdecken. Die Frauen tätowiren sich in die Lippen senkrechte blaue Striche ein, welche so unmotivirt sind und mit keinerlei Gesichtszügen in Verbindung stehen, daß sie das Gesicht entschieden verunstalten. Während die frühern Reisebeschreibungen sagen, daß die Frauen nur auf den Lippen tätowirt sind, haben wir diese Sitte bei ihnen auch auf andere Körpertheile ausgedehnt gefunden. Wie ich schon erzählt habe, hat die Frau des Häuptlings Arme und Beine tätowirt, wir finden dasselbe hier am Strande noch bei mehrern andern Frauen. Die Tätowirung des Armes reicht in der Regel von den Mittelgelenken der Finger bis zu dem halben Unterarm, besteht aus sich kreuzenden feinen Linien, welche ziemlich dicht zusammenliegen, auf dem Rücken der Hand und vor dem Abschluß am Arm aber ein offenes spitzenähnliches breites Band bilden, sodaß es aussieht, als ob die betreffende Person fein gewirkte lange Filethandschuhe anhabe; bei der Häuptlingsfrau geht das Muster bis zur Schulter. Die Tätowirung des Beines erstreckt sich von den Zehen über den Fuß und das ganze Bein bis zu den Hüftgelenken, bei einzelnen jedoch nur bis etwas über das Knie, und hier konnte man wähnen, feine Filetstrümpfe nach französischem Modell vor sich zu haben. Als wir den Wunsch äußern, ein solches Bein zu sehen, zaudert das betreffende Mädchen erst, schlägt aber nach Aufforderung der umstehenden Männer sichtlich verschämt das Tuch so weit zurück, daß man das Bein sehen kann. Es hat schöne Formen, reiche und schöne Muster, die Haut ist zart und weich.
Tätowirungsmuster.
Linker Oberarm. Schienbein.
Das Tätowiren der Männer nimmt viele Jahre in Anspruch, denn es beginnt mit dem 14. Lebensjahr und wird so ziemlich bis zum Lebensende fortgesetzt. Eine solche Procedur auf einmal ohne Unterbrechung ausgeführt würde vielleicht ebenso den Tod nach sich ziehen, als wenn ein Mensch bis zu zwei Drittel seiner Hautfläche verbrüht wird. Die ersten Linien werden im Gesicht, an Händen und Füßen angelegt, und die Arbeit, welche nach meiner Schätzung mehr als 30 Jahre in Anspruch nimmt, wird mit dem vorschreitenden Alter weiter durchgeführt; wenigstens habe ich nur einen Mann gesehen, welcher in dieser Beziehung als fertig angenommen werden konnte, und dieser war etwa 50 Jahre alt.
Bei den Mädchen ist es wegen der geringern in Betracht kommenden Hautfläche angängig, die ganze Procedur auf einmal auszuführen und diese soll auch nach dem 14. Lebensjahr bei Gelegenheit von Festen in einem Act ausgeführt werden. Ob es für die Mädchen wirklich ein Fest? Ich habe es in meinen jungen Jahren auch gekostet, wie das Tätowiren thut, und kann nur sagen, daß ein ganz kleines Stück schon schmerzhaft genug ist.
Tätowirungsmuster.
Fuß. Seitenansicht des Fußes. Linke Brust.
Die Füße und Hände der Frauen sind klein und gut geformt. Die Ohrläppchen haben sehr große Löcher, dieselben sind aber nicht für Ohrringe bestimmt, sondern nehmen Blumen und kleine Sträuße auf. Das Gebiß ist, soweit ich sehen konnte, durchweg gesund, schneeweiß und wird sauber gehalten.
Mit zwei oder drei Ausnahmen habe ich keine kleinen Mädchen gesehen. Meine Frage, ob sie die Mädchen als überflüssig gleich nach der Geburt erwürgten, wurde mit Entrüstung verneint und behauptet, daß diese alle weiter oben in dem sich durch das ganze Thal erstreckenden Dorf seien, wo noch 400 Menschen wohnten. Leider konnte ich mich nicht lange genug auf dieser Insel aufhalten, um noch Zeit für einen Ausflug nach dem obern Dorf zu finden.
Allmählich wird es Zeit, an den Rückweg zu denken, und ich schaue mich nach meinen Sachen um, an die ich gar nicht mehr gedacht hatte. Zu meiner Ueberraschung sehe ich einen ganzen Trupp Männer und Jungen, welche mir dieselben nachtragen. Einer hat meinen Rock, welchen ich der Hitze wegen ausgezogen hatte, ein anderer meinen Schirm, wieder einer meine Bananen u. s. f. Wir nahmen nun Abschied von den Damen, ich ziehe meinen Rock an und entdecke zu meiner Verwunderung, daß kein Stück der in den Taschen vertheilten Kleinigkeiten fehlt, nicht einmal die Schachtel mit Zündhölzern, welche in der jetzigen Regenzeit fast der begehrteste Artikel ist. Die andern Sachen lasse ich den Trägern noch und wir begeben uns nun, nachdem wir der großen Branntweinflasche noch einen Besuch abgestattet hatten, zurück auf den bedenklichen Klippenweg, wo es uns diesmal nicht so gut gehen sollte wie auf dem Herweg, denn als ich an einer Stelle, welche mir durchaus sicher erschien, einen Augenblick stehen blieb, um mit dem mir nachfolgenden Offizier einige Worte zu wechseln, hörten wir beide den Warnungsruf unsers Führers zu spät, standen plötzlich bis unter die Arme im Wasser und lagen dann zwischen den Klippen; dasselbe passirte auch dem größten Theil der Offiziere, weil alle auf dem Rückweg zu unaufmerksam waren. Glücklicherweise nahm indeß keiner größern Schaden; einige Risse in den Hosen und in der Haut waren das ganze Opfer.
Ehe wir das Dorf verließen, fragte mich der kleine Pfiffige, ob ich denn vorher nicht noch eine Frau haben wolle? Als ich darauf die Gegenfrage stelle, ob dies denn angängig sei, sagte er, ich solle mir nur eine aussuchen, denn mit Ausnahme der Häuptlingsfrau ständen alle Frauen und Mädchen des Dorfes zu meiner Verfügung. Um den Mann nicht zu verletzen und die Sache doch kurz abzubrechen, gab ich ihm zur Antwort, daß es dafür heute schon zu spät sei, weil ich auf das Schiff zurück müsse. „Gut“, sagte mein Freund, „ich werde dann zu morgen die Schönsten aussuchen.“ Diese kurze Unterhaltung brachte mich auf den Gedanken, mit den uns begleitenden Männern einige Frauen mit an Bord zu nehmen, damit sie sich das Schiff ansehen und etwas Musik hören könnten. Kaum ausgesprochen — und mein Führer ist schon auf dem Wege, die Einladung weiter zu befördern. Wir gingen weiter nach dem Boot, wo ich den eben wieder eintreffenden Eingeborenen frage, wie es denn mit den Frauen sei, da ich noch keine auf dem Wege sähe. Er sagt nun kleinlaut, daß sie nicht kommen wollten, da sie sich nicht auf ein so großes Schiff trauten. Als ich eine nähere Erklärung dieser mir unverständlichen Rede forderte, erzählte er, daß vor mehrern Jahren einmal alle Frauen auf einem französischen Kriegsschiff gewesen und dort so mishandelt worden seien, daß sie auf kein Kriegsschiff mehr gingen. Da es heute zu spät geworden war, in der Sache noch etwas zu thun, wiederholte ich meine Einladung für morgen mit dem Bemerken, daß alle Eingeborenen, Männer, Frauen, wie Kinder meine Gäste seien, und diese Einladung wurde mit Freuden angenommen.
Die Einschiffung in das Boot ging ohne weitere Beschwerden vor sich, weil es leichter war, von dem Stein in das tiefer liegende Boot zu springen, doch galt es auch hier gut aufzupassen und den Sprung dicht vor dem Moment zu machen, wo das von einer Welle gehobene Boot einen Augenblick ruhte. Gegen 6 Uhr abends waren wir wieder an Bord.
Den nächsten Vormittag benutzte ich dazu, in meiner Gig nach einer andern kleinen Bai, welche drei Seemeilen von uns entfernt lag, zu fahren, um mir den dortigen Ankerplatz anzusehen und das Dorf, in welchem sich seit kurzem ein deutscher Missionar angesiedelt haben soll, zu besuchen. Bei schönem Wetter erreichen wir bald diese Bai, Hanavava- oder Vierges-Bai genannt. Den Hintergrund derselben bildet ein schönes zerklüftetes Thal, welches, von hohen Bergwänden eingeschlossen, in üppigster Vegetation prangt; wunderlich geformte alleinstehende steile Felsen wachsen scheinbar aus dem dichten Laubdach heraus. Nach der See zu öffnet sich das Thal; schöner Sandstrand, welcher bequemes Landen erlaubt, verbindet Land und See; an den Strand schließen sich schroffe Felsmassen an, welche halbkreisförmig nach der See auslaufen und so nahe aneinander rücken, daß sie hier gewissermaßen ein Felsenthor für den von ihnen eingeschlossenen kleinen Hafen bilden. Das Auge ist entzückt von dem vor ihm liegenden Bilde, findet an Land gekommen aber nichts mehr. Die schönen Bilder, welche durch Berg, Thal und Laub, durch Fels und Meer gebildet werden, entschwinden; ein undurchdringliches grünes Laubdach verwehrt dem Auge jede Fernsicht und zwingt es, zwischen den Hütten der Eingeborenen zu bleiben, welche, ebenso wie ihre Bewohner, im Vergleich zu Omoa einen recht reducirten Eindruck machen; Hütten und Menschen können sich mit denen von Omoa nicht messen. Traurige Fußsteige, welche jetzt, bei dem herrschenden Regen, kaum zu benutzen sind, stellen die Verbindung in dem untern Theil des Dorfes her; weiter hinauf in das schöne Thal, auf die einladenden Berge ist wahrscheinlich gar nicht zu kommen.
In Hanavava angekommen begrüßte uns — ein Offizier hatte mich begleitet — der Missionar in französischer Sprache, welchen Gruß ich ebenso erwiderte, weil ich nicht an das Deutschthum dieses Mannes glaubte. Als mein Kamerad aber den Gruß deutsch erwiderte, war das Erstaunen des Missionars groß; mein Erstaunen aber noch größer darüber, daß der deutsche Priester, welcher schon sechs Jahre in überseeischen Ländern gelebt hat, die deutsche Flagge noch nicht kannte. Der Pater war ein geborener Westphale, etwa 30 Jahre alt und der einzige Weiße auf der ganzen Insel. Der Einladung, in sein Haus einzutreten, leisten wir Folge, finden dort ein übermäßig bescheidenes Wohngelaß, in welchem geniale Junggesellenunordnung herrscht. Nur ein Stuhl ist vorhanden, die Schubladen des Tisches beherbergen in trauter Gemeinschaft die verschiedenartigsten Dinge; die wenigen Bücher scheinen hier noch nicht benutzt worden zu sein, einzelne Koffer stehen noch unausgepackt mitten in der Stube. Man sieht an allem, daß der Mann nicht weiß, was er soll und was er will; er ist in eine fremde Welt versetzt, in welcher er nicht zurechtkommt, wahrscheinlich nicht einmal etwas Ordentliches zu essen findet, weil er selbst nicht kochen kann und die Eingeborenen sich von ihm fernhalten. Da er nach dem Inhalt seiner Schubladen nur von Hartbrot zu leben scheint, sein Taback auch verdorben aussieht, so bieten wir ihm das als Theil unsers Frühstücks mitgebrachte frisch gebackene Brot, einige Cigarren und etwas Taback an, damit er doch einmal eine, wenn auch sehr bescheidene Abwechselung habe. Dieses in entsprechender Form gemachte Anerbieten wird auch in freimüthiger, verständiger Weise aufgefaßt und angenommen und durch frische Kokosmilch erwidert.
Der Pater gehört, soweit wir haben herausbekommen können, zu der französischen katholischen Missionsgesellschaft, welche ihren Hauptsitz in Papeete auf Tahiti hat. Die französischen Geistlichen bleiben, wie ich namentlich von anderer Seite gehört und auch selbst beobachtet habe, in Papeete und Port Anna-Maria in bequemen Wohnungen und durchaus civilisirten Verhältnissen, während die ziemlich zahlreich vorhandenen und noch immer nicht klug gewordenen Deutschen auf die verlorenen Posten geschickt werden. Der Pater in Papeete ist der vornehme feine Mann in eleganter Kleidung, der Pater hier ein Tagelöhner im Arbeitskittel. Märtyrerthum ist hier nicht mehr zu holen; kein Eingeborener krümmt irgendeinem weißen Manne mehr ein Haar; aber schlechte Nahrung, weil die Patres von ihren in Papeete im Wohlleben schwelgenden Amtsbrüdern vollständig vergessen werden, schlechte Betten, Mangel einer jeden Geselligkeit und das niederdrückende Gefühl, nichts leisten zu können, sondern eine Null im Weltall zu sein, sind im Ueberfluß vorhanden. Denn ebenso wie die französischen Geistlichen auf Tahiti und Nuka-hiva nichts thun, dafür aber gut leben, thun die deutschen auf den andern Inseln auch nichts, weil die Eingeborenen sich dem Einfluß der Missionare durchaus entziehen, leben aber recht schlecht. Früher war auf dieser Insel ein englischer Missionar, welcher, da er keinen Einfluß auf die Eingeborenen ausüben konnte, seine Missionsarbeit aufgab und sich mit Erfolg auf die Cultur der Baumwolle legte, bis er auch dessen überdrüssig wurde. Er verkaufte sein Besitzthum an die französische Missionsgesellschaft und fuhr nach Hause; jetzt seit sechs Monaten sitzt unser Westphale hier, versucht Unterricht zu geben und sammelt für die Herren in Papeete die Baumwolle ein, weil er keine Eingeborenen dazu bekommen kann. Mit den Erwachsenen hat er allen Verkehr aufgegeben, weil mit diesen doch nichts mehr anzufangen ist, und bei den Kindern, mit welchen er sich noch beschäftigt, hat er auch wenig Hoffnung, weil die Eingeborenen den Nutzen von Lesen und Schreiben durchaus nicht einsehen wollen, im übrigen sich jedem Zwang bis zum äußersten entgegenbäumen. Der Pater will eine Abtheilung Soldaten haben, um gewissermaßen mit dem französischen Bajonette zu taufen, anders sieht er keinen Erfolg. Solch ein Missionar sieht in der Phantasie in Europa ganz anders aus, als hier an Ort und Stelle in der Wirklichkeit. Alle die überspannten, dem Menschenwohl gewidmeten Ideen, welche den Mann in die Fremde getrieben haben, gehen sehr schnell verloren; er findet das alltägliche Leben in der trübsten Gestalt, ohne helfen zu können, und hat dafür einen dankbaren Wirkungskreis aufgegeben. Er sieht, daß sein Wort, seine Begeisterung an der Indolenz dieser Leute wirkungslos abprallen, findet nirgends Befriedigung, wird mismuthig und geht geistiger Umnachtung entgegen, wenn er nicht Lust an der Landwirthschaft findet. Nur einmal noch kommt er wieder zum Aufleben, wenn es ihm gelingt, sich hier loszureißen und nach Hause zurückzukehren. Dort wird er dann als ein Märtyrer betrachtet, welcher die größten Gefahren überstanden hat, und wenn der ehrliche Mann die Verblendeten aufzuklären sucht, wird ihm dies als Bescheidenheit ausgelegt und ihm nicht geglaubt.
Als wir in das Haus des Missionars eintreten, folgen uns, wie das ja auch nicht anders sein kann, so viele Eingeborene — aber wieder nur Männer und Jungen — wie nur überhaupt in den Flur des kleinen Hauses hineingehen, ohne indeß das Zimmer, in welchem wir sitzen, zu betreten. Im Laufe der Unterhaltung lenkt der Pater unsere Aufmerksamkeit nach der Thür des Zimmers, in welcher ein alter Herr in europäischer Kleidung steht, den der Pater uns als den Häuptling des Ortes vorstellt und welchem wir die Hand schütteln. Er ist jedenfalls erst so spät gekommen, weil seine Toilette ihn so lange in Anspruch genommen hat, dafür ist dieselbe aber auch so wohl gelungen, daß ich sie näher zeichnen muß. Wo aber anfangen, beim Hut oder bei den bloßen Füßen? Ich werde den Hut wählen. Unter einem alten und altmodischen, anscheinend öfters eingetriebenen schwarzen Cylinderhut steckt ein altes, runzeliges, von einem kurzgeschnittenen weißen Bart eingerahmtes Gesicht voll blauer Malerei. An den Kopf schließt sich ein fest zugeknöpfter, langer, blauer Marine-Offiziersrock an, welcher jedenfalls direct auf die bloße Haut übergezogen ist, weil bei dem Vorhandensein eines Hemdes der Schluß nicht so hermetisch zu sein brauchte. Der Rock ist alt, sehr alt, vielleicht so alt wie sein jetziger Besitzer, obgleich dieser ihn noch nicht sehr lange hat. Als besondere Zierde hat dieses Galakleidungsstück vier Reihen Knöpfe erhalten, zwei Reihen Civilknöpfe und zwei Reihen englische Marineknöpfe, alle vier Reihen sind indeß stark gelichtet, kaum die Hälfte der Knöpfe ist noch vorhanden, man sieht aber wenigstens noch wo die fehlenden einst gesessen haben. Aus den Rockärmeln sehen zwei große Hände hervor, welche in gewirkten weißbaumwollenen Handschuhen stecken; die Handschuhe sind nicht sehr rein, vielleicht aus Furcht, daß ein zu häufiges Waschen ihnen schaden würde. Unter dem Rock kommen die in schmutzigen weißen Hosen steckenden Beine hervor, die Füße sind bloß. So steht der Gebieter über dieses schöne Thal in der Thür vor uns, den Hut auf dem Kopf, die Hände in fortwährender Bewegung, weil er nicht weiß, wo er mit ihnen bleiben soll, und mit einem Gesichtsausdruck, welcher nichts anderes bedeuten kann als den Zuruf an uns: „Seht hier einen, welcher euch stolzen Europäern ebenbürtig ist, welcher weiß, was sich schickt, und zeigen kann, was er besitzt!“ Der arme Mann, welcher nackt in seinem bemalten Körper jedenfalls ein ehrwürdiger Greis ist, gibt so das Bild eines europäischen Bettlers, eine Jammergestalt; doch er ist glücklich, er wähnt sich würdevoll und uns gleichstehend, weil nach seiner Ansicht wol auch die Kleider oder überhaupt Kleider die Leute machen. Der Pater erzählt uns, daß dieser Häuptling auch der Oberpriester des Thales und somit sein größter Widersacher sei, daß er aber im allgemeinen gut mit ihm stehe.
Die für den Besuch dieses Thales bemessene Frist ging ihrem Ende entgegen; es wurde daher Zeit aufzubrechen, wenn wir noch etwas sehen wollten. Die Wege sind zwar schlecht, weil der schon monatelang währende Regen den fetten Lehmboden in einen wahren Schlammpfuhl umgewandelt hat, allein dies kann uns doch nicht abhalten. Als wir aus dem Hause treten, finden wir den ganzen Weg mit Menschengruppen besetzt, welche uns sehen wollen und uns dadurch die beste Gelegenheit geben, sie zu sehen. Wir finden hier ziemlich denselben Menschenschlag wie in Omoa, nur sind die Leute weniger schön. Unser Weg hält sich anfangs unter dicht belaubten Bäumen, meist Brotfruchtbäumen; bald wird es lichter und wir kommen an eine etwas verwilderte, mit Unkraut durchsetzte Baumwollpflanzung, welche der Missionsgesellschaft gehört. Es fehlen aber die Arbeitskräfte, weil der Eingeborene nicht arbeitet und sich nur gegen Zahlung von Kleidungsstücken zuweilen bewegen läßt, die reife Baumwolle zu pflücken.
Die ganze Landschaft um uns herum prangt im saftigsten Grün, über uns wölbt sich das tiefblaue Himmelszelt, da es ausnahmsweise nicht regnet. Von jedem Blatt, jedem Halm strahlen die Regentropfen wie die schönsten Diamanten, auf den duftigen hellgelben großen Blüten mit dunkelm rothbraunen tiefen Kelch der in voller Blüte stehenden Baumwolle wiegen sich in graziösen lautlosen Schwingungen schöne dunkelgefärbte Schmetterlinge. Die feierliche Ruhe, der stille Friede, welche auf diesem anziehenden Bilde ruhen, stimmen zur Andacht. Wir bleiben unwillkürlich stehen, um mit den Augen, mit allen Sinnen das ganze Bild in seiner großartigen Schönheit zu erfassen. Hohe, wunderlich geformte und selten schöne Felsen umgeben uns; sie erheben sich von der Thalsohle wie künstliche Bauwerke, weil sie mit den das Thal begrenzenden Bergwänden nicht zusammenhängen und ihre Oberfläche auch auffallend von derjenigen der andern Berge abweicht. Denn während diese dicht bewachsen sind, zeigen jene malerische Figuren in allen Nüancen der dem Auge so wohlthuenden grünen Farbe und in so reichen und verschiedenartigen Mustern, daß man Gebilde von Künstlerhand vor sich zu sehen wähnt. Zwischen diesen herrlichen Naturwerken hindurch verfolgt das Auge den Lauf des fruchtbaren Thales, wie es zwischen hohen Bergen eingeengt sich allmählich zur Höhe hinaufzieht, um urplötzlich und doch wieder unmerklich in einer steilen Bergwand sein Ende zu finden. Das Auge kehrt zurück. Dort liegen unter hohen Bäumen, theilweise in dichtem Laub versteckt die Hütten, dazwischen heben sich von dem weichen grünen Hintergrund effektvoll die regungslosen Gruppen der Eingeborenen ab, die Frauen größtentheils in grellbunten Gewändern auf der Erde hockend, die nackten bunten Körper der Männer leicht und in gefälliger Stellung an Baumstämme gelehnt. Dazwischendurch sieht man an einzelnen Stellen auch den Strand mit den auf ihm stehenden Kanus hindurchschimmern und dahinter das in ewiger Bewegung befindliche Meer, auf dessen Wellen man auch meine Gig sich wiegen sieht. Die Bewegungen dieses Bootes sind aber so sanft, die Musik der bis hierher vernehmbaren rauschenden Brandung ist so weich und stimmungsvoll, daß dieses sichtbare und hörbare Leben keine Dissonanzen in die Naturandacht, in dieses Bild paradiesischen Friedens zu bringen vermag. Die köstliche Ruhe, welche auf dieser wahrhaft schönen und seltenen Scenerie liegt, der herrliche Blumen- und Blütenduft, das Rauschen der sanft auflaufenden Brandung, die Gruppen der trägen Menschen, welche leblos erscheinen, das Fehlen aller Vogelstimmen und überhaupt aller Laute, welche die Sinne beschäftigen können, geben zusammen ein Ganzes, welches einen von einer langen Reise und dazu noch von einem geräuschvollen Kriegsschiff kommenden Seemann vollständig gefangen nehmen muß. Doch für diesen gibt es nirgends ein Bleiben, und so müssen auch wir heute nach kurzer Rast wieder weiter. Schade nur, daß ich nicht die Kraft besitze, dieses herrliche ergreifende Bild auf der geduldigen Leinwand in wahrheitsgetreuer Wiedergabe mit nach Europa zu bringen, wo es gewiß allgemeines Aufsehen erregen würde.
Wir gehen weiter nach dem heidnischen Opfer- und Tempelplatz, wo vor sechs Jahren der letzte Mensch geopfert, gebraten und verzehrt wurde, und wo der Häuptlingpriester noch jetzt zeitweise seinen harmlos gewordenen Hokuspokus treibt. Der Platz ist viereckig und von einer niedrigen Steinmauer umgeben, der Fußboden ist ebenso wie in den Hütten mit großen Steinen belegt. Zwei große Bäume, von denen einer an dem einen Ende, der andere am andern Ende innerhalb des Platzes steht, beschatten diesen vollkommen, und in der Mitte zwischen ihnen sind die Steine zu einer Feuerstelle hoch aufgeschichtet. Ein ausgehöhltes Stück Baumstamm, welches nach Angabe des Paters die Festtrommel ist, liegt an der Erde. Die Benutzung dieses Platzes bei der Vornahme von Menschenopfern geschah in der Weise, daß die Männer sich um den einen Baum gruppirten und das Opfer an dem andern Baum aufgehängt wurde. Im weitern Verlauf wurden dann von dem Opfer einzelne Stücke abgeschnitten, in dem in der Mitte befindlichen Feuer gebraten, gegessen und dies so lange fortgesetzt, bis das Opfer in dem Magen der Menge lag. Die Weiber durften den Opferplatz nicht betreten, es war ihnen aber erlaubt, außerhalb der Mauer stehend zuzusehen, wohin ihnen auch einige Stücke des heidnischen Mahles gereicht wurden.
Wir besehen uns noch die ganz in der Nähe liegende Hütte des Häuptlings, welche genau den andern gleicht und als einziges Ausstattungsstück die große Alarmmuschel des Häuptlings in sich birgt. Durch ein in die Spitze eingebohrtes Loch wird es möglich, einen hellen durchdringenden Ton auf der Muschel zu erzeugen.
Wir hatten nun alles gesehen und kehrten zu meinem Boot zurück. Auf dem Wege wurde mir von einer alten Frau noch ein altes, auf ein Stück Knochen geschnitztes Idol zum Kauf angeboten. Gegen Mittag sind wir wieder an Bord und finden auf dem Schiffe bereits reges Leben. Wie es scheint, ist die ganze männliche Bevölkerung von Omoa zum Theil auf dem Schiff, zum Theil in den vielen Kanus neben demselben. Das ganze Schiff ist von Kanus umschwärmt, deren Insassen lachen und schwatzen und durch geschickte Wendungen den spaßhaft gemeinten Angriffen anderer Kanus ausweichen; alles ist in fortwährender, freudetrunkener Bewegung. Auf dem Deck des Schiffes, in der Takelage, in den untern Räumen sieht man eingeborene bunte Männer und Jungen, welche eine Verständigung mit unsern Leuten versuchen; viele haben Früchte, Hühner, Eier und Muscheln, für welche sie alte Kleider einzuhandeln suchen. Während ich auf der Commandobrücke stehe, um mir von erhöhtem Standpunkt aus dieses buntbewegte Treiben anzusehen, klettert dicht bei mir an der Schiffswand ein älterer Mann herauf, klammert sich an der Takelage an, nickt mir einen freundlichen Gruß zu und nimmt dann zwei ihm aus seinem Kanu gereichte kleine Beutel in Empfang, welche er, mich lachend ansehend, zärtlich streichelt und dann im Schiffe verschwindet. Wie ich nachher hörte, hatte der Mann in diesen Beuteln 100 Dollars, für welche er sich auf dem Schiff alte Kleidungsstücke kaufen wollte. All die andern Sachen, welche die Leute mitgebracht hatten, wurden auch nicht gegen Geld verkauft, sondern gegen alte Kleider ausgehandelt. So kam es, daß am Abend, als die Leute wieder an Land geschickt wurden, Omoa eine ganz andere Physiognomie erhielt, weil kaum noch ein ganz nackter Mann zu sehen war, denn wenn auch nur wenige einen vollständigen Anzug erlangt hatten, so hatte doch jeder irgendein Stück, wodurch die Gesellschaft noch bunter wurde, als sie vorher gewesen war. Bei meiner Rückkehr zum Schiff waren auch schon einige Damen an Bord und zwar in der Offiziermesse, wo sie unter männlicher Begleitung mit den Herren frühstückten; es waren die Häuptlingsfrau mit ihren drei Schwestern. Ich erfrischte mich zunächst auch mit Speise und Trank und forderte dann die Herren auf, mit den vier Frauen so lange in meine Kajüte zu kommen, bis ihre Messe für das uns zugesagte Tanzfest hergerichtet sei.
Die vier Insulanerinnen in meiner Kajüte zu sehen, war wirklich ein seltenes Vergnügen. Ehe sie überhaupt eintreten, stellen sie sich hintereinander in einer Reihe auf, eine hält sich am Kleid der andern fest, in den Gesichtern liegt theils Entsetzen über das was jetzt nun wol kommen wird, theils Neugierde. Im Gänsemarsch treten sie ein, um sich in der Kajüte selbst auch in derselben Ordnung zu bewegen. Die Sonne scheint hell durch die Fenster und beleuchtet grell die bunten Farben des Teppichs, des rothen Plüschsophas und der rothen Fenstervorhänge. Von dieser Pracht geblendet, bleiben unsere Freundinnen zunächst stehen, um in den wiederholten Ruf: „A—i! A—i!“ auszubrechen. Die vorher etwa dagewesene Angst ist verschwunden, die Sinne concentriren sich in den Augen, um mit diesen alles zu erfassen, und es ist doch so viel zu sehen. Der Teppich, das Sopha, der schwere blankpolirte Tisch, die vielen Stühle, die goldglänzende große Hängelampe, die kleinen polirten Eckspinde, die vielen Bilder. Plötzlich stößt die eine ein mehrmals schnell wiederholtes „Ai!“ aus, reißt die andern an den Kleidern herum, daß sie ordentlich herumwirbeln, und alle vier stehen vor den Statuetten, die Hände hinter den Ohren, Mund und Augen weit aufgerissen. Ich weiß nicht, ob dieses Erstaunen den Bildwerken oder ihren eigenen dummen Gesichtern gilt, welche sie in dem hinter den Puppen hängenden Spiegel sehen, doch ein Blick überzeugt mich, daß ihre Augen auf die Puppen gerichtet sind. Wir sind für die vier Frauen nicht mehr vorhanden, denn bald ist alle Scheu geschwunden und sie fangen an sich zu unterhalten, als ob sie allein bei sich zu Hause wären. Die eine ruft die andern, hält den Rücken ihrer rechten Hand unter ihre Nase und zeigt mit dem ausgestreckten Zeigefinger und verschmitztem Blick auf die Figuren. Eine andere zeigt auf die aus dem Spiegel zurückgeworfene Rückseite der Venus und kann nicht widerstehen, die Puppe an der Originalseite zart zu streicheln; dann kommt sie aber plötzlich zur Erkenntniß, wo sie eigentlich ist, denn sie zieht entsetzt ihre Hand zurück, steckt sie schnell in den Mund und sieht mich mit einem wahrhaft rührenden, halb entsetzten halb bittenden Blick an, was ich zu dieser Kühnheit wol sagen werde. Als ich ihr dann lachend zunicke, sind alle wie von einem Alp befreit und beginnen nun sämmtlich zu streicheln, dabei fortwährend schwadronirend und kichernd; nur eine bleibt ernst, sie steht mit geneigtem Kopf vor der Ariadne und streichelt mit ganz besonderer Andacht deren Büste, auch die andern streicheln nicht die Masse, aus der die Puppen gebildet sind, sondern suchen sich ihre Stellen aus.
Da es noch mehr zu sehen gibt, fordere ich sie nun auf, mir in die Achterkajüte zu folgen; sie rangiren sich wieder eine hinter die andere und betreten, auf den Zehenspitzen gehend, diesen Raum. Doch kaum haben sie einen Blick um sich geworfen, so fahren sie auseinander wie eine Heerde aufgescheuchter Schwaben. Eine steht vor dem Bild meiner Frau, eine andere vor der „Büßenden Magdalena“, die andere vor den früher schon genannten Mädchenbildern, doch ohne Ruhe, weil keine sich schlüssig machen kann, welches Bild eigentlich das schönste ist. So fahren sie fortwährend herum, vertauschen ihre Plätze und vollführen dabei einen Heidenlärm. Sie müssen sich sehr viel zu erzählen haben, weil sie mit ernsten Gesichtern laut und in sichtlicher Erregung sprechen. Platzen wir dann einmal mit einem tüchtigen Lachen dazwischen, dann sehen sie uns einen Augenblick vorwurfsvoll fragend an, lachen auch einmal auf, setzen dann aber gleich wieder ihr Gespräch mit ernsten Gesichtern fort. Um sie noch verwirrter zu machen, lasse ich meine Spieluhr spielen; das geht ihnen aber doch über den Spaß, wie der hübsche Kasten anfängt zu singen, und noch größer wird ihr Staunen, als sie das Werk so selbstthätig arbeiten sehen. Ich lasse sie dann auf meinem Schreibtisch und in dessen Schublade etwas herumkramen, wo die verschiedensten Sachen ihre Aufmerksamkeit fesseln und ihre aufgeregten Nerven doch etwas beruhigen: Uhren, Ringe, Messer, Schere, Tintenfaß, Cigarrentaschen, silberne Becher, loses Geld und was sonst noch für den ersten Griff bereit liegt. Hierbei bezeichneten sie alle goldenen und silbernen Gegenstände mit dem Ausdruck „money“. Diese Ablenkung hatte die beabsichtigte Wirkung, daß die Ruhe wieder über sie kam und daß die Richtung ihrer Augen zeigte, was für sie das schönste war, nämlich die beiden Mädchen, welche es am Tage vorher auch den Männern angethan hatten. Ihre Frage, ob diese Bilder meine beiden Töchter vorstellen, welche sie auf dem Schreibtisch als vier und sechs Jahre alte Kinder gesehen haben, bejahe ich belustigt. Die zum Essen angebotenen Rosinen finden keinen Anklang, dagegen scheinen die Mandeln ihnen außerordentlich gut zu schmecken, wenigstens schmatzen sie beim Essen wie eine Heerde kleiner Schweinchen, auch nimmt die eine sich mit meiner Erlaubniß einige mit, um sie an Land zu pflanzen.
Wenige Tage vor meiner Ankunft in Omoa hatte ich mich, um neben den ältern Reiseberichten auch ein wissenschaftlich begründetes Urtheil zu hören, durch Waitz' „Anthropologie“ belehren lassen. Da steht geschrieben, daß diese Naturvölker die von den Kaukasiern als ideal anerkannten Körperformen und Hautfarben den ihrigen nachstellen und namentlich die weiße Haut für krankhaft halten. Ich bin jetzt gar nicht geneigt, dies zu glauben. Die bildlich dargestellten beiden Mädchengestalten gefielen besser als die Statuetten, weil ihnen ein außerordentlich zarter Teint gegeben ist; an den Statuetten wurden die classischen Formen bewundert. Bei den Männern zeigte kein Blick, keine Bewegung das Auftauchen von Begierden, sie waren eben nur von der Schönheit hingerissen und müssen dieselben Empfindungen gehabt haben, welche uns beim Anblick der classischen Gebilde des Alterthums beherrschen. Ich halte mich daher zu dem Schluß berechtigt, daß die Reisenden sich bisher nicht die Mühe gegeben haben, diese Eingeborenen eingehend zu studiren, oder sie hatten die zu diesem Studium erforderlichen Hülfsmittel nicht an der Hand.
Wir verlassen meine Kajüte wieder, weil inzwischen zwei Bootsladungen mit Frauen und Mädchen angekommen sind, welche nach Versicherung der Dolmetscher uns auch einen Tanz vorführen werden. Die neuangekommenen Vertreterinnen des schönen Geschlechts, 14 an der Zahl, stehen scheu in einer Ecke der Messe, sich wie eine Heerde Schafe ineinander verkriechend, während die Offiziere im Verein mit den mitgekommenen Männern sie umgeben und ihnen gut zureden. Der Versuch, diese leicht bekleideten Nymphen in dem Raum zu vertheilen und bunte Reihe herzustellen, misglückt aber, trotzdem sie sehen, daß die vier vorher genannten Damen sich ganz frei unter uns bewegen. Es scheint, daß eine gewisse Zeit dazu gehört, die erste Scheu zu überwinden. Wird eine an der Hand aus dem Knäuel herausgeführt, so kommt sie ängstlich und zagend mit, schießt aber sofort wieder in den Knäuel hinein, sobald ihre Hand losgelassen wird. Es bleibt daher nichts anderes übrig als sie zusammen zu lassen, und nun gelingt es auch, sie wenigstens zum Sitzen zu bewegen. Ein Theil setzt sich auf die gepolsterte Bank, ein anderer Theil auf Stühle, die meisten ziehen den Fußboden vor, und nun beginnt ein ohrenzerreißendes Concert. Wol infolge des seit zehn Monaten ununterbrochen währenden Regens und der damit verbundenen rauhen Witterung haben die Leute fast alle den Schnupfen, und da sie Taschentücher nicht kennen, helfen sie sich damit, daß sie den Schleim mit großem Getöse einziehen und ihn dann ausspucken. Bisher hatten sie sich noch beherrscht; jetzt aber behaglich gruppirt, glaubten sie, sich diese Erleichterung auch gönnen zu dürfen, nachdem ihnen einige Spucknäpfe, deren Nothwendigkeit bei dem vorhergegangenen Besuch von den Offizieren schon erkannt worden war, hingeschoben worden sind. Spucknäpfe sind allerdings nur zwei in der Messe vorhanden, und ich wollte schon bitten, noch einige herbeibringen zu lassen, als die sich entwickelnde Scene mich davon abhält. Mit großer Sorgfalt werden diese beiden Näpfe zur gefälligen Benutzung von Hand zu Hand gereicht und so gewissenhaft benutzt, daß weitere Zufuhr überflüssig erscheint. Nachdem so für den nothwendigsten Comfort Sorge getragen ist, wird an die Bewirthung gegangen, welche in Liqueur, Kakes und Cigarren besteht. Dies hebt bald die Stimmung, die Scheu schwindet mehr und mehr, eine allgemeine Unterhaltung bricht sich Bahn und bald fühlen sich unsere Gäste sichtlich wohl. Jetzt kann auch die Aufforderung zum Tanzen erlassen werden, doch finden wir noch keine Gegenliebe. Alle Aufforderungen der Dolmetscher scheitern an einem starren Eigensinn, und dieselben wiederholen uns immer wieder, daß die Nymphen sich zu sehr schämen. Da endlich schreiten mit Energie die drei Schwestern der Häuptlingsfrau ein, die Tänzerinnen stellen sich in einen Kreis, uns ihren sehr knapp in das Umschlagetuch eingehüllten Rücken zuwendend. Na — nun endlich geht es los. Ja, Prosit! — Die Mädchen sind hier gerade so wie bei uns, in richtigem Alter eine richtige Gänseheerde. Anstatt zu tanzen, stecken sie die Köpfe zusammen und kichern, schmiegen sich aneinander an und laufen wieder auseinander, wie dies bei uns Mädchen im reifern Backfischalter thun, wenn sie nicht recht wissen, wie sie sich benehmen sollen. Der einzige Unterschied liegt nur darin, daß man in solchem Falle bei uns bei dem dabei stets stattfindenden Bücken des Körpers faltenreiche, wogende Roben sieht, während man hier bei jedem Bücken mit Entsetzen das Unglaubliche sich zu vollziehen wähnt, daß der keineswegs zähe aber überstraff gespannte Stoff platzen wird. Ich sehe mich besorgt nach irgendetwas um, womit man den etwaigen Schaden schnell repariren könnte, das Unglaubliche passirt aber nicht, der Stoff hält die Anstrengung aus. Dieses kindische Benehmen wiederholt sich mehrere male, endlich reißt allen Zuschauern die Geduld, eine der drei Schwestern geht als Vortänzerin mit in den Kreis, wir alle klatschen mit den Händen und endlich — erst zag, dann aber energisch kommt der Tanz zu seiner Vollendung.
Unter dem Händeklatschen der Zuschauer setzt sich der Kreis in Bewegung, und die Tänzerinnen beginnen einen grabesstimmenähnlichen Gesang mit folgenden Worten:
Wat taë de hi a oë
Tutu a u
A ne nikke-he nikke-he hé
A nu rukke-hu rukke-hu hú.
Der Tanz selbst liegt nur in den Hüftgelenken. Oberkörper und Beine bleiben in Ruhe, während der Mittelkörper Bewegungen macht, welche an den spanischen Tanz Habanero, wie er von dem niedern Volke getanzt wird, erinnern und bei uns kurzweg unanständig genannt werden würden. Um den Kreis der Tänzerinnen herum tanzt ganz niedrig auf dem Boden mit weit ausgespreizten Beinen der Sandwich-Insulaner, macht mit seinem Mittelkörper die wunderlichsten Verrenkungen und mit seinen Armen und Händen verständliche Gesten, Bewegungen, welche alle in dasselbe Gebiet fallen, wie diejenigen der Weiber.
Da ich gelesen hatte, daß die Frauen bei diesen Tänzen gewöhnlich das bischen Kleidung, was sie haben, auch noch abwerfen sollen, und die Marquesaner sowieso wegen ihrer Sittenlosigkeit berüchtigt sind, auch der Pater in Hanavava mir gegenüber das erstere behauptet hatte, was er übrigens nicht aus eigener Anschauung, sondern nur von Hörensagen wissen konnte, so fragte ich den Dolmetscher, ob dies auch noch kommen würde, um die Sache vorher zum Abschluß bringen zu können. Die Antwort, welche ich bekam, war recht beschämend für die Europäer überhaupt und namentlich für diejenigen, welche den schlechten Ruf dieses Völkchens begründet haben und zwar zweifellos auf die oberflächlichsten Beobachtungen oder zweifelhafte Berichte hin. Ich will den englisch redenden Marquesaner selbst sprechen lassen:
„Bei uns an Land wird stets die Sitte gewahrt, und die Frauen sind auch bei den Tänzen stets theilweise bekleidet; nur im directen Verkehr zwischen Mann und Frau schämt sich die letztere nicht und ist es dabei gleichgültig, ob der Mann ihr Gatte oder ein Fremder ist. Es ist allerdings richtig, daß Frauen von uns auf den Walfischfängern nackt getanzt haben und es vielleicht auch wieder thun, aber nie, solange noch ein Mann des Dorfes auf dem Schiffe war oder dort sein wird, weil sie sich viel zu sehr schämen. Auch thun sie es dann nur, weil sie von den weißen Männern dazu gezwungen werden und glauben, daß das bei diesen Sitte (fashion) ist.“
Als ich von dem Tanz genug gesehen hatte, was sehr bald der Fall war, ging ich wieder nach oben, um mir das dort herrschende Leben und Treiben zwischen den eingeborenen Männern und Jungen einerseits und unsern Matrosen andererseits anzusehen. Die Insulaner sind in dem Schiffe schon vollständig zu Hause und bewegen sich so frei, als ob sie an Bord gehörten, mit vielen ist auch schon eine äußerliche Veränderung vorgegangen, da sie die erhandelten oder geschenkt erhaltenen Kleidungsstücke gleich angezogen haben.
Es ist ein buntbewegtes interessantes Bild, was von meinem Standpunkte auf der Commandobrücke aus da vor mir sich entfaltet. Zu meinen Füßen liegt das blinkend weiße Deck mit seinen blanken Kanonen und all den schön geputzten, in der Sonne glitzernden Messing- und Eisentheilen. Auf dem Deck, wo an 400 Menschen sich bewegen, ist ein Leben wie auf einem Jahrmarkt: Matrosen, halb angezogene und nackte bunt bemalte Eingeborene, diese theilweise mit Früchten und andern Handelsartikeln beladen, schieben sich hin und her, dazwischen treiben die nackten gelben Jungen ihr Spiel; die ganze Reling ist mit Menschen beider Hemisphären besetzt, welche theils dem Treiben zusehend dort sitzen, theils unter Lachen versuchen, sich miteinander zu verständigen. Die Takelage des leicht hin- und herwiegenden Schiffes beschreibt regelmäßige Bogen auf dem feenhaften Hintergrunde, und das Wasser ist durch die vielen fortwährend in Bewegung befindlichen Kanus belebt. — Stundenlang hätte ich dort stehen können, um diesem interessanten, wechselvollen und harmlosen Leben und Treiben zuzuschauen.
Unter den sich umhertreibenden Jungen fiel mir ein besonders hübscher, etwa 12 Jahre alter Bengel auf; ich rief ihn heran, um ihm in der Kajüte etwas Naschwerk zu geben. Freimüthig, ohne Zaudern folgt er meinem Wink; das Innere der Vorkajüte fesselt ihn aber mehr als die Mandeln es thun. Als er sich genügend umgesehen hat, bittet er um die Erlaubniß, auch die Achterkajüte betreten zu dürfen, was ich ihm erlaube. Da er nicht wiederkommt und es hinten mäuschenstill ist, muß ich doch nachsehen, was er dort eigentlich thut; ich trete in die Thüre und finde nun die Bescherung. Da steht, zwei Schritte von mir entfernt, der halbwüchsige Junge mir gegenüber vor den hier schon so oft genannten beiden Mädchenbildern, mit offenem Munde, stieren Blickes. Er hört mich nicht und sieht mich nicht, trotzdem seine Blicke mehreremal über mich hinweggleiten, wenn er mit jähen Bewegungen seinen Kopf nach der Seite wirft, um etwa noch schönere Bilder zu entdecken, was aber nicht zuzutreffen scheint, da seine Augen stets schnell wieder nach den erstern Bildern zurückkehren. Nach einiger Zeit trete ich an ihn heran, fasse ihn leicht am Ohrläppchen, und nun kommt er erst wieder zur Besinnung. Er scheint aus einem tiefen Traum zu erwachen, sieht noch einmal nach den Bildern hin und läßt sich, verschämt lächelnd, am Ohr hinausführen. So hatte ich, im Gegensatz zu Waitz, in der Zeit von 24 Stunden alte und junge Männer, ältere und jüngere Frauen und ein Kind in meiner Kajüte, welche als das Schönste alles Sehenswerthen die zarte Hautfarbe der Kaukasierin betrachteten.
Es war inzwischen 5 Uhr nachmittags geworden, die Zeit, welche für das Wegschicken der Insulaner festgesetzt worden war, weil ich am nächsten Morgen mit Tagesanbruch weiter gehen wollte und das Schiff am Abend vorher seeklar gemacht werden sollte. Vor meiner Kajüte sitzt der weibliche Theil unsers Besuchs auf Deck, bereit in die Boote geschickt zu werden, jedenfalls verwundert darüber, daß sie in ihrem Leben zum erstenmal ein Schiff ohne weitere Abenteuer verlassen werden. Ich begleite sie noch zum Fallreep, um der Häuptlingsfrau und den Dolmetschern Adieu zu sagen, und finde bei meiner Rückkehr den Raum des schönen weißen Decks vor meiner Kajüte, wo die Frauen gesessen hatten, ganz schwarz aussehend; bei meinem Näherkommen fliegen Tausende von Fliegen auf und das Deck ist wieder weiß wie vorher. Eine höchst merkwürdige Erscheinung, da diese Leute keine andere Körperausdünstung haben als wir. Hätten Neger dagesessen, dann wäre mir die Sache erklärlich gewesen, so aber fehlt mir jede Erklärung dafür.
Da mein Interesse für das ganze Treiben um uns herum, sowie für das schöne Landschaftsbild mich noch einmal auf die Commandobrücke trieb, wurde ich noch Zeuge einer höchst putzigen Scene, nämlich wie die Jungen landen, wenn sie nicht bei dem Aufschleppen der Kanus helfen müssen, und diesmal wurden sie größtentheils mit unsern Booten, welche nach dem früher genannten Stein fuhren, an Land befördert. Sobald die Boote in die Nähe des Landes kamen, ging es hops aus den Booten heraus; all die Knirpse, an die 50 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, sprangen in das Wasser und schwammen, unbekümmert um die Brandung und ohne Rücksicht auf den bevorzugten Stein zu nehmen, nach den ihnen zunächst gelegenen Steinen und schwammen so lange vor denselben, bis eine Welle hoch auflief. Dann tauchten sie schnell unter, um aus dem überbrechenden Wellenkamm herauszukommen, und als das Wasser ablief, lagen die kleinen gelben Gestalten wie die Frösche, mit allen Vieren sich anklammernd, auf den Steinen, sprangen dann schnell auf, schüttelten das Wasser ab und waren mit einigen leichten Sprüngen aus dem Wasser. — Es ist doch beneidenswerth, solche Körpergewandtheit und auch den zu solchen Späßen wol erforderlichen Muth zu besitzen.
Ehe ich das liebliche Thal Omoa verlasse, will ich noch einige, den vorstehenden Bericht ergänzende Bemerkungen beifügen.
Wie ich schon angeführt habe, ist Arbeit eigentlich nicht bekannt und erstreckt sich nur auf das fürs Leben durchaus Nothwendigste. Dieses beschränkt sich auf den Hüttenbau, die Herstellung des Baumrindenstoffs, den Fischfang nebst dem Bau der dazu erforderlichen Kanus, auf das Abpflücken der reifen Früchte und auf das Kochen, schließlich auch noch auf das Tätowiren, wenn man dies eine Arbeit nennen will.
Bestimmte Mahlzeiten haben diese Menschen nicht, sie essen vielmehr sobald der Sinn ihnen danach steht.
Jedes Stück Land, jeder Fruchtbaum hat seinen Besitzer, und dieser Besitz vererbt sich von dem Vater auf die Söhne, beziehentlich die von ihm als solche anerkannten Kinder. Diebstahl soll nach übereinstimmender Aussage des Missionars und unserer Dolmetscher nur äußerst selten vorkommen, weil Stehlen als ein schweres Verbrechen betrachtet wird. Mit Bezug hierauf hatten wir auch Gelegenheit, ein gleiches eigenes Urtheil zu gewinnen, denn trotz der vielen Eingeborenen, welche bei uns an Bord gewesen waren, ist nichts abhanden gekommen, wie die ganze Mannschaft auf Befragen versichert hat; sogar all die Kleinigkeiten, welche den Weibern für ihren Tanz geschenkt worden waren, fanden sich nach ihrem Abgange auf dem Schiffe wieder vor.
Während unsers Aufenthalts ist, wie ich dies auch schon angedeutet habe, kein Fall von Trunkenheit bei den Eingeborenen beobachtet worden, und ich führe dies nur noch einmal an, um daran anknüpfend zu erwähnen, daß die Trinkgelage zuweilen mit der Ermordung eines Mannes enden sollen. Da diese Fälle aber stets dieselbe Entwickelung und denselben Verlauf haben sollen, so bin ich der Ansicht, daß das Trinkgelage in solchem Falle nur Mittel zum Zweck und eine Art Vehmgericht ist, daß die Ermordung zu einer Zeit erfolgt, wo die Leute noch nüchtern sind, und zwar mit der bestimmten Absicht, das Gemeinwesen auf einfachste Art von einer allgemein misliebigen Persönlichkeit zu befreien. Die Sache fängt stets damit an, daß während des Gelages zwei Männer in Streit kommen, dann aber sofort die ganze Gesellschaft ohne jedes Besinnen für den einen Streiter Partei nimmt, über den andern herfällt und ihn mit Messern und Aexten zerfleischt. Ein derartige Lynchjustiz muß ein abgekartetes Spiel sein, weil Trunkene sich wol in eine Schlägerei mischen, sich aber nicht sofort gegen eine Person vereinen können.
Bei dem Kapitel „Sittenlosigkeit“ oder „Freiheit der Sitten“ bleibt noch festzustellen, welches eigentlich die richtigste Bezeichnung ist. Der obenerwähnte kleine Pfiffige (ich muß schon bei dieser Bezeichnung bleiben) erzählte mir, daß er sich keine Frau nähme, weil er ja doch immer eine auf Zeit haben könne, wenn er Lust dazu habe, und das käme ihm billiger wie fortgesetzt eine Frau mit deren Kindern zu unterhalten. Dafür wird er allerdings in seinem Alter keine Söhne zu seiner Unterstützung haben, wenn es ihm nicht gelingen sollte, vorher ein größeres Besitzthum zu erwerben und dann darauf lüsterne junge Männer zu adoptiren. Dieser Zustand ist ja nach unsern Begriffen entschieden unmoralisch, demnach eine Sittenlosigkeit. Dieselbe wird aber dadurch sehr gemildert, daß die Kinder nicht darunter leiden, sondern in jedem Manne einen Vater, in jedem Jüngling einen sie schützenden Bruder finden. Was ist Liebe der Aeltern zu ihren Kindern? fragt man sich unwillkürlich, wenn man diese paradiesischen Zustände sieht. Die Kinder finden hier entschieden ebenso viel Liebe wie bei uns, obgleich oft nicht einmal die Mütter deren Vater zu bezeichnen wissen. Hier wird die Kinderliebe also nicht durch die Stimme der Natur bedingt, sondern einfach durch Gewöhnung.
Das aber, was sonst in den Reiseberichten als Sittenlosigkeit hingestellt wird, kann ich nicht als solche bezeichnen. Der Satz ist wol nicht anzugreifen, daß bei uncivilisirten Menschen, welche so abgeschieden von aller Welt und sich selbst überlassen leben, wie die Marquesaner, die Sittenlosigkeit und die davon gar nicht zu trennende Schamlosigkeit immer mehr um sich greifen müssen, wenn sie überhaupt einmal bestanden haben. Da die Leute nun aber nach dem früher Gesagten nur im Verkehr mit solchen Weißen, welche sie zur Abwerfung jedes Schamgefühls zwingen, sich nach unsern Begriffen sittenlos zeigen, bei ihrer Rückkehr an Land aber sofort wieder relativ strenge Sitten beobachten, so kann ich dem harten Urtheil, welches über diese Leute gefällt worden ist, nicht beipflichten, sondern kann nur das Bestehen einer großen Freiheit der Sitten anerkennen. Man wird nach all dem Gesagten sogar zu der Vermuthung verleitet, daß jene Berichterstatter womöglich mit dazu beigetragen haben, den schlechten Ruf der Marquesaner mit zu begründen. Nach langer Seereise kamen sie zu diesen Menschen, welche ihnen nach landesüblicher Sitte ihre hübschen Weiber anboten. Nahmen sie das Anerbieten an, dann suchten die Weiber natürlich sich so angenehm wie möglich zu machen und glaubten das Beste zu thun, wenn sie das von den rüden Gesellen der Walfischfänger (denn diese waren vor allen andern hier) Erlernte von sich gaben, weil die weißen Männer des einen Schiffes doch denselben Geschmack haben mußten, wie diejenigen des andern. Ihrem Gefühl nach lag den Weibern aber nach meiner Ueberzeugung ein solches Benehmen unendlich fern, weil ich sonst doch irgendeinen Anhalt dafür hätte finden müssen, und daß ich fleißig gesucht habe, dürfte aus der ganzen Darstellung hervorgehen. Und so komme ich zu dem Schluß, daß die Missionen auf den andern Inseln sich glücklich schätzen müssen, wenn sie dort je so moralische Zustände erreichen, wie sie auf dieser Insel zur Zeit herrschen, wo bisher kein Missionar sich auf die Dauer halten konnte, und daß europäische und amerikanische Hafenstädte froh sein dürften, wenn ihr niederes Volk so anständig wäre, wie diese Leute es sind.
Nebenbei sei bemerkt, daß Eifersucht hier eine unbekannte Leidenschaft ist. Doch auch ein echt paradiesischer Zustand.
Am 16. Mai morgens verließ ich Omoa wieder und langte nach einer schönen Fahrt an den schönen Inseln dieser Gruppe vorbei gestern Mittag in Port Anna-Maria auf Nuka-hiva, der nördlichst gelegenen Insel der Marquesas-Gruppe, an. Ich machte dem Gouverneur meinen Besuch, einen Spaziergang durch den Ort, trotz des anhaltend strömenden Regens, fand aber nichts Besonderes, weil dieser Platz wegen der hier lebenden Europäer seinen ursprünglichen Charakter schon verloren hat. Heute Nachmittag, nach Einnahme von frischem Fleisch für die Mannschaft, geht es weiter nach Tahiti.