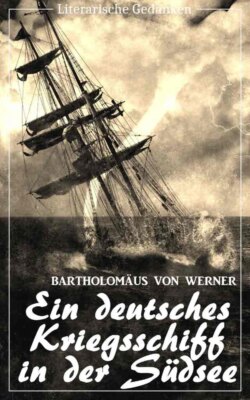Читать книгу Ein deutsches Kriegsschiff in der Südsee: Die Reise der Kreuzerkorvette Ariadne in den Jahren 1877-1881 (Bartholomäus von Werner) (Literarische Gedanken Edition) - Bartholomäus von Werner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5. – Von den Marquesas-Inseln nach Tahiti.
Оглавление18. Mai 1878.
Heute Nachmittag haben wir Port Anna-Maria wieder verlassen und damit von den Marquesas-Inseln Abschied genommen. Der Regen hatte für heute seine Herrschaft verloren und war von der Sonne und einem lachenden Abend verdrängt worden, wodurch es uns, dicht unter der Südküste von Nuka-hiva entlang segelnd, vergönnt wurde, das schöne Bild zu genießen, an welchem wir langsam vorüberzogen. Auf einzelnen Spitzen der Berge und in einigen Thälern lagerten zwar noch bleifarbene, dicht geballte Wolken, sie konnten dem Lande aber nicht mehr ihre Regenphysiognomie aufdrücken, sondern ließen die von hellem Sonnenschein überhauchten, mit üppigster Vegetation bedeckten Bergrücken und Thalgelände nur in um so prächtigern Farben erscheinen. Das vor uns liegende Panorama war schön und von demjenigen Zauber umgeben, welcher auf allen Inseln vulkanischen Ursprungs ruht. Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier eine nähere Beschreibung des Landes geben, doch glaube ich trotzdem eines schönen Punktes besonders erwähnen zu müssen.
Von dem Ausgang des Hafens von Port Anna-Maria nach Westen segelnd, befanden wir uns bald vor dem kleinen, von hohen steilen Bergen und Felsmassen eingeschlossen in einem Gebirgskessel liegenden Port Tschitschakoff. Vor der schmalen Einfahrt stehend, übersieht man den ganzen wildromantischen, malerischen Hafen, dessen Hintergrund durch seine düstere Großartigkeit jeden Beobachter unwillkürlich fesseln muß. Hier inmitten des üppigsten Tropenbildes liegt, rechts und links eingerahmt von der ganzen Fülle tropischer Vegetation, ein Stück Magelhaens-Straße der südlichsten Breite. In grünem Rahmen steigt eine von dem Regen schwarz gefärbte, wild zerklüftete Felsenwand fast senkrecht bis zu einer Höhe von 700 m empor, ein ebenbürtiges Bett für den prächtigen Wasserfall, welcher über den obersten Felsenkamm hinwegschäumt. Dort oben, in schwindelnder Höhe, steigt die 7 m breite, mächtige Wassermasse mit berauschender Gewalt über den scharfen Gebirgskamm hinweg, ohne daß man von unserm doch immerhin weit abliegenden Standpunkte die höher liegenden Berge, von welchen das Wasser kommen muß, sehen kann. Senkrecht stürzt die wilde Flut in einen düstern, im Verhältniß zu seiner Höhe engen Felsenschlund hinab, welcher unten durch Verschiebung des Gesteins für das Auge geschlossen wird, während er sich von der halben Höhe ab nach oben hin callakelchartig öffnet. Die in eiliger Hast sich überstürzenden gelben, schmutzigen Wassermassen verlieren bald ihr festes Gefüge, ein gelblicher Staubregen von großer Dichtigkeit, dessen auf- und abwogende Dunstmassen mit ihrem Spiel das Auge fesseln, füllen den ganzen tiefen Schlund aus und müssen einem untenstehenden Beschauer ein noch großartigeres Schauspiel gewähren. Leider konnte ich Port Tschitschakoff nicht anlaufen und daher diese Naturschönheit, welche erst in größerer Nähe zur vollen Entfaltung kommen kann, nicht eingehender besichtigen.
Nuka-hiva lag bald hinter uns. Zu unserer Linken hoben sich, von der Abendsonne goldig überhaucht, einige andere Inseln der Gruppe scharf von dem blauen Himmelshintergrunde ab und tauchten allmählich unter den Horizont. Die anbrechende Dämmerung verhüllte dieses langsam sich senkende Bild. Jetzt ist der Tag ganz entschwunden, wir sind wieder allein und eilen mit frischem Winde und vollen Segeln einem Theil unserer Erde zu, welcher noch vor wenig Jahren von den Seeleuten allgemein gefürchtet wurde, jetzt aber, infolge sorgsamer Vermessungen der letzten Jahre, nicht mehr zu schrecken vermag. Es ist dies der Archipel der „Niedrigen Inseln“, von den Eingeborenen sehr bezeichnend Paumotu oder „Inselgewölk“ genannt. Dieses Inselgewölk erstreckt sich in der Richtung von Südost nach Nordwest von 22° bis zu 14° Südbreite, also über einen Flächenraum von etwa 1500 Seemeilen, und zählt nahezu 100 Koralleninseln, die so dicht zusammenliegen, daß die eine immer in Sicht der andern liegt. Keine dieser Inseln erhebt sich mit ihrem festen Rücken mehr als 3 m über den Wasserspiegel, die meisten überragen denselben nur mit einem Theil ihrer Peripherie, während der andere Theil sich noch unter Wasser befindet und für die Schiffahrt gefährliche Riffe bildet. Denn wenn auch bei Tage und klarem Wetter die Brandung auf diesen Riffen weithin sichtbar ist, so weit, daß für ein Schiff keine Gefahr entstehen kann, so ist eine solche bei Nacht, wo das Auge den Dienst verweigert und man auf das Gehör allein angewiesen ist, doch vorhanden, da das Ohr ein sehr unvollkommener und namentlich ein trügerischer Führer ist. Die Inseln dieses Archipels sind durchweg sogenannte Laguneninseln (von den Engländern mit dem indischen Ausdruck „Atoll“ benannt), Steinringe, welche einen See (Lagune) umschließen, der fast stets durch eine oder mehrere Einfahrten von geringer Breite mit dem Meere in Verbindung steht. Die Größe dieser Atolls ist nach der Karte sehr verschieden, ihr Durchmesser schwankt zwischen 5 und 30 Seemeilen. Früher war man auch noch der Ansicht, daß die verschiedenen Inseln unter sich durch unterseeische Korallenriffe miteinander verbunden seien, weshalb die Schiffe es vermieden, diese Gruppe zu durchschneiden, und in der Regel einen großen Umweg wählten. Da indeß die neuesten Vermessungen ergeben haben, daß derartige Verbindungsriffe nicht vorhanden sind, sondern zwischen diesen Korallengebilden freies tiefes Wasser liegt, so kann die Passage durch den Archipel als eine relativ sichere gelten. Die einzig zu beachtende Vorsicht ist nur die, daß man den Curs zwischen solche Inseln legt, welche an der Passage sich über das Wasser erheben, und daß man sorgsame Rücksicht auf die hier herrschenden starken und unregelmäßigen Strömungen nimmt.
Ueber die Entstehung der Koralleninseln schwanken die Ansichten noch insofern, als die einen behaupten, daß die Korallenthierchen, welche nur bis zu einer gewissen Wassertiefe bauen, ihre Bauten auf allmählich sich senkendes Land errichten und sich so immer mit ihrem obern Kamm in dem Wasserniveau halten, während andere dies verneinen und die Entstehung dieser Inseln vulkanischen Erhebungen zuschreiben. Es ist wol zweifellos, daß die erstere Ansicht da zutrifft, wo das Kalkgemäuer sich bis zu einer Wassertiefe erstreckt, in welcher die Korallenthierchen nicht mehr zu leben vermögen, während bei den bewohnten Koralleninseln nur die letztere Auffassung zutreffen dürfte.
Koralleninseln.
Ich will hier eine kurze Erklärung über die Entstehung dieses merkwürdigen künstlichen Landes folgen lassen und zum bessern Verständniß die nebenstehende Skizze beifügen. Vulkanische Erhebungen des Meeresbodens bilden das Fundament. Vereinzelte Koralleninseln findet man sehr selten und dann auch nur umgeben von ausgedehnten Korallenriffen; meistentheils liegen sie gruppenweise zusammen, ebenso wie die in der Nähe liegenden Gruppen hoher vulkanischer Inseln. Ja, sie geben in ihren Contouren und ihrer äußern Erscheinung das Bild der Gipfel einer hohen Inselgruppe wieder. Die Laguneninsel mit tiefem Wasser in dem Innensee zeigt uns das Bild eines noch actionsfähigen Kraters; diejenige, deren Lagune nur seichtes Wasser hat, sagt uns, daß der Krater verschüttet ist und in demselben Schlamm und fließender Sand liegt, worauf die Korallen keinen festen Fuß fassen können, wenn nicht etwa, wie in ausgebrannten Kratern, auch hier Schwefeldämpfe die Korallenthierchen abhalten. Die vollen, in der Mitte höher sich hebenden Koralleninseln lassen keinen Zweifel, daß ihr Fundament ein fester Berggipfel ist. Wie schon angedeutet, vermögen die Korallen nicht über eine bestimmte Wassertiefe hinabzugehen (ich glaube, die äußerste Grenze ist 60 m von der Oberfläche entfernt). Sobald die Thierchen mit ihrem kunstvollen Bauwerk die Wasseroberfläche erreicht haben, sind sie an ihrem Ziele angelangt, sterben, da sie ohne Seewasser nicht mehr leben können, auf dem Kamme ab, und nun ist es nur eine Frage der Zeit und günstiger Umstände, daß das Riff sich zu einem Körper bildet, welcher Pflanzen und Menschen zu leben gestattet. Korallenriffe, welche auf fallendem Lande erbaut sind, könnten sich daher nur durch Ablagerungen und Anschwemmungen unendlich vieler kleiner, fester Körper aus dem Meere zu einer Insel entwickeln, und zu solch einer Entwickelung würden Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende gehören. Daß aber eine solche Entwickelung überhaupt nicht möglich ist, zeigen die vor hohen Inseln und überhaupt festem Lande liegenden Korallenriffe, welche, wie im Rothen Meere und Indischen Ocean, schon seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen Jahrtausenden, immer dieselbe Gestalt zeigen. Der in der Meeresoberfläche liegende Rücken der Korallenbank wird ununterbrochen so stark von der Brandung gepeitscht, daß nichts dort festen Fuß fassen kann, was nicht direct aus den Korallen herauswächst und das wieder kann nicht an der Luft leben. So können nur diejenigen Korallenriffe, welche durch Hebung ihres Fundaments über das Meeresniveau gestiegen sind, nach erfolgter Verwitterung des Korallengesteins oder nach erfolgter Anschwemmung in verhältnißmäßig kurzer Zeit culturfähig werden, wenigstens culturfähig für die Kokosnußpalme und eine Art Eisenholz, welche zu ihrem Gedeihen gerade den Korallensand und keinen Humus verlangen. Ich muß übrigens an dieser Stelle darauf verzichten, eine nähere Beschreibung dieser Inseln zu geben, da die Verhältnisse mir nicht gestatten, auf dieser Tour eine derselben anzulaufen; ich werde indeß im weitern Verlauf der Reise im westlichen Theil der Südsee noch in vielfache Berührung mit ihresgleichen kommen, dann also competenter zu solcher Aufgabe sein. Hier will ich nur noch einmal auf die umstehende Skizze hinweisen, um durch dieselbe zu zeigen, warum außerhalb der von den stets senkrecht bauenden Korallen errichteten Inseln in der Regel tiefes Wasser ist.
24. Mai.
Gestern vormittags 11½ Uhr kamen einige der Koralleninseln in Sicht, d. h. nur die auf ihnen wachsenden Kokospalmen, welche ihre Wurzeln scheinbar in den Ocean geschlagen haben, da das niedrige Land erst sichtbar wird, nachdem das Schiff sich der Insel einige Seemeilen mehr genähert hat. Da ich bisher noch keine Koralleninseln gesehen hatte, so lief ich dicht heran, um, an der niedrigen Küste entlang segelnd, einen Einblick zu erhalten. Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, diese schmalen Landstreifen zu sehen, welche, dicht mit schattigen Bäumen bewachsen, hier in dem unendlichen Weltmeere wie Oasen unter dem farbenprächtigen Tropenhimmel liegen und, von der hier ewig heißen Sonne beschienen, von einem merkwürdig sonntägig melancholischen Hauch umweht sind. Hier und da sieht man zwischen den Bäumen einige Hütten hervorlugen, Menschen gewahrt man aber nicht. Wozu sollten diese Leute auch in der heißen Mittagszeit ihre Hütten verlassen? Was sie zum Leben gebrauchen, geben ihnen die Kokosnüsse und die in den Morgenstunden unternommenen Fischzüge; andere Nahrung kennen sie nicht, sogar das Wasser fehlt ihnen. Kokosnußkerne und Fische bilden die Speise, Kokosnußmilch das Getränk. Das Leben auf diesen Inseln würde daher unmöglich sein, wenn die Kokosnußpalme nicht ununterbrochen, unabhängig von der Jahreszeit, stets Blüten und Früchte jeden Alters, von der ersten Anlage bis zur vollkommenen Reife, trüge. Arbeit bringt den Leuten keinen Nutzen, ihr ganzer Lebenszweck besteht daher in Essen, Trinken, Schlafen und in der Sorge für ihre Fortpflanzung.
Da die hohen Bäume einen Blick auf die andere Seite des schmalen Landstreifens von dem Deck aus nicht zulassen und nur ab und zu dem Auge erlauben, für Momente die schöne, hellgrüne Farbe des Inselsees zu erhaschen, so stieg ich mit einigen Offizieren, denen sich sogar der Schiffsarzt anschloß, in die Takelage, um von diesem erhöhten Standpunkte aus einen freien Ueberblick zu erhalten. Jetzt liegt die ganze Insel vor uns — zu unsern Füßen der schmale, mit saftigem Laub bedeckte Landstreifen, an den sich in der Ferne die noch im Wasserspiegel liegenden Riffe anschließen, welche sich wol nie zu fruchtbarem Boden entwickeln können, da die jahraus jahrein von derselben Richtung auflaufenden Wogen das Riff mit einer so gewaltigen Brandung überspülen, daß die kleinen Keimchen, welche sonst unter Umständen eine so starke Brustwehr zu bilden vermögen, hier doch keinen festen Fuß fassen können. Merkwürdigerweise müssen hier in der Südsee die von dem Passat aufgewühlten Wellen in Bezug auf Höhe und Kraft vor einem Nebenbuhler zurücktreten, welcher in einer Entfernung von etwa 2000 Seemeilen von den in den südlichen Breiten herrschenden schweren Südweststürmen erzeugt ist und in Form einer gewaltigen Dünung seinen Weg bis zu unserm augenblicklichen Standpunkt zu finden weiß.
Allmähliches Auftauchen einer Koralleninsel über dem Horizont.
Die Insel würde ein lohnendes, aber sehr schwieriges Thema für einen geschickten Maler abgeben; schwierig, weil nur die vollendetste Kunst die großen Contraste, welche sich hier dem Auge bieten, im Bilde wird wiedergeben können. Die tiefblaue Meeresflut, welche hier in Lee der Insel von der vorher genannten Südwestdünung nicht beunruhigt wird, ist nur leicht bewegt von dem kühlenden Passat, dessen kosendes Spiel die Wasserfläche mit unzähligen Schaumköpfen bedeckt. Sanfte niedrige Brandung bespült weich diesen blendend weißen Streifen Landes, auf dem die Kokospalmen mit ihren schlanken, graugrünen Stämmen gen Himmel streben und ihre duftigen saftig-grünen Laubkronen in dem frischen Winde spielen lassen. Niedriges Buschwerk und Gräser bedecken den Rücken des Landes und überziehen den grellen Korallensand mit einer dem Auge wohlthuenden Farbe. Auf der andern Seite des Landes liegt die smaragdfarbene Lagune, welche regungslos, von dem Winde unberührt, der Sonne wie ein riesiger Edelstein entgegenstrahlt, während dieses erhabene Gestirn glänzend in dem durchsichtigen Aether steht und seine warmen Strahlen auf dieses in stillem Frieden daliegende Stück Erde hinabsendet. Doch welche Veränderung sieht das Auge, sobald es weiter schweift! Zur Linken und Rechten verläuft das Land in Riffe, über welche die schweren Südwestwogen brüllend hinwegbrechen und ihren Gischt bis zu 15 m Höhe hinaufschleudern. Der ganze See ist in der Ferne von einer dichten Dunstmasse umrahmt, denn jenseit der Lagune sieht man nur noch den Wasserstaub der sich brechenden Wogen, da die Brandung selbst schon weit unter dem Horizonte liegt. Dieser Dunstkreis gibt dem Himmel an jener Seite eine graue Färbung und ein stürmisches Aussehen; man glaubt dort an einem rauhen Herbsttage die entfesselten Elemente kämpfen zu sehen, während hier das Schiff im schönen Hochsommer sanft die Wogen des majestätischen Weltmeers durchschneidet.
Laguneninsel (Atoll).
Im Laufe des gestrigen Nachmittags wurden noch einige dieser Inseln passirt, welche indeß ein trauriges Bild wüster Zerstörung zeigten. Vor einigen Monaten hat ein schwerer Orkan seinen Vernichtungsweg über einen Theil dieser Inselgruppe genommen, dort, wo er einkehrte, fast alle Bäume entwurzelt und die Menschen in die salzige Flut geschleudert, wo Hunderte ihren Tod fanden. Nur wenige, welche sich an Baumstämme angeklammert hatten, wurden gerettet.
Während der letzten Nacht befand sich das Schiff inmitten dieses Inselgewölks, wurde mit großer Sorgfalt in freiem Wasser gehalten, passirte heute Morgen die letzten Inseln und hat nun, den Curs nach dem schönen Tahiti gerichtet, diese doch immerhin unbehagliche Gegend hinter sich.
Der heutige Tag sollte uns nach Papeete, der Hauptstadt von Tahiti, bringen. So durfte es wenigstens angenommen werden, wenn die Meeresströmungen das Schiff seit gestern Mittag nicht zu sehr aufgehalten hatten. Die Insel ist so hoch (etwa 2240 m), daß die höchste Spitze bei klarem Wetter auf 90 Seemeilen Entfernung sichtbar ist; es wurde daher schon mit dem anbrechenden Tage nach dem ersehnten Lande ausgesehen, um seine schwachen Umrisse möglichst früh zu erspähen. Die höher steigende Sonne schichtete aber dort, wo die schöne Insel liegen mußte, Wolken auf, gab dem Lande das feuchte Tagesgewand, welches dem Erdreich Segen, dem Seefahrer aber so bittere Enttäuschung bringt. Wenn nun auch wenig Hoffnung war, das Land vorläufig zu sichten, so ging es hier doch wieder wie immer. Die Ferngläser wichen nicht von jener Wolkenbank, jeder wollte Tahiti zuerst sehen, wollte seinem erfahrenen Auge den Triumph gönnen, in dem Wolkenschleier einige schwache Contouren zu entdecken, welche zweifellos dem Lande gehörten und nicht die Ränder einer Wolke bildeten. Es mag auffällig erscheinen, daß ältere Leute sich so abquälen und ihre Augen so unnütz anstrengen, da sie doch den Stand des Schiffes genau kennen und wissen, was jenes Gewölk in sich birgt. Wer aber weiß, wie oft das geübteste Auge durch Wolkenbildungen, die fernem Lande täuschend ähneln, angeführt wird, der wird auch den Reiz verstehen, welcher in solcher Augenübung liegt. Stunden vergingen, und erst 11½ Uhr vormittags brach hoch über dem Horizont aus dem Gewölk der höchste Pic von Tahiti hervor. Noch war die Möglichkeit, den Hafen vor Einbruch der Nacht zu erreichen, vorhanden; das eine Stunde später festgelegte Mittagsbesteck ergab aber noch eine Entfernung von 70 Seemeilen, ein Stück Weges, das unter den obwaltenden Verhältnissen in sechs Stunden nicht mehr zurückgelegt werden konnte.
Der Tag war herrlich und so recht geeignet, das Schiff nach der langen Seereise von Panama aus, vor Ankunft in dem fremden Hafen wieder in einen Zustand der Ordnung und Reinlichkeit zu bringen, wie man im Auslande die deutschen Kriegsschiffe zu sehen gewohnt ist. Während in dem gewöhnlichen Alltagsdienst auf See nur die Wache, also die Hälfte der Mannschaft, zum Dienst herangezogen wird, müssen heute alle Mann heran, da nur auf diese Weise die umfangreiche Arbeit bewältigt werden kann. Denn es gilt, die ganze Außenseite des großen Schiffes bis zum Wasserspiegel und die ganze Takelage bis zum Blitzableiter zu waschen, zu säubern und mit frischer Farbe zu versehen. Diese Theile des Schiffes lassen sich auf hoher See nicht so parademäßig halten, wie sie im Hafen sein müssen. Die Wellen, welche die Außenseite des Schiffsrumpfes fortgesetzt bespülen, lösen die Farbe mit der Zeit ab; ihr Wasser überzieht die Schiffswände, ihr Gischt die untern Theile der Takelage mit einer festen Salzkruste; der aus dem Schornstein entströmende Rauch schwärzt Masten, Segel und Tauwerk; es würde daher ein vergebliches Beginnen sein, die vorgenannten Theile des Schiffes auf hoher See in der gewünschten Sauberkeit erhalten zu wollen. Den Wellen läßt sich ebenso wenig gebieten Ruhe zu halten, wie der Windstille, ihre Ruhe aufzugeben; die Wellen treiben unaufhörlich ihr Versalzungswerk, die Stille verlangt den Dampf, wenn, wie es bei uns der Fall war, das Schiff beschleunigte Segelordre hat. Könnte aber auch zeitweise mit Sicherheit auf ruhiges Wasser und auf leichten Wind gerechnet werden, so würde doch zur Reinigung das Wasser fehlen, auf dem endlosen Meere — das Wasser. Soll die neue Farbe auf den Schiffswänden haften, soll das Tauwerk geschmeidig bleiben, dann darf zu dem Waschen nur süßes Wasser verwendet werden, ein Artikel, welcher in dem heißen Klima den durstigen Menschen wegen ungenügenden Vorraths nur so knapp zugewendet werden darf, daß an eine Vergeudung in der vorher angedeuteten Weise auf hoher See nicht gedacht werden kann. Erst in nächster Nähe des Hafens, und auch nur vor einem solchen Hafen, wo mit Sicherheit gutes Trinkwasser erwartet werden kann, darf die Verschleuderung dieser meistentheils so gering geachteten und doch so edeln Flüssigkeit erlaubt werden.
Die Befehle waren ertheilt, und die Mannschaft eilte, sich für den halben Festtag zweckmäßig zu kleiden. Eine solche Generalreinigung ist für den Matrosen gewissermaßen ein Fest, denn es gehört zu seinen liebsten Beschäftigungen, bei gutem Wetter mit dem Farbenquast hantieren zu können; auch ist ihm bei solcher Arbeit eine leise Unterhaltung mit seinem Nachbar erlaubt, was den Reiz noch erhöht. In kurzer Zeit ist die Toilette, welche aus dem schlechtesten Zeuge und umgekrempelter, mit dem Futter nach außen gekehrter Mütze besteht, beendet, das Deck füllt sich wieder mit Menschen, welche Stellagen für die äußern Schiffswände und Fahrstühle für die Masten herrichten, Eimer, Schwämme und die zum Malen erforderlichen Requisiten herbeischaffen. Der Erste Offizier, erfreut, endlich sein Schiff wieder durchweg schmuck machen zu können, ist überall, wird gewissermaßen zur selben Zeit aller Orten, hinten und vorn, oben und unten, außenbords und in der Takelage gesehen. Die Takelage belebt sich mit Menschen; vom obersten Flaggenknopf bis zum Fuß des Mastes, auf den Raaen, überall ist reges Treiben. Die Stellagen werden an der Schiffsseite herabgelassen, so weit, daß die auf ihnen sitzenden Leute mit ihren Füßen eben frei von der Wasseroberfläche bleiben; die zu diesem Dienst beorderten Leute schlingen jeder sich ein Sicherheitstau um den Leib, welches, obgleich oben am Schiff befestigt, doch außerdem noch in der Hand eines als Wächter postirten Matrosen ruht. Die Vorbereitungen sind, da jedermann seinen Dienst genau kennt, in wenigen Minuten beendet, und spätestens eine halbe Stunde nach dem ersten Befehl ist die Arbeit in vollem Gange. Schwanengleich gleitet das Schiff bei dem leichten Winde unter vollen Raasegeln durch das nur wenig bewegte Wasser; von dem Vorschiff dringt das leise Rauschen des von dem Schiffsbug aufgewühlten Wassers eintönig und doch so melodisch nach hinten; leises Summen durchweht die Takelage, scheinbar aus der Tiefe des Meeres kommend klingt das Gemurmel der außerhalb beschäftigten Leute auf das Schiff herauf. Eine auffallende Ruhe ist über das Schiff gebreitet, und doch ist das ganze Schiffsvolk in emsiger Thätigkeit. Die Matrosen hängen in der Takelage wie Bienen, die eine blühende Linde umschwärmen; die Schanzkleidung ist rundherum garnirt mit den Wächtern der Sicherheitstaue, welche, träumerisch in die Ferne schauend, nur ab und zu einen Blick auf ihre Schützlinge werfen.
So steuert das Schiff, ein Bild innern Friedens, dem jetzt schon deutlich sichtbaren Lande zu. Da plötzlich ertönt hinten von der Außenseite des Schiffes her der Ruf: „Hai achterraus!“ Das Schiff ist sofort ein anderes. Das Commando des wachthabenden Offiziers: „Alle Mann innenbords!“ gibt dem Ersten Offizier einen Stich ins Herz, da er nun keine besonderen Vorbereitungen für den Empfang der mit schwarzer Farbe beschmierten Malkünstler treffen kann. Anstatt auf sorgsam ausgebreitete Matten zu treten, springen diese Leute mit ihren bemalten Füßen auf das schneeweiße Deck, um dasselbe fast ebenso schwarz wie die Schiffswand zu machen; es gilt ja aber nicht blos, den eben empfangenen Befehl zu befolgen, sondern auch theilzunehmen an dem Haifischfang. Der Ruf: „Hai achterraus!“ ist für alle zur Zeit nicht beschäftigten Leute eine unausgesprochene Erlaubniß für die Theilnahme an dem Fang, da 20-30 Mann zu einem glatten Aufziehen des Fisches gehören und die andern zusehen dürfen. Es kann wol als Regel gelten, daß jedes Schiff versucht, jeden in die Nähe kommenden Hai zu fangen, da kaum ein anderes Thier so aufrichtig gehaßt wird, wie dieser Fisch von dem Seemanne; deswegen springen auch immer einige Leute gleich zu, um die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Im Umsehen sind der Haken und ein 1 kg schweres Stück Speck zur Stelle, die Taue für den Haken und für die Schlinge, welche dem Hai, sobald er angebissen hat, übergeworfen wird, bereit. Ich will hier einfügen, daß jeder Hai, welcher sich bei mäßigem Winde einem unter Segel befindlichen Schiffe nähert, in der Regel seinem sichern Verderben entgegengeht, wenn der Fang richtig geleitet wird. Diese Wasserhyäne ist so gefräßig, daß sie stets auf den zugeworfenen Köder beißt. Auch wenn sie schon ein- oder zweimal von der Angel losgekommen ist, beißt sie mit zerrissenen Kiefern zum dritten mal an, wenn noch ein ganzer Angelhaken für den dritten Wurf vorhanden ist. Das Thier ist so stark, daß es fast immer, wenn es nur an der Angel aus dem Wasser gezogen wird, mit seinen heftigen Schlägen den stärksten Haken oder dessen Kette bricht; ein sicherer Fang wird daher nur gewährleistet, wenn man eine Tauschlinge an dem Angeltau herabgleiten läßt, die Schlinge dann über den an kurzer Leine gehaltenen Fisch bis zur Schwanzflosse streift und den Fisch nun mit dem Schwanz zu oberst aufhißt, um ihn schließlich an Kopf und Schwanz gefesselt auf das Schiff zu holen. So konnten wir also auch darauf rechnen, das signalisirte Raubthier bald auf dem Schiffe zu haben. Doch stellte sich inzwischen heraus, daß heute die Hauptsache fehlte, nämlich der Haken. Vor kurzem waren bei ähnlicher Gelegenheit die beiden Haihaken des Schiffes unbrauchbar geworden; wir fürchteten daher schon, unserm Feinde die Freiheit lassen zu müssen, als der Erste Offizier lächelnd das Deck verließ, um kurze Zeit darauf wieder mit einem in seinem Privatbesitz befindlichen wahren Prachthaken zu erscheinen. Während nun die Angel zurechtgemacht wurde, folgte der Fisch uns in einer Entfernung von dreißig Schritten mit bewunderungswürdiger Gleichgültigkeit.
Das Wasser ist hier so klar, daß das dicht unter der Oberfläche befindliche Thier in Krystall zu schwimmen schien, und wäre das Schiff nicht in Fahrt gewesen, dann hätte man dem Thier jede Bewegung absprechen müssen. Der Körper war deutlich zu sehen, keine Flosse schien sich zu bewegen, nur das bei scharfem Hinsehen erkennbare leichte Aufkräuseln des Wassers an der über die Oberfläche hervorragenden Rückenflosse zeigte, daß der Fisch in Bewegung war. Die Angel plumpste ins Wasser — sie wird absichtlich stets mit möglichst großem Geräusch geworfen — und sofort schwenkten die beiden Lootsen, denen der Hai gehorsam folgte, nach dem Schiffe hin. Diese Lootsen sind kleine Fische, von denen stets zwei den Hai begleiten, um, vor ihm schwimmend, ihn zur Beute zu führen, und aus deren Vorhandensein man schließt, daß ihr Herr mit sehr schwachen Gesichts- und Geruchsorganen ausgestattet ist. In geringer Entfernung von dem Köder ließ das plötzlich entschiedene Vorgehen des Haies erkennen, daß er nunmehr die Witterung hatte; die Lootsen nahmen jetzt ihren Standort zu beiden Seiten ihres Herrn, welcher noch etwas vorschoß, sich halb auf die Seite legte und dann mit seinem auf der Bauchseite befindlichen und mit zwölf Reihen Zähnen bespickten mächtigen Rachen zuschnappte. Gleichzeitig wurde so kräftig an der Angelleine gezogen, daß der scharfe Haken tief in den Kiefer eindrang, und unser Opfer war vorläufig an die Kette gelegt. Mächtige Schläge des Schwanzes wühlten das Wasser auf und sagten den Lootsen, daß ihr Beschützer verloren war, denn als das Thier mit dem Nachlassen der Leine wieder ruhig wurde, waren sie verschwunden. Sobald die Ueberzeugung gewonnen war, daß die Angel gefaßt hatte, wurde die Leine soweit nachgelassen, daß der Fisch wieder ohne Schmerz schwimmen konnte, und nun folgte er geduldig dicht am Schiffe, bis die Schlinge richtig placirt war. Dann wurde kräftig angezogen und im nächsten Augenblick wand sich der Fisch — zappeln kann man hier nicht sagen — mit dem Kopf nach unten hängend, in kräftigen Zuckungen über der Schanzkleidung des Schiffes; noch einige Augenblicke und er lag, wüthend um sich schlagend, auf dem Deck, wo jeder ängstlich dem Schwanze auswich, während der Matador, ein mit einer Handspake bewaffneter Unteroffizier, an seinem Kopfe zum Stoß bereit stehend auf den Augenblick wartete, wo das Opfer nach Luft schnappen würde. Der Rachen öffnete sich, hinein fuhr die Spake bis zum Magen und machte den Fisch steif. Nun war der Schwanz unschädlich gemacht, die Matrosen sprangen zu und mit Hurrah ging es nach dem Vorschiff, wo die Schlachtbank bereits bereitet war. Erst wurde der Schwanz vom Körper getrennt, da zum Ablösen des Kopfes vorher die Spake entfernt werden muß, das Thier aber ohne Kopf noch lange Zeit kräftige Muskelzuckungen behält, mit welchen es schlimme Verletzungen schlagen kann, wenn die Schwanzflosse noch am Körper ist. Dann wurde der Magen untersucht, welcher nichts Auffälliges enthielt, und danach ging es an die weitere Zerlegung, welcher ich aber nicht folgen, sondern nur kurz anführen will, was aus den einzelnen Theilen wird. Die Schwanzflosse wird an den äußersten Punkt des Bugspriets angenagelt, weil sie nach einem Matrosenaberglauben an jener Stelle angebracht dem Schiffe Glück bringt; die Schwanzstücke werden von der Mannschaft gekocht oder gebraten gegessen; das Rückgrat und das Gebiß werden sorgsam gereinigt und als Raritäten mit nach Hause gebracht.
Sobald der Hai auf dem Schiffe war, gingen die Leute, bis auf wenige, welche den Fisch zerlegten, wieder an die Arbeit, doch die Stimmung, welche vorher auf dem Schiffe gelegen, kehrte nicht wieder. Die Aufregung der Jagd hatte alle unruhig gemacht und dies theilte sich dem ganzen Schiffe mit. Diese Unruhe äußerte sich nicht in größerm Geräusch, denn es war fast noch lautloser wie vorher, sondern zeigte sich in den Mienen und Bewegungen der Leute. Die Arbeit wurde beendet, das beschmutzte Deck mit Messern, Schrapern, Sand und Steinen wieder gereinigt, und erst dann trat mit der Selbstreinigung der Mannschaft wieder die alte Stimmung ein. Schon vor Beendigung der Arbeit ist das Verdeck für die große Waschung vorbereitet worden. Das Tauwerk ist aufgehängt, etwa dreißig große, mit süßem Wasser gefüllte Bütten stehen bereit, die Spritzenschläuche sind an die Pumpen angeschraubt. Die Mannschaft strömt herbei und hat, da wir auf dem Kriegsschiffe ja immer unter uns Männern sind, schnell sich aller Kleider entledigt. Die Gelegenheit wird ausgiebig benutzt, da ein solches Süßwasserbad nicht oft geboten wird; in kurzer Zeit ist die ganze Mannschaft in Seifenschaum gehüllt. Dort steht ein Kranz Matrosen in gebückter Stellung um ihre Bütte; die nächste Gruppe ist schon weiter vorgeschritten, indem die Leute aufrecht stehen und einer dem andern den Rücken abseift; weiterhin ragt aus der Mitte eines Kranzes über die gebeugten Rücken die zusammengekauerte Gestalt eines Mannes hervor, welcher in dem Waschfaß sitzt; daneben sitzen in einem größern Gefäß sogar zwei sich gegenüber, welche sich gegenseitig abseifen, aber bald mitsammt ihrer Wanne von den Kameraden umgeworfen werden, weil sie sich zu unnütz machen. Kleine Scherze der verschiedensten Art beleben und erheitern das Bild, die allgemeinste Lustigkeit bricht aber durch, sobald die Spritzen zu spielen beginnen. Alles strömt herzu und ballt sich zu einem lebenden Knäuel zusammen, auf welchen von erhöhtem Standpunkte aus die kräftigen Wasserstrahlen fallen. Da wogen 200 kräftige, muskulöse Gestalten als ein Bild der üppigsten Kraftfülle unter Lachen und Gejauchze hin und her, sich gegenseitig verdrängend und verschiebend; in der Mitte die größere Masse aufrecht stehend, und um diesen Kern herum ein Kranz theils auf dem Gesicht, theils auf dem Rücken liegender Gestalten, welche das Bad in dem langsam abfließenden Wasser dem kräftigen Strahl vorziehen. Die Abendbrotzeit nahte, dem Baden mußte ein Ende gemacht werden, und eine Stunde später saß die Mannschaft wieder auf dem Vordeck, um die Freizeit nach dem Abendbrot zu genießen und, auf dem vom Monde hell beschienenen Deck behaglich ausgestreckt, rauchend den Klängen der Musik zu lauschen, welche mit ihren deutschen Weisen uns der Heimat näher rückte.
Das köstliche Wetter, der schöne Sonnenuntergang, bei welchem wir vor drei Stunden für heute den letzten Blick auf das in weiter Ferne sich von dem Himmel abhebende Inselland warfen, welches sein aus Wolken gewebtes Tageskleid wieder abgelegt hatte, das magische Bild des von dem Monde silbern überhauchten Schiffes, rufen in mir die märchenhaften Erinnerungen wieder wach, welche mein Gemüth so mächtig bewegten, als ich vor 22 Jahren als Knabe zum ersten mal Madeira in weiter Ferne sah und auf der längst verschollenen „Amazone“ in einer ähnlichen Zaubernacht mit leichtem Winde dieser schönsten aller Inseln entgegensegelte. Damals der vierzehnjährige Knabe als preußischer Cadet auf seiner ersten Seereise, jetzt der Mann als Commandant eines deutschen Schiffes vor einer ähnlichen Inselperle, welche 15000 Seemeilen weiter von der Heimat entfernt ist. Was liegt nicht alles in dieser verhältnißmäßig kurzen Spanne Zeit? Welche großartigen politischen Umwälzungen haben sich nicht vollzogen, wie hat mein eigenes Leben sich gestaltet? — Es ist Zeit für mich, das Bett aufzusuchen, weil ich um 3 Uhr morgens wieder auf dem Posten sein muß, da nach der dem Schiffe gegebenen Segelführung dann das Land angesteuert wird, um bei guter Zeit in Papeete eintreffen zu können.