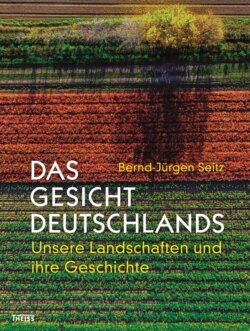Читать книгу Das Gesicht Deutschlands - Bernd-Jürgen Seitz - Страница 12
Feld, Wald, Siedlung – was wie genutzt wird
ОглавлениеOhne Einfluss des Menschen wäre fast ganz Deutschland von Wald bedeckt. Auch Tacitus beschrieb etwa 100 Jahre nach der Zeitenwende Germanien noch als schauerliche Wildnis mit dunklen, unzugänglichen Wäldern. Heute ist Deutschland nur noch zu etwa einem Drittel mit Wald bedeckt, in Schleswig-Holstein sind es sogar nur 11 %.
Bevor wir nochmals näher auf den Waldanteil eingehen, betrachten wir die Flächennutzung in Deutschland insgesamt (Abb. 9). Die Landwirtschaftsflächen (einschließlich Heiden und Mooren) haben laut Statistischem Bundesamt (2016) einen Anteil von etwas mehr als 50 %, danach folgt der Wald mit 30 %, und dann kommen schon die Siedlungs- und Verkehrsflächen mit fast 14 %. Die Wasserflächen mit 2,4 % und „Sonstiges“ mit 1,7 % sind demgegenüber (zumindest statistisch gesehen) zu vernachlässigen.
Aus der Flächenentwicklung zwischen 2004 und 2015 lässt sich ein klarer Trend ablesen: Erwartungsgemäß nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche zu und zwar um etwa 3400 ha von 12,8 auf 13,7 %. Aber auch die Waldfläche hatte Zuwachs und zwar um fast genau 3000 ha von 29,8 auf 30,6 %. Dagegen nahm die Landwirtschaftsfläche um 5000 ha von 53 auf 51,6 % ab.
Die Landwirtschaft ist in Deutschland mit knapp über 50 % die klar dominierende Nutzung, sie nimmt aber zugunsten der Siedlungs- und Verkehrsfläche und des Waldes immer mehr ab. Innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung steht heute das Ackerland mit rund 70 % deutlich im Vordergrund. Der überwiegende Anteil der Äcker (56 %) war im Jahr 2016 (Statistisches Bundesamt) mit Getreide bepflanzt, danach folgt mit mehr als 20 % der Mais und mit etwa 10 % der Raps. Die Rebflächen (S. 90 ff.) werden nicht zu den Äckern gerechnet. Sie umfassen in Deutschland ziemlich genau 100.000 ha (1000 km2), das sind nur 0,6 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die nicht als Äcker genutzten Flächen sind mit 28 % der Landwirtschaftsfläche im Wesentlichen als Grünland genutzt, das heißt entweder als (gemähte) Wiesen oder als Weiden (S. 119 ff.).
Als besonders naturnah gelten im Allgemeinen die Wälder. Betrachten wir zunächst einmal den Waldanteil der einzelnen Bundesländer (Abb. 10). Hier fällt auf, dass die Bundesländer in der Südhälfte Deutschlands einen höheren Waldanteil haben als die in der Nordhälfte – mit Ausnahme von Brandenburg. Betrachten wir zuerst die Ausnahme von der Regel – wer Brandenburg kennt, kann sich denken, woran es liegen könnte: Auf den dort vorherrschenden nährstoffarmen Sandböden (die Mark Brandenburg als „des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse“) kann heute keine „lohnende“ Landwirtschaft mehr betrieben werden, sodass viele Flächen dem Wald überlassen oder mit Kiefern bepflanzt wurden – die Kiefer ist eine für Sandböden geeignete „Pionierbaumart“. In den südlichen Bundesländern sind es weniger die nährstoffarmen Böden, sondern der hohe Anteil an Mittelgebirgen, die für eine landwirtschaftliche Nutzung weniger günstig sind.
Abb. 9 Flächennutzung in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2016).
Bei den Stadtstaaten ist es natürlich der große Anteil des besiedelten Bereichs, der die Waldfläche zurückdrängt. Umso überraschender ist es, dass Berlin immerhin 18 % Wald aufweist – deutlich mehr als Schleswig-Holstein, der Flächenstaat mit dem geringsten Waldanteil (11 %). Nicht überraschend ist nach den vorherigen Ausführungen, dass die eher flachen norddeutschen Bundesländer weniger Wald tragen als die bergigen süddeutschen – sie liegen alle unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 32 %, mit Ausnahme von Brandenburg (36 %). Die waldreichsten Bundesländer sind Rheinland-Pfalz und Hessen mit einem Waldanteil von über 40 %. Zwischen 35 und 40 % liegen neben Brandenburg Baden-Württemberg (38 %) und Bayern (37 %), auch Thüringen liegt mit 33 % noch über dem deutschen Durchschnitt (Statistisches Bundesamt 2016).
Abb. 10 Waldanteil Bundesländer (gerundet; Statistisches Bundesamt 2015).
Einen ersten Hinweis darauf, wie naturnah unsere Wälder wirklich sind, gibt der Anteil der verschiedenen Baumarten: Obwohl in Deutschland von Natur aus in fast allen Regionen die Buche vorherrschen würde, bedeckte sie in Deutschland bei der letzten Bundeswaldinventur 2011/2012 (BMEL 2016) nur wenig mehr als 15 % des Waldbodens. Den höchsten Anteil hatte mit rund 25 % die Fichte, ein schnell wachsender Nadelbaum, der von Natur aus nur an wenigen, besonders kalten Orten wachsen würde. Danach kommt mit 22 % die Kiefer, die wie oben bereits erwähnt auch auf nährstoffarmen Sandböden gut gedeiht. Insgesamt haben Nadelbäume mit 54 % einen höheren Anteil an der Waldfläche als Laubbäume (43 %). Unter Letzteren nimmt nach der Buche die „deutsche“ Eiche mit etwas mehr als 10 % den zweiten Platz ein.
Abb. 11 Alexander von Humboldt, Naturgemälde der Anden (aus: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, Tübingen 1807).