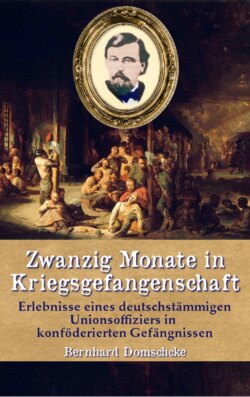Читать книгу Zwanzig Monate in Kriegsgefangenschaft - Bernhard Domschcke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel II
Оглавление-
Der Rückmarsch nach Virginia – Das Shenandoah-Tal – Richmond
Lees Armee zog sich in zwei nebeneinander hindrängenden Kolonnen von Infanterie und Artillerie zurück und die Gefangenen bildeten streckenweise die dritte Kolonne, mit einer Infanterieeskorte an der Seite. Da die Wege für einen solchen Strom von Menschen, Kanonen und Wagen nicht breit genug waren, so mussten wir häufig auf ungeebneten Wegen über Felder und Wiesen, durch kleine Bäche und Teiche, welche die starken Regengüsse gebildet hatten, marschieren und Hecken und Zäune erklimmen. Wir erreichten am 5. Juli Fairfield. Frauen und Mädchen standen weinend in den Türen ihrer Wohnungen, denn als sie unsere blauen Uniformen sahen, glaubten sie, dass alles verloren sei. Es wurde ihnen zum Trost zugerufen, dass die Rebellen-Armee sich zurückziehe und wir bald wieder zurückkehren würden. Ein junges, schönes Mädchen weinte bitterlich und rief Gott an, uns zu schützen. An demselben Tage kamen wir in die sogenannten "South Mountains", eine Reihe von teilweise hohen, malerischen Bergen mit tiefen Tälern und Schluchten. Da wir und die Armee uns hier nicht, wie vorher auf den flach gelegenen Feldern, ausbreiten konnten, waren wir oft in einen großen Knäuel zusammengepresst, der sich mühsam fortwälzte. Eine dunkle Nacht war hereingebrochen und es bedurfte aller Vorsicht, um nicht unter die Hufe der Pferde oder die Räder der Kanonen zu geraten. Einige Offiziere nutzten die Dunkelheit und Verwirrung und schlüpften durch die Eskorte auf die waldbewachsenen Berge, wo sie sich versteckt hielten, bis die Rebellenhorden vorüber waren.
Am Morgen des 6. Juli langten wir in Monterey Springs, einem Badeorte, an, wo die Rebellen neue Unterhandlungen wegen der Entlassung mit uns begannen. Sie sahen, wie schwierig der Transport eines so großen Gefangenenzuges war und fürchteten höchstwahrscheinlich noch immer eine Attacke seitens unserer Armee, wobei wir vielleicht entkommen könnten. [Anm. d. Hrsg.: Die konföderierte Army of Northern Virginia führte bei ihrem Rückzug etwa 4.000 Gefangene mit sich.] Ferner berechneten sie jedenfalls, dass eine starke Eskorte für uns notwendig sein würde, welche sie unter Umständen sehr notwendig zu anderen Zwecken brauchen könnten. Sie riefen uns deshalb zusammen und machten uns ungefähr dieselben Vorschläge, die wir bereits bei Gettysburg vernommen hatten. Eine lange Beratung hatte zur Folge, dass wir im Hinblick auf Hallecks Order das Angebot ablehnten, dessen Annahme vorläufig nur von Vorteil für die Rebellen gewesen wäre. Außerdem trug noch jetzt die Hoffnung auf eine mögliche Befreiung zu der Ablehnung bei. Uns war offensichtlich, dass die Rebellen wünschten, der Gefangenen los und ledig zu werden, aber wie hätten wir bereitwillig auf etwas eingehen können, was unsere Feinde sehnlichst wünschten? So traurig unsere Aussichten für die Zukunft waren und so sehr wir danach verlangten, die Freiheit wieder zu gewinnen, so konnten wir uns doch nicht entschließen, den Rebellen eine Gefälligkeit zu erweisen und zu gleicher Zeit eine Order zu verletzen, deren Hauptsinn der war, dass eine Auswechslung nur dann erfolgen konnte, wenn der Feind in "wirklichem Besitze" der Gefangenen war.
Am 6. Juli nachmittags marschierten wir, nachdem diese Unterhandlung gründlich gescheitert war, ab, um einen höchst beschwerlichen und ermüdenden Marsch nach Waynesboro und Hagerstown zu machen. Dies war eine grässliche Nacht: Die Marschkolonne bewegte sich nur langsam und wir mussten fast alle fünf Minuten Halt machen. Es wurde uns keine Rast gegönnt und bis zum Äußersten ermüdet und in Folge der spärlichen Rationen keineswegs sehr kräftig, legten wir uns, sobald die Kolonne ins Stocken geriet, auf der schmutzigen Straße nieder, um jede Minute zu einer kleinen Ruhe zu benützen. Am Morgen gelangten wir in Hagerstown an, wo es damals eine ansehnliche Zahl von Sezessionisten und Sezessionistinnen gab. Eine der letzteren rief vom Trottoir aus, wo sie mit heiterer Miene stand, dem vor dem Zuge reitenden Rebellen-Colonel triumphierend zu: "Colonel, dies ist die rechte Art, sie anzutreiben!" Sie gehörte offenbar zu jener Sorte von verbissenen Hexen, deren es in den Südstaaten so viele gab und die nicht wenig dazu beitrugen, die ohnehin schon halb toll gewordenen Männer noch mehr zu Verrat und Grausamkeit aufzureizen. Am Südende von Hagerstown trafen wir einen Trupp gefangener Kavalleristen, welche auf Erkundung ausgeschickt worden waren und in unmittelbarer Nähe der Stadt einen Kampf mit den Rebellen zu bestehen hatten. Auf einem Felde an der Straße lagen die Leichen mehrerer Kavalleristen, natürlich nach Rebellenmanier ausgeplündert. Auch wurden mehrere Zivilisten zu uns gebracht, die unter irgendwelchem Vorwande von den Rebellen gefangen genommen worden waren und mit uns fortgeschleppt wurden. Ihnen stand ein hartes Schicksal bevor, denn sie wurden nicht als Kriegsgefangene behandelt und erhielten sehr oft nicht einmal das Wenige, was uns die Gnade der Rebellen zukommen ließ.
Nach kurzem Aufenthalt bei Hagerstown trieb man uns weiter nach Williamsport am Potomac River, wo wir auf einer Anhöhe im nassen Grase kampierten und uns von einem angrenzenden Weizenfelde Ähren pflückten, um mit den spärlichen Körnern einigermaßen unseren Hunger zu stillen. Die Rebellen hatten starke Wachtposten in östlicher Richtung aufgestellt, zuweilen hörten wir auch den dumpfen Klang eines Kanonenschusses, aber die erwarteten Retter erschienen nicht und allmählich schwand jeder Hoffnungsschimmer. Vor uns lag der Potomac River, die Grenze zwischen den freien Staaten und dem Reiche der Rebellen. Bis hierher hatte uns die Hoffnung auf Befreiung begleitet und war diese Hoffnung töricht, wenn wir den Zustand sahen, in welchem sich die Rebellen-Armee befand? Getäuscht in ihren Erwartungen, als Sieger in Baltimore einzuziehen und entmutigt durch den Ausgang der Schlacht bei Gettysburg, in welcher sie furchtbare Verluste erlitten hatten, eilten die Rebellen auf streckenweise fast unwegsamen Straßen dem hoch angeschwollenen Potomac River entgegen, um sich auf der Südseite desselben vor neuen Schlägen zu retten, welche sie sicher zu erwarten schienen. Auf dem lehmigen, morastartigen Platze, welcher zwischen Williamsport und dem Potomac River lag, standen ihre Kanonen, Munitions- und Proviantwagen fast bis zu den Achsen in den weichen Boden eingesunken da und die Kavallerie hatte die größte Mühe, durch die Fluten des Potomac River zu gelangen. Konnten nicht diese Umstände unserem Oberbefehlshaber wenigstens annähernd bekannt sein und ihn veranlassen, einen neuen Schlag gegen die Rebellen zu führen, der möglicherweise ihre Vernichtung und unsere Befreiung zur Folge haben konnte?
Aber es geschah nichts Derartiges und am Nachmittag des 8. Juli wurden Anstalten getroffen, uns über den Potomac River zu bringen, den wir zwei Wochen vorher bei Edward's Ferry in der freudigsten Stimmung überschritten hatten. Zuerst hieß es, dass wir auf einer furtartigen, nicht allzu tiefen Stelle den Fluss durchwaten sollten, aber es stellte sich bald heraus, dass die Flut zu reißend und das Wasser zu hoch waren; es wurde deshalb ein altes Flachboot mittels eines in schräger Richtung nach oben gehenden Seiles an einem anderen Seile befestigt, welches an zwei auf den beiden Ufern eingerammten Pfosten festgemacht war. Diese einfache Konstruktion verhinderte, dass die gebrechliche Fähre stromabwärts getrieben wurde und nach dem Verlauf einiger Stunden befanden wir uns sämtlich jenseits des Potomac River.
Wieder auf dem Boden Virginias! Wieder in dem Lande der Barbarei, nicht als Sieger, sondern als Gefangene, die traurigen Ereignisse der letzten Tage in frischem Andenken und eine trübe Aussicht vor uns. Der Potomac River trennte uns von dem Lande der Freien, sehnsüchtig schweiften unsere Augen hinüber nach den Bergen Marylands, wo sich unsere Armee befinden mochte, aber der unbarmherzige Ruf zum Wiederabmarsch weckte uns aus unseren Träumen. Eskortiert von den Überlebenden aus Picketts Division, welche uns wehmütig erzählten, dass noch keine Schlacht so viele Opfer ihrerseits gefordert habe, gingen wir zunächst nach Martinsburg und, nachdem wir daselbst in einem Obstgarten übernachtet hatten, wo manche mit kleinen, grünen und unreifen Äpfeln ihren Hunger stillten, am anderen Morgen bis in die Nähe von Winchester, wo uns an einem schattigen Platze in der Nähe einer herrlichen Quelle, die unter dem riesigen Stamme einer mächtigen, Jahrhunderte alten Ulme in unversiegbaren Strömen hervorfloss, ein Tag Rast gestattet und eine gewisse Menge Mehl und Fleisch verabreicht wurde, zu deren dürftiger Zubereitung sofort jene sehr primitiven Anstalten getroffen wurden, die bereits erwähnt worden sind. Am 12. Juli, einem Sonntage, passierten wir Winchester, eine erträglich respektabel aussehende Stadt mit vielen altmodischen, jedoch auch manchen neuen und elegant aussehenden Häusern, auf deren Balkonen die aristokratischen Damen und alten Herren sich befanden, um eine schadenfrohe Begutachtung über uns zu halten. Sie hatten keine Bemerkungen zu machen, aber in ihren Mienen war deutlich das Wohlgefallen zu lesen, welches sie bei dem Anblick so vieler gefangener "Yankees" empfanden. Jenseits der Stadt sahen wir die Befestigungen, aus welchen vor kurzem der General Milroy verjagt worden war und manche Schlachtengeschichten wurden von Offizieren erzählt, welche an den früheren, bei Winchester stattgefundenen blutigen Konflikten teilgenommen hatten.
In den nächsten Tagen erreichten wir das Shenandoah-Tal und jetzt begann ein Marsch, der uns über alle Maßen ermüdete. Es trat heftiges Regenwetter ein, welches beinahe eine Woche anhielt und die Wege verschlechterte und die Bäche zu Strömen anschwellen ließ. Wir wurden von Kavallerie eskortiert, welche zu Imbodens Kommando gehörte, mussten täglich 25 bis 30 Kilometer zurücklegen und wurden jede Nacht, wenn wir uns müde und durchnässt auf den feuchten Boden gelegt hatten, von einem neuen Regenguss überrascht, der die kleinen Feuer, welche wir mit umherliegenden Holzstücken und Reisig zu unterhalten suchten, auslöschte. Wir waren indes meistens zu müde, als dass wir uns viel um den Regen gekümmert hätten und schliefen, um am anderen Morgen, bis auf die Haut durchnässt und frierend, den Marsch weiter fortzusetzen. Die Rationen waren so klein und unzureichend wie zuvor, jedoch gelang es uns, hier und da etwas kaufen zu können. Man berechnete unsere Unionsbanknoten, die "Greenbacks", zu drei Dollars konföderierten Geldes und forderte enorme Preise für die sauren Brombeerkuchen, welche ein Grundnahrungsmittel im Shenandoah-Tale zu sein schienen. In Harrisonburg traf ich einen Deutschen, einen dem Spekulantengewerbe nachgehenden Israeliten, der, wie er sagte, sehr gute Geschäfte machte und sich für das konföderierte Geld, in dessen Wert er vorsichtigerweise kein großes Vertrauen setzte, Häuser und Farmen kaufte, die er billig haben konnte. Der Mann erzählte viel, in einer Art von Pennsylvania-Deutsch und pflegte ununterbrochen die Redensart einzuschieben: "Und ich will Sie auch sagen die reason why." Er verkaufte uns essigsauren Brombeerkuchen und ein Brot zu einem sehr hohen Preise und erwiderte auf eine kleine vorwurfsvolle Bemerkung: "Ich will Sie auch sagen die reason why; alles ist very high, especially die flour, and müssen Sie sein froh, dass Sie noch haben etwas, sure!" Wir waren auch froh, nur nicht an die ungeheuren Preise gewöhnt, welche man im Süden für jeden Artikel des Lebensunterhaltes forderte. Wir haben später treffliche Studien in dieser Richtung gemacht, fanden es aber damals überraschend, dass man drei Dollars für etwas bezahlen sollte, was im Norden vielleicht zehn Cents kostete und wofür selbst ein "grundehrlicher Marketender" kaum den dritten Teil berechnet haben würde.
Von Winchester kamen wir zunächst nach Newton, wo der kommandierende Rebellen-Captain den Weg verfehlte und wir durch einen Fluss zu waten hatten, weil die Brücke überschwemmt war; dann nach Middletown, Strasburg, Woodstock, Edinburgh, Mount Jackson, New Market und Harrisonburg. Alle diese Städtchen und Dörfer waren zwar hübsch gelegen, aber, Harrisonburg vielleicht ausgenommen, verödet und hatten, wie die meisten Ortschaften im Süden, ein altmodisches oder verwittertes Aussehen. Das Shenandoah-Tal an und für sich war schön und die Felder zwischen den beiden Gebirgszügen waren fruchtbar, aber es fehlte hier, wie überall im Süden, der rechte Fortschrittstrieb. Unter den Händen freier nordstaatlicher Farmer wäre dieses Tal ein Paradies und eine Quelle noch bedeutenderen Wohlstandes geworden, als es zuvor gewesen war. Die Spuren des Krieges waren in den genannten Plätzen deutlich wahrzunehmen; viele Häuser standen leer und gingen dem Verfalle entgegen; man sah manches Aushängeschild, aber der Kaufladen oder die Werkstätte waren geschlossen. Von der männlichen Bevölkerung erblickte man nur Greise, Knaben und verkrüppelte junge Männer; die Frauen und Mädchen waren meist ärmlich und in der Regel schwarz gekleidet. In einigen Ortschaften fanden wir Baracken, in welchen zum Teil Regimenter ihr flüchtiges Domizil aufgeschlagen hatten oder Verwundete untergebracht worden waren. In Harrisonburg war ein großes Akademie-Gebäude zu einem Hospital eingerichtet worden.
Von Harrisonburg ging der Weg durch eine fruchtbare Gegend über Mount Crawford und Mount Sidney nach Staunton, der letzten Station unserer mühevollen und etwa 300 Kilometer langen Tour. Die Eisenbahnwagen standen bereits vor dem Stationshause und nach wenigen Minuten war der Zug zur Abfahrt bereit. Vorher mussten wir indes noch eine Unwürdigkeit erdulden. Ein Lieutenant kam nämlich in die Wagen und verlangte auf Befehl des Kavallerie-Generals und Wegelagerers Imboden, dass wir etwaige Decken, Wachstücher, Mäntel und dergleichen, das Einzige, was Einzelne von uns wenigstens einigermaßen vor dem Unwetter schützte, abgeben sollten. Da Gewalt vor Recht geht, mussten wir uns fügen. Manche schnitten indes ihre Decken entzwei und warfen die Stücke hinaus oder auf den Fußboden. Der Rebellen-Lieutenant sprach sein Bedauern aus, uns dieser kleinen Habseligkeiten berauben zu müssen, bemerkte aber zugleich, dass der General ihm den Befehl in der ausdrücklichsten Weise gegeben habe.
Am Abend des 18. Juli, also beinahe drei Wochen nach dem Tage unserer Gefangennahme, kamen wir in Richmond an. Die Eisenbahn ging unmittelbar in die Stadt und der Zug hielt in einer belebten Straße an. Hunderte von Neugierigen, Weiße und Schwarze, hatten sich auf beiden Seiten der Straße versammelt. Wir stellten uns in viergliedriger Reihe auf, die Eskorte wurde formiert und die traurige Prozession begann. Wir marschierten durch mehrere Straßen, unter anderem durch eine, in welcher die Israeliten ganz ausschließlich ihr Lager aufgeschlagen zu haben schienen. Es war Samstag; vor den Türen saßen die Damen mit dem unverkennbaren orientalischen Typus, ziemlich reich gekleidet und uns schweigend musternd. Über den Läden hingen Schilder mit den bekannten, oft poetisch klingenden, aber in den meisten Fällen höchst kurios anglisierten Namen der Rosenzweige, Rosenhaine, Rosenbäume usw. Wir waren in der Straße, deren Einwohner später einmal der Richmonder Zeitung "Examiner" Stoff zu einem Artikel gaben. Eine nordstaatliche Zeitung hatte nämlich von einem "Kreuzzuge" gegen Richmond gesprochen. Der "Examiner" bemerkte bei dieser Gelegenheit, dass er die "nordstaatlichen Vandalen" zwar nicht mit den Kreuzrittern vergleichen könne, dass aber doch wenigstens eine Ähnlichkeit mit den Kreuzzügen der alten Zeit vorhanden sei, indem die "Yankees" hier viele Juden treffen würden, welche dem "Examiner" übrigens schwer im Magen lagen, weil er ihrem konföderierten Patriotismus nicht traute.
Nach einem Marsche von ungefähr 15 bis 20 Minuten kamen wir in die Cary Straße, nahe dem Kanal, bei einem großen dreistöckigen Gebäude an, wo Halt gemacht wurde. "Was für ein Gebäude ist dies?" wurde gefragt. Ein kleines hölzernes Schild an der westlichen Ecke des Hauses gab uns genügende Auskunft. Die Inschrift lautete: "Libby & Sohn, Schiffsbedarf & Lebensmittel."