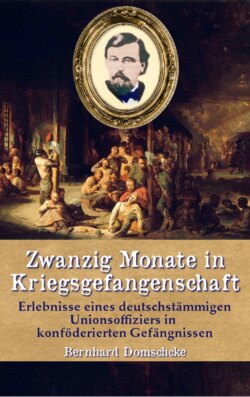Читать книгу Zwanzig Monate in Kriegsgefangenschaft - Bernhard Domschcke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel VI
Оглавление-
Ein Winter im "Libby" – "Frischer Fisch" – Musik und Theater – Die Küche – Die Sanitätskommission – Hunger überall
Der Herbst nahte bereits seinem Ende und noch wussten wir nichts Definitives über einen Austausch. Wir lasen die Korrespondenzen zwischen Meredith und Ould mit großer Begierde, denn wir glaubten, in denselben vielleicht eine Andeutung zu finden, welche uns zu neuer Hoffnung berechtigen könnte, aber die genaueste Prüfung und die kühnste Interpretation ergab nichts zu unserem Troste. Beide Herren stritten sich um Zahlen, wie zwei Rechenschüler um eine Lektion; jeder hatte nach der Ansicht des andern einen Additions- oder Subtraktionsfehler gemacht, welchen sie sich gegenseitig mit Bosheit oder Grobheit vorwarfen. Anfangs glaubten wir, dass die Differenz in der Zusammenzählung der Gefangenen und auf Ehrenwort Entlassenen das einzige Hindernis sei, welches dem Austausche entgegenstehe, aber endlich kamen wir zu der Überzeugung, dass das Kartell, über welches man sich im Jahre 1862 verständigt hatte, einen unheilbaren Bruch erlitten habe und man sich mit Vorbedacht nicht einigen wolle. In dieser Zeit wurde zuerst der Gedanke ausgesprochen, dass wir für die Dauer des Krieges in Gefangenschaft gehalten werden würden. Einige Notizen in nordstaatlichen Zeitungen, wonach Präsident Lincoln geäußert haben sollte, die Zeit zu einem allgemeinen Austausch sei noch nicht gekommen, bestärkten uns in jener Meinung, welche leider keine irrtümliche war. Natürlich folgten wir allen militärischen Bewegungen mit umso größerer Spannung, denn außer dem allgemeinen Interesse war speziell das unsrige mit dem Erfolge verknüpft; je eher die Rebellion unterdrückt wurde, desto näher rückten wir dem Tage unserer Befreiung. Aber leider war in jener Zeit nicht viel Gutes und Ermutigendes zu entdecken; General Meade rückte zwar mit der Army of the Potomac vorwärts, kehrte aber bald wieder über den Rappahannock River zurück und da der Winter vor der Türe stand, konnte man einen neuen Feldzug nicht erwarten. So machten wir uns mit dem Gedanken vertraut, dass wir sicher den Winter in der Gefangenschaft zubringen würden. Vielleicht sollte uns der Frühling des Jahres 1864 die Freiheit bringen.
Im Oktober trafen die Offiziere ein, welche in der Schlacht am Chickamauga Creek gefangen worden waren; ihre Zahl war groß und der Ruf "Frischer Fisch!" wollte kein Ende nehmen. Es war nämlich Sitte geworden, jeden neuen Ankömmling mit diesem Rufe zu begrüßen, welcher die Neuen gewöhnlich in Verwunderung versetzte, weil sie die Bedeutung des Ausrufs nicht kannten. Sobald sich ein neuer Ankömmling am Tore oder im unteren Stockwerke sehen ließ, rief der erste, der ihn erblickte, mit lauter Stimme: "Frischer Fisch!" und sofort wurde der Ruf in allen Sälen wiederholt. Sobald der "frische Fisch" die Treppen erstiegen hatte, wurde er umlagert und mit den üblichen Fragen bestürmt: Welches Regiment? Welches Corps? Wo wurde er gefangen? Wie lautete sein Name? In vielen Fällen waren die "frischen Fische" durch den eigentümlichen Empfang so verdutzt, dass sie die mit hastiger Neugierde gestellten Fragen kaum beantworten konnten. Manchmal erfuhren wir von den neuen Ankömmlingen sehr interessante Dinge, doch oft auch nichts und dann wurde mit Naserümpfen bemerkt: "Der frische Fisch weiß nichts." Als die Neuen von Chickamauga kamen, gab es, wie bereits erwähnt, einen großen Fischzug, sodass alle Säle des "Libby" gefüllt waren und die zu ebener Erde befindlichen Räumlichkeiten nebst dem Keller uns zur Verfügung gestellt werden mussten. In den unteren Räumen wurde von dieser Zeit an gekocht. Ehe die Offiziere von Chickamauga kamen, waren bereits Gefangene, einzeln oder in kleinen Grüppchen, aus allen Richtungen eingetroffen, darunter auch die Offiziere der beiden Kanonenboote "Satellite" und "Reliance", welche am Ausflusse des Rappahannock River auf schmachvolle Weise den Rebellen in die Hände gefallen waren. Im unteren Mittelsaal, welcher nebst dem unmittelbar darüber gelegenen den Offizieren von Chickamauga eingeräumt wurde, befanden sich bis zum Spätherbst die Zivilisten, welche bei Gettysburg und an anderen Orten gefangen worden waren. Diese Leute waren der unmenschlichsten Behandlung ausgesetzt. Durch ein Loch im Fußboden, welches sorgsam verdeckt wurde, damit der Spürhund Turner es nicht auffinden konnte, hielten wir Kommunikation mit diesen armen Opfern der Rebellengrausamkeit. Sie erhielten fast gar keine Speise, oft nur ein wenig Reis- oder Bohnensuppe, in welcher sich zahllose Würmer befanden; sie litten Mangel an Wasser und wurden von Ungeziefer schrecklich geplagt. Alles, was sie besaßen, hatte man ihnen genommen, sodass sie nichts hätten kaufen können, selbst wenn ihnen dies gestattet gewesen wäre. Sie riefen uns oft dringend um Hilfe an und wenn wir konnten, ließen wir ihnen durch jene Öffnung Esswaren zukommen, namentlich Brot, welches jedoch in kleine Stücke zerschnitten werden musste, da die Öffnung im Fußboden nicht groß war. Später wurden die Armen forttransportiert, ich weiß nicht wohin; wahrscheinlich nach "Castle Thunder", einer weiteren Marterburg in der Nähe des "Libby", in welcher die grauenhaftesten Szenen sich ereignet haben sollen. Die Gesellschaft im "Castle Thunder" war eine sehr buntgemischte und bestand aus nordstaatlichen Zivilisten, südstaatlichen Unionsanhängern, Deserteuren, Schwindlern, Soldaten, welche das Ehrenwort ihrer Entlassung gebrochen hatten und dergleichen mehr. Auch Frauen waren im "Castle Thunder" eingesperrt. Kommandeur dieses Gefängnisses war ein gewisser Captain Alexander.
Im November begann es bereits, empfindlich kalt zu werden und wir suchten uns vor allem gegen den scharfen Luftzug zu sichern, welcher durch die Fensteröffnungen strich, in welchen weder Glas noch Rahmen sich befanden. Wir verhängten die Öffnungen, so gut es ging, mit Decken und alten Lumpen und hüllten uns nächtens, meistens ohne uns auszukleiden, in die Decken, welche uns die Rebellen gegeben hatten. Dennoch froren sehr viele, denn nur wenige hatten Decken aus dem Norden erhalten. Zu Ende des Jahres 1863 und in den ersten Monaten des Folgejahres war die Kälte in Richmond größer als wir erwartet hatten und an einigen Tagen nicht geringer als in Wisconsin oder Minnesota. Was unsere Heizungsapparate anbelangte, so befand sich in jedem Saale nur ein Ofen, welcher natürlich nicht hinreichende Wärme verbreiten konnte, selbst wenn wir Holz genug erhalten hätten. In diesem Punkte war Dick Turner überaus gemein; wir hatten Öfen, aber sehr oft kein Holz; man gab uns Rationen, aber wir konnten sie wegen Mangels an Holz nicht kochen. Am Weihnachtstage, unter anderem, an welchem es ziemlich kalt war, erhielten wir kein Stück Holz und das Fleisch, welches man uns lieferte, mussten wir bis zum nächsten Tage liegen lassen. Dies war Dick Turners Christbescherung. Anfangs wussten wir uns einigermaßen zu helfen, wenn das Holz mangelte, indem wir alte Bretter, Verschläge und sonstiges Holzwerk, das nicht niet- und nagelfest war, abrissen und verbrannten, aber nach und nach wurde auch diese Reserve erschöpft. In den Sälen hatten wir es uns so komfortabel wie möglich eingerichtet; aus den Brettern der aus dem Norden geschickten Kisten wurden Tische, Bänke und Stühle verfertigt und da wir auch Lichter bestellt hatten, so konnten wir die langen Abendstunden durch Lektüre und dergleichen kürzen. Einige, die gute Stimmen hatten, gaben Lieder zum Besten, aber sehr viele, die keine Stimme besaßen, sangen auch. Das Repertoire war freilich kein großes, aber dies bedeutete nichts; man lauschte einem und demselben Liede hundert Male. Ein Quartett-Club, dessen erster Tenor beim Singen ein sirupsüßes Gesicht machte und dessen zweiter Bass, ein Schulmeister aus Pennsylvania, mit großer Gravität dirigierte, sang meistens geistliche Lieder und Hymnen. Hatten diese Quartettsänger ihre heilige Begeisterung ausgehaucht, so begann ein anderer, einen Negergesang oder ein irisches Lied zu singen, dessen Refrain die ganze Gesellschaft wiederholte und zwar in der Regel in ohrenbetäubender Weise. Ich glaube, dass Satan in der Hölle keine schöneren Konzerte hat als sie unsere Stimmband-Akrobaten im "Libby" veranstalteten. Wäre ein talentierter Komponist zugegen gewesen, so hätte er diese Klangwirkungen studieren und später anwenden können, um die Wolfsschlucht-Musik und die Dissonanzen im Fliegenden Holländer vollständig in den Schatten zu stellen. Auch ein Orchester hatte sich gebildet, dessen Hauptinstrumente ein Banjo, eine Gitarre, eine Flöte, eine Violine und eine Handtrommel waren, wozu später ein Kunstfertiger noch einen Triangel aus alten Eisenstäben fertigte, der zwar die ungefähre Form, aber nicht den Ton eines Triangels besaß. Solche kleinen Übelstände konnten indessen nicht genieren und es wurde wacker darauf los gegeigt, gepfiffen und geschlagen, sodass Lanner und Bellini, welche die Lieblingskomponisten dieser Kapelle waren, gewiss im Olymp ihre Freude daran hatten. Ferner organisierte sich eine Gesellschaft von sogenannten "Minstrels", die in kurzen Zwischenräumen mehrere Vorstellungen gab, welche die amerikanischen Offiziere besonders amüsierten. Die Darsteller, natürlich mit schwarzgefärbten Gesichtern und Händen, gaben außer einigen Instrumental- und Gesangsstückchen kleine Possen, sogenannte Farcen, zum Besten, welche den komischen Stücken der professionellen "Minstrels" nachgebildet waren und manche schlechte Witze und derbe Anspielungen enthielten, die für ein Publikum von Damen kaum zulässig gewesen wären. Die Amerikaner liebten indes diese Farcen und Burlesken und vergnügten sich herzlich an den possenhaften Situationen und derben Späßen, sowie an den den Negern abgeschauten, aber etwas übertriebenen Grimmassen und Tänzen. Die "Minstrels" fanden den größten Beifall bei den Insassen des "Libby" und wenn sie schließlich ihre Vorstellungen einstellten, so lag der Hauptgrund in der Schwierigkeit, neue Stücke zu erfinden und Variation in das eintönig gewordene Repertoire zu bringen. Auch wurde der Muse des Tanzes gehuldigt, oft drei- oder viermal in einer Woche, gewöhnlich abends. Nicht selten ereignete es sich, dass unmittelbar nach Beendigung einer religiösen Andachtsstunde die Tanzunterhaltung begann oder dass in einem Saale getanzt, während in einem anderen gebetet wurde. Das "Libby" war eine kleine Welt für sich; in dieser Ecke saßen drei oder vier bei einem Whist-Spiel, in jener studierte einer in einem geistlichen Buche; hier saß eine Gruppe, das gemeinsame Schicksal oder die Austauschfrage mit Eifer und Ernst diskutierend, dort amüsierten sich andere an lustigen Anekdoten, deren der Amerikaner unzählige kennt; in diesem Saale wurde ein sogenannter "Raubzug" veranstaltet, das heißt eine Anzahl von jüngeren Offizieren, welche zu ausgelassenen Streichen immer aufgelegt waren, bildeten, in Einzelreihe hintereinander mit verschlungenen Händen stehend, eine Schlange und stürmten dann auf ein gegebenes Signal hin in vollem Galopp durch den Saal, nicht allein in den freigelassenen Gängen, an deren Seiten unsere Lager- und Sitzplätze sich befanden, sondern auch über Stühle, Tische und Kisten hinweg, alles vor sich niederwerfend und lärmend und tobend wie die wilde Jagd; in einem anderen Saale wurde über gute Sitten und christliches Betragen gepredigt; tiefer Ernst weilte neben leichtem Scherz, tolle Lustigkeit neben trüber Melancholie.
Die erwähnten Vorstellungen fanden in der zu ebener Erde gelegenen, geräumigen Küche statt, welche auch zum Auf- und Abgehen benutzt wurde. Wenn es kalt war und wir kein Holz erhalten hatten, wurde eine viergliederige Reihe gebildet und ein gesunder "Sturmlauf" veranstaltet, welchen oft der alte General Neal Dow anführte. In der Küche war es vom Morgen bis zum späten Abend sehr lebhaft; in aller Frühe begann das Kochen und mit Ausnahme weniger Stunden waren immer Leute vor den Öfen zu finden, welche damit beschäftigt waren, ihre oft sehr einfachen Gerichte zuzubereiten. Das frühere Arrangement, wonach die sogenannten "Messen" zusammen der Reihenfolge gemäß kochten, war aufgegeben worden, weil uns die Rebellen die anfangs gelieferten Rationen nicht mehr zukommen ließen und es kochte jetzt jeder nach seinem eigenen Belieben oder mehrere fanden sich zu einer "Privatmesse" zusammen. Früh morgens wurde meistens nur Kaffee gekocht; viele hatten aus dem Norden guten Kaffee erhalten, andere kochten ein aus Roggen bereitetes Surrogat, welches damals im Süden gang und gäbe und für zwei bis drei Dollars pro Pfund zu haben war, während diejenigen, die weder eine Kiste erhalten, noch Geld hatten, auf gebranntes Maismehl angewiesen waren. Die Rationen wurden mit jedem Tage erbärmlicher und namentlich wurde uns hier und da Fleisch geliefert, welches man keinem Hunde vorsetzen würde. Im Januar 1864 erhielten wir Fleisch, welches viele für Mauleselfleisch hielten (was es vielleicht auch war) obschon andere es für das Aas verendeter Tiere erklärten. Diese Vermutung mag richtig gewesen sein, denn zu derselben Zeit lasen wir in den Zeitungen, dass eine Herde Vieh auf der Eisenbahn von Danville nach Richmond in den Wagen vor Hunger und Kälte umgekommen sei. Es war durchaus nicht unwahrscheinlich, dass man das Fleisch dieser Tiere den Gefangenen gab. Zuweilen wurde uns auch eingesalzenes Fleisch geliefert, welches aber ebenso wenig zu gebrauchen war; es war hart, zäh und über alle Maßen salzig, sodass es, gekocht oder gebraten, nicht genießbar war. Den ärmsten unserer Genossen blieb nichts übrig, als die kleine Ration von Reis oder Bohnen in Wasser, ohne irgendwelchen Schmalz, zu kochen. Diese elende Suppe, nebst einem Laib Maisbrot, war ihre einzige Nahrung, wenn nicht einer der Bessergestellten ihnen zuweilen mit einer Kleinigkeit aushalf. Einzelne und namentlich die "königliche Familie" lebten im Überfluss; am Weihnachtsabend hatten sie eine vorzügliche Mahlzeit, welche gleichsam zum Hohne für die anderen, auf einer Tafel in der Küche aufgestellt war. Sie hatten ziemlich alles, was auf dem Markte von Richmond zu haben war und schmatzten vergnügt, während andere mit hungrigem Magen sich auf ihr hartes Lager begaben.
An den Öfen war, wie bereits angemerkt, immer ein geschäftiges Leben und es fehlte auch nicht an komischen Szenen: Dem Einen gelang es nicht, das in der Regel nasse Holz zum Brennen zu bringen; er schnitzte kleine Stücke, setzte sie in Brand und blies dann aus Leibeskräften, um das im Ofen aufgesetzte Holz zu entfachen, aber trotz aller Bemühungen entwickelte sich nichts als Rauch aus dem glimmenden, nassen Kiefernholze. Ein zweiter war ungeschickt genug, seinen eigenen oder den Kessel eines anderen umzustoßen, wovon die Folge ein trauriges Gesicht oder eine laute Verwünschung war. Einem dritten passierte das Malheur, dass, als er, das Geschirr mit dem zubereiteten Mahle in der Hand, die in das obere Stockwerk führende Treppe hinaufstieg, er auf derselben ausglitt und den Kessel verlor, welcher mit lautem Gepolter die Treppe hinabstürzte; die Mahlzeit war zunichte gemacht und diejenigen, welche das Unglück sahen, waren unbarmherzig genug, zu lachen. Es ist schlimm, wenn ein Hungriger seine Mahlzeit verliert, namentlich dann, wenn er nichts hat, um dieselbe zu ersetzen. Der Hungrige steht dann wie vernichtet vor der auf dem Fußboden liegenden Speise und blickt mit rührender Wehmut auf das unwiederbringlich Verlorene. Dem Hungrigen geht dies sehr nahe, sein Nachbar lacht darüber.
Die Küche war sehr oft mit Rauch ganz angefüllt, sodass es eine Pein war, in derselben zu kochen. Mehrmals mussten wir stundenlang in diesem Rauche bleiben, wenn nämlich genaue Abzählung gehalten werden sollte. In diesem Falle mussten alle die Säle verlassen und sich in die Küche begeben. Nachdem die Beamten sich überzeugt hatten, dass keiner zurückgeblieben war, wurde das Namensverzeichnis verlesen und jeder hatte, nachdem sein Name aufgerufen worden war, sich in die Säle zurückzubegeben. Ein solcher Anwesenheitsappell war überaus langweilig und der Rauch erhöhte die Unbehaglichkeit. Die Küche diente ferner als Fechtsaal. Eine Anzahl von Offizieren hatte sich Säbel aus Holz angefertigt und übte sich im Fechten. Auch die Rationen wurden in der Küche ausgeteilt. Eine Türe führte aus derselben direkt auf die Straße, war aber nur einige Stunden des Tages geöffnet und in diesem Falle natürlich bewacht.
Wären die Esswaren, welche die Sanitätskommission uns schickte, gerecht verteilt worden, so hätte mancher von uns nicht zu hungern brauchen. Jene Gesellschaft, welche viel Gutes tat und an allen Orten zur Linderung der Leiden unserer verwundeten, kranken und gefangenen Soldaten wesentlich beitrug, sendete uns große Mengen von Kleidungsstücken und Esswaren, deren Verteilung die Rebellen-Beamten der "königlichen Familie" übertrugen. Wenn aber jemals Ungerechtigkeiten begangen wurden, so geschahen sie bei dieser Verteilung. Manche, welche die Günstlinge der "Familie" waren, erhielten im Überfluss und andere nichts; wer keinen Freund in der "Familie" hatte, ging leer aus. Es galt unter uns als eine ausgemachte Tatsache, dass die Rebellen-Beamten des "Libby" einen Teil der Sendungen der Sanitätskommission erhielten und dass die "Familie" selbst sich am reichlichsten bedachte, namentlich mit Esswaren. Als Agent der "Familie" fungierte ein gewisser Captain Forbes, welcher in strikter Übereinstimmung mit den Instruktionen von Sanderson und dessen Spießgesellen handelte und sich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, arrogant gegen diejenigen benahm, welche sich nicht des Schutzes oder der Empfehlung eines Mitgliedes der "Familie" zu erfreuen hatten. Letztere stellte sich so an, als ob sie es sei, welche die Waren geliefert habe. Es grämte uns arg, dass der gute Zweck, welchen die Sanitätskommission im Auge hatte, auf diese Weise zum Teil vereitelt wurde. Wir hatten schon früher bei anderen Gelegenheiten die Beobachtung gemacht, dass es bei der Verteilung der Waren nicht mit rechten Dingen zuging und im "Libby" hatten wir nur ein weiteres flagrantes Beispiel. Fast bei allen wohltätigen Unternehmungen wissen sich korrupte, unsaubere Burschen heranzudrängen und sich in die Verwaltung einzuschleichen, um ihrer angeborenen Unehrlichkeit ein neues Feld zu öffnen oder um Gelegenheit zu haben, ihre erschlichene Autorität fühlen zu lassen.
Wie im "Libby", so waren auch unter der Bevölkerung von Richmond Teuerung, Not und Hunger an der Tagesordnung. Fast täglich versammelten sich Kinder und Erwachsene vor dem "Libby", um ein Stück Maisbrot von uns zu erhalten. Der Ärmere bettelte bei dem Armen. In der Stadt war freilich die Ansicht verbreitet, dass wir mindestens hinreichende Lebensmittel hätten, denn die Lügenzeitungen ließen keine Gelegenheit vorübergehen, ohne dem Publikum das Märchen aufzutischen, dass das Kommissariat uns bestens verpflege und dass unsere Freunde im Norden uns außerdem die reichsten Vorräte sendeten. Der "Examiner" erzählte eines Tages mit der größten Unbefangenheit, dass das "Libby" zwar ein Gefängnis sei, in Bezug auf die Verpflegung der Gefangenen aber einem guten Hotel keineswegs nachstehe, denn die Gefangenen hätten Überfluss nicht nur an gewöhnlichen Nahrungsmitteln, sondern auch an den ausgesuchtesten Delikatessen. Ein anderes Mal wurde darauf hingewiesen, dass es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sei, die gefangenen "Barbaren", welche den heiligen Boden des Südens widerrechtlich betreten hätten, um zu plündern, zu sengen und zu brennen und die Unschuld der südstaatlichen Damen zu gefährden, human zu behandeln und gut zu füttern, während die konföderierten Soldaten, welche die Freiheit des Südens und die Sicherheit des häuslichen Heeres verteidigten, in schlechter Kleidung am Rappahannock River und in Tennessee lagern und darben müssten. Diese öfter wiederkehrenden Äußerungen der Presse mochten viele zu der Meinung geführt haben, dass das "Libby" eine große Vorratskammer sei und wir im Überfluss schwelgten. Dass die Teuerung und Not in Richmond groß war, erfuhren wir umständlich von den Wachen, mit welchen einzelne von uns des Abends von den Fenstern der Küche aus verstohlen sprachen. Sie erzählten, dass die meisten von ihnen kaum genug erhielten, um ihr eigenes Leben zu fristen, während ihre Familien geradezu dem Elend preisgegeben seien. Die Wachen nahmen gern Brot von uns und einige durstige Offiziere tauschten mit ihnen Maisbrot gegen schlechten Apfelbranntwein, dessen schlimme Wirkungen bei den Betroffenen nicht ausblieben. Auch die Zeitungen konnten, obschon sie über unangenehme Dinge nicht gern zu sprechen pflegten, nicht umhin, gelegentlich die herrschende Teuerung, die armseligen Finanzverhältnisse des Südens überhaupt und den Schaden und die Verluste zu erwähnen, welche die Konföderation durch den Krieg erlitten hatte. Was sie als eine ganz besondere Kalamität ansahen, war, dass so viele Neger mit ihren "heuchlerischen Freunden" auf und davon gingen, wodurch die Arbeitskraft vermindert und der Weiße gezwungen wurde, selbst zu arbeiten, wenn er sein Leben erhalten wollte. Im "Examiner" vom 7. Dezember '63 war eine Mitteilung über Suffolk enthalten, in welcher besonders hervorgehoben wurde, "dass die weißen Herren und Damen alle Arbeit verrichten müssten, welche früher von den Dienstboten verrichtet wurde." Wäre nicht die bleiche Not bei diesen "Damen und Herren" erschienen, so hätten sie gewiss nicht zur Arbeit gegriffen, denn Arbeit war nach den Begriffen der Südstaatler eine Schande, namentlich solche Arbeit, welche zuvor von den Negern verrichtet worden war. "Not lehrt beten" heißt es im alten deutschen Sprichwort, aber im Süden heißt es: "Not lehrt arbeiten".