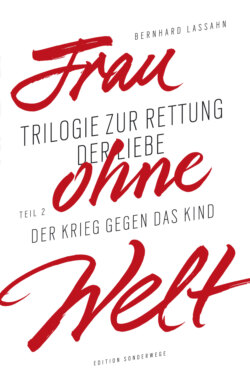Читать книгу Frau ohne Welt. Teil 2: Der Krieg gegen das Kind - Bernhard Lassahn - Страница 5
Non-Stop-Sex-Party
ОглавлениеDie Lesung war vorbei, der Schulbus war noch nicht da, die Kinder – es waren Schüler der dritten Klasse – hatten noch ein wenig Zeit. Sie durften sich auf eigene Faust in der Bibliothek umsehen und nach Büchern Ausschau halten, die sie vielleicht ausleihen wollten. Plötzlich wurde es laut. Einige Kinder kreischten:
»Iiih, nackte Bücher!«
Sie hatten beim Blättern blasse Buntstiftzeichnungen entdeckt, die Nackte darstellten. Ohne dass es ihnen bewusst war, hatten die Kinder mit ihrem Aufschrei »Iiih, nackte Bücher« eine überraschend gute Formulierung für den Stellenwert gefunden, den Sexualität heute für uns hat. Sie machten schreiend deutlich, was für ein Menschenbild wir haben.
Die Formulierung ist natürlich nicht korrekt. Die Kinder haben denselben Fehler gemacht, den wir machen würden, wenn wir von einem »dreistöckigen Hausbesitzer« sprächen – der Hausbesitzer selber ist nicht dreistöckig, und die Bücher sind nicht nackt. Die Kinder wollten auch nicht darauf hinweisen, dass irgendwo Bücher ohne Schutzumschläge herumlägen. Sie verrieten etwas anderes: Für sie war Nacktheit nicht etwas, was in gewissen Büchern vorkommt, sondern etwas, was diese Bücher durch und durch kennzeichnet.
Den gleichen Fehler machen wir, wenn wir von einer »Männersprache« reden oder von einer »männlichen Gesellschaft«. Unsere Sprache ist keine Männersprache. Und die Gesellschaft ist nicht männlich. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es Männer gibt. Das ist selbstverständlich, das muss nicht extra erwähnt werden.
Es soll etwas anderes damit gesagt werden: Mit der Verkürzung auf »männliche Gesellschaft« machen wir eine Aussage darüber, welche Rolle die Männer in dieser Gesellschaft vermeintlich spielen. Wir unterstellen, dass Männer aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit die Gesellschaft – oder die Sprache – so stark dominieren, dass damit alles andere, was man sonst noch über sie sagen könnte, in den Schatten gestellt wird. So haben auch die Kinder gedacht, als sie von »nackten Büchern« sprachen: Sie meinten eigentlich Bücher, in denen es Zeichnungen von Nackedeis gibt. Doch das war für sie so überwältigend, dass alles andere zweitrangig, ja sogar nichtig wurde.
So wie die Kinder diese Bücher sehen, so sehen wir heute den Menschen, als würden wir alle auf der Reeperbahn leben und hätten es mit einer Non-Stop-Sex-Party zu tun. Auch wenn wir nur ein Konto eröffnen oder einen Text schreiben wollen, in dem es gar nicht um Sex geht, immer sollen wir »geschlechtersensibel« handeln und in allen Lebenslagen berücksichtigen, dass es Männlein und Weiblein gibt – als wüssten wir es nicht.
Stellen wir uns vor, jemand würde bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit seine Essensgewohnheiten erwähnen und sagen: »Ich möchte gerne eine Fahrkarte kaufen. Ich bin übrigens Vegetarier.« Oder: »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Ich bin übrigens Vegetarier.«
So sollen wir uns verhalten.
Die allumfassende Sexualisierung ist zum obersten Gebot geworden. Doch die Überbetonung schlägt schnell in ihr Gegenteil um und führt zur Banalisierung. Wir werden ständig mit Reizen traktiert und stumpfen ab, je mehr die Sexualität aus den Zusammenhängen von Liebe und Fortpflanzung gelöst wird und nur noch kleine Vergnügungen übriglässt, die mehr und mehr an Bedeutung verlieren, so dass wir ohne Sehnsucht zurückbleiben wie Überlebende, denen man alles genommen hat und die längst emotional pleite sind.
Dennoch: Sex soll unser ein und alles sein.
Schon der Sprachgebrauch soll unsere Anpassung an die Zwangssexualisierung ausweisen: Bei jeder Pluralbildung sol len wir die Doppelnennung (Leserinnen und Leser) oder das Binnen-I (LeserInnen) verwenden. In der Schule gibt es heute keine Schüler mehr, sondern »SuS« (Schülerinnen und Schüler). Wir sollen auch das sogenannte generische Maskulinum (die Leser) meiden und stattdessen von Lesenden sprechen. Deshalb gibt es an unseren Universitäten keine Studenten mehr, sondern, obwohl sachlich falsch, nur noch Studierende, denn alles, was einen männlichen Beiklang hat, soll aus dem Sprachgebrauch und aus unserem Bewusstsein vertrieben werden.
Wir sollen so reden, als wäre unser Selbstverständnis dermaßen stark von unserer Geschlechtszugehörigkeit bestimmt, dass alles andere nicht mehr zählt. Als wären wir so gründlich von der Geschlechterfrage durchdrungen und durchfeuchtet wie eine Packung Papiertaschentücher, die versehentlich in die Waschmaschine geraten ist.
So ist es heute bei den Erwachsenen. Ist es bei Kindern, die noch nicht geschlechtsreif sind, auch so? Sind sie auch oversexed?
Als Sigmund Freud unterstellte, dass schon kleine Kinder ein – wenn auch verdrängtes – Interesse an Sex hätten, wurde er heftig angefeindet. Gerade von feministischer Seite wurde ihm vorgeworfen, dass er damit die Kinder verraten und den Päderasten ein Einfallstor geöffnet hätte. Von nun an würde Missbrauch als normal angesehen werden können. Freud, so meinten sie, hätte sich mit seinen Überlegungen mit Kinderschändern verbündet und auf ihre Seite geschlagen; denn die könnten nun behaupten, dass die Kinder eine sexuelle Begegnung genauso gewollt hätten wie sie selbst. Sie könnten sich problemlos auf »einvernehmlichen« Sex berufen.
Bei Freud war das noch Theorie, Spekulation. Alfred Kinsey ging einen Schritt weiter. Er wollte den Beweis erbringen, dass es eine frühkindliche Sexualität tatsächlich gibt, und legte dazu den Kinsey-Report vor, der aus zwei Bänden besteht: Sexual Behavior in the Human Male (1948) und Sexual Behavior in the Human Female (1953). Kinsey gilt bis heute als Pionier der sexuellen Revolution. Er hat in der Tat eindrucksvolle Zahlen in die Welt gesetzt, die sich zwar später als gigantischer Schwindel herausstellten, was aber seinem Ruhm nicht geschadet hat. Sein Report gilt nach wie vor als Grundlagenwerk.
Kinsey hat sich speziell für die Orgasmusfähigkeit von Kindern interessiert. Besonders die kleinen Jungs hatten es ihm angetan, die ganz kleinen, die Babys. Sie alle wurden bei ihm unter »male« subsumiert – also unter »männlich« –, ohne dass sie dafür ein Mindestalter haben mussten. Er unterstellte, dass sie wie Erwachsene zum Orgasmus, ja sogar zum multiplen Orgasmus kommen könnten. Eben das wollte er mit seinen Forschungen belegen. Indirekt war damit aber noch etwas anderes gesagt: Wenn Kinder zu Orgasmen kommen können, dann sollten sie sie auch haben.
An dieser Stelle kann man leicht einem wissenschaftstheoretischen Fehlschluss erliegen. Vielen, die mit statistischem Material arbeiten, ergeht es so. Man muss jedoch immer berücksichtigen, dass der Ist-Zustand noch nichts über den Soll-Zustand aussagt.
Wenn wir Fliegenbeine oder Erbsen zählen und schließlich wissen, wie viele es davon gibt, heißt das noch lange nicht, ob es mehr oder weniger davon geben sollte. Solche Fragen stehen immer außerhalb der Versuchsanordnung. Zahlen sind buchstäblich »nackt«. Sie sagen uns nicht, wie wir mit ihnen umgehen sollen.
Was wollte Kinsey mit seinen imposanten Zahlen zeigen? Für ihn war die behauptete Orgasmusfähigkeit eine Art Goldmine, die man unbedingt ausbeuten müsse. Das tat er dann auch.
Schon Säuglinge im Alter von fünf Monaten, so behauptete er, könnten wiederholte Orgasmen erreichen. In den berühmt gewordenen Tabellen (englisch tables) 30–34 präsentierte er Daten zur Orgasmusfähigkeit von insgesamt 317 männlichen Säuglingen und Kindern – wie beispielsweise in table 34 (aus Sexual Behavior in the Human Male, S. 180). Daraus kann man ersehen, dass ein elf Monate alter Säugling innerhalb von 38 Minuten 14 Orgasmen hatte, ein zweijähriges Kleinkind sieben Orgasmen in neun Minuten. Die Zahlen machen den Eindruck, als wollte jemand einen Rekord aufstellen. Genau darum ging es Kinsey. Das Maximum an Orgasmen, das Kinsey beobachten konnte, waren 26 Höhepunkte in 24 Stunden bei einem vierjährigen Jungen. Doch selbst das war ihm noch nicht genug. Kinsey spekulierte, dass in derselben Zeiteinheit noch mehr Orgasmen möglich gewesen wären.
Er hatte den Ehrgeiz, möglichst imposante Zahlen zu präsentieren, doch nur »32 Prozent der Jungen im Alter zwischen zwei bis zwölf Monaten kamen zum Höhepunkt«, wie er bedauernd einräumen musste, und er beklagte, dass es »einige« präadoleszente Jungen gäbe, »… die den Höhepunkt selbst unter anhaltender, verschiedener und wiederholter Stimulation nicht erreichten«. Dennoch blieb er davon überzeugt, dass eine bis dahin unentdeckte Orgasmusfähigkeit existiere: »Es ist sicher, dass ein noch höherer Anteil der Jungen multiple Orgasmen hätte haben können (…). Sogar die jüngsten Säuglinge, fünf Monate alt, sind zu solch wiederholten Reaktionen in der Lage.«
Seine Zahlen werfen verschiedene Fragen auf. Was bedeutet es für ein zehnjähriges Kind, wenn es 24 Stunden lang, wie in der Tabelle aufgeführt, pausenlos unter Beobachtung steht? Was für eine Art von Beobachtung wird das gewesen sein? Wie lange – und auf welche Art? – wurden Jungen stimuliert, bis man schließlich zu dem Ergebnis – besser gesagt: zu der Einsicht – kam, dass sie doch keinen Orgasmus haben können? Es sind immerhin 68 Prozent der Jungen, die getestet wurden, also gut zwei Drittel; denn, wie beschrieben, nur 32 Prozent von ihnen hatten einen Orgasmus. Einen Orgasmus?
Kinsey unterscheidet sechs verschiedenen Orgasmustypen, die er im Detail beschreibt. Er beobachtet beispielsweise: »Extreme Spannung mit heftiger Konvulsion. Oft mit plötzlichem Heben und Werfen des ganzen Körpers verbunden.« Außerdem stellt er fest, »dass die Beine oft steif werden, wobei die Muskeln kontrahiert und hart sind, Schultern und Nacken steif und oft nach vorn gebeugt, der Atem angehalten wird oder keuchend ist, die Augen starr sind oder fest geschlossen, die Hände klammernd, der Mund verzerrt, wobei manchmal die Zunge hervordringt, der ganze Körper oder Teile in spastische Zuckung geraten.« Er erkennt, was er einen Orgasmus nennt, »zuverlässig« an schwerem Atem, am Seufzen, am Schluchzen oder an heftigem Schreien und – besonders bei kleinen Kindern – an Tränenausbrüchen.
Der Orgasmus, den Kinsey erforschte, war mit Schmerzen verbunden.
Kinsey war Sadist und Masochist, er hat unzählige Kinder gequält oder quälen lassen, und er hatte sein Vergnügen daran. Er hat sich selbst schwere Verletzungen im Genitalbereich zugefügt, an denen er möglicherweise verstorben ist (offiziell wurden Herzleiden und Lungenentzündung als Todesursache angegeben).
Woher hatte er seine Versuchspersonen? Einer seiner Zulieferer, der ihn über viele Jahre mit »Material« versorgte, war Friedrich Karl Hugo Viktor von Balluseck, der als Nazioffizier Kreishauptmann von Jędrzejów und verantwortlicher Kommandant des dortigen Ghettos war.
Markus Roth, der über die Besatzungszeit geschrieben hat, zeigt in seinem Buch Herrenmenschen – die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen (2009), dass keiner der ehemaligen Kreis- und Stadthauptleute später verurteilt wurde, manche sogar in der späteren Bundesrepublik in hohe Ämter gelangen konnten. Diese Herrenmenschen fühlten sich als Auserwählte, die oft eigenmächtig ohne »Befehl von oben« handelten. Sie fühlten sich gesandt, die deutsche »Mission« im Osten zu erfüllen.
Weit weg von der Heimat, umgeben von einer Bevölkerung, die sie als minderwertig ansahen, konnten sie schalten und walten wie Tyrannen. Sie bereicherten sich, wo immer sie konnten; Frauen und Mädchen – auch Kinder – waren für sie Freiwild. Schon damals war bekannt, dass von Balluseck Kinder sexuell missbrauchte und ihnen drohte: Entweder ich oder die Gaskammer.
In Jędrzejów überlebte kein einziges jüdisches Kind. Auch nach dem Krieg missbrauchte von Balluseck Kinder, sogar seine eigene Tochter, und zwang sie, ihre sexuellen Erfahrungen aufzuschreiben – für Kinsey. Im Jahre 1957 stand er in Berlin wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht und erklärte, dass Kinsey ihn gebeten hätte, solche Berichte zu verfassen.
In Deutschland wurde über den Fall berichtet, in den USA nicht. Kinsey überstand alle Skandale und Angriffe. An seiner Bedeutung hat sich nichts geändert – nicht dadurch, dass sein Doppelleben aufgeflogen ist, nicht dadurch, dass von kriminellen Machenschaften berichtet wurde, und auch nicht dadurch, dass sich die Ergebnisse seiner Forschungen als von – gelinde gesagt – zweifelhaftem Wert erwiesen haben. Mit dem Film Kinsey – die Wahrheit über Sex (freigegeben ab 12 Jahren) wurde ihm im Jahre 2004 symbolisch ein Denkmal gesetzt. Nach wie vor ist er der berühmte »Dr. Sex«.
Kinsey hat Kinder so gesehen, wie die Kinder in der Bibliothek »nackte Bücher« gesehen haben: als durch und durch von Sex bestimmte Lebewesen, als sexual beings by birth.
So sah er Kinder. Wie sah er Frauen?
Zu seiner Zeit war es nicht leicht, an Daten zu kommen, die die »Wahrheit« über Sex enthüllen konnten. Kinseys besonderes Verdienst wird gerade darin gesehen, dass es ihm trotzdem gelungen sei. Er hatte, wie wir gesehen haben, keine Hemmungen, wenn es darum ging, sich Daten über Jungs zu beschaffen. Bei Daten zu Frauen schon. Mehr noch, in Kinseys Statistiken taucht keine einzige verheiratete Frau auf, die gleichzeitig Mutter ist. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass es in dem von Kinsey gegründeten Institut für Sexualforschung ursprünglich »Ehevorbereitungskurse« geben sollte, also Beratungen für junge Ehen und Familien. Der Soziologe Geoffrey Gorer, einer seiner besonders scharfen Kritiker, schreibt: »Es ist fast nicht zu fassen, aber dennoch wahr: Schwangerschaft, Geburt und Stillen von Kindern sind komplett außer acht gelassen. Für Dr. Kinsey hat Mutterschaft keinerlei Verbindung mit Sexualität.«
»Baby da, Lust weg?« So stand es vor einiger Zeit in der Bild-Zeitung. Im Film Harry und Sally werden schon im voraus die möglichen Widrigkeiten eines Zusammenlebens erörtert, ehe die beiden sympathischen Helden am Ende erwartungsgemäß zusammenkommen. Sallys Befürchtungen klingen so, als hätte sie die Bild-Zeitung gelesen: Mit einem Kind könnte das Sexleben aufhören und damit das, was sie als Grundlage des Zusammenlebens, als das Wichtigste in ihrem Leben ansieht, als etwas, was nicht gefährdet oder auch nur vorübergehend zurückgestellt werden dürfe. Ziel aller Sehnsüchte solle sie selber bleiben, ewig jung und kerngesund – eine Attraktion voller sexueller Lockstoffe.
Eine berauschende Liebesnacht mit ihr soll die »Endstation Sehnsucht« sein, wie der deutsche Titel des Dramas von Tennessee Williams A Streetcar Named Desire lautet (in New Orleans gab es tatsächlich eine Straßenbahnlinie mit der Endhaltestelle »Desire«). Der sexuelle Höhepunkt wäre nicht etwa ein »Unterwegsbahnhof«, wie in ICE-Durchsagen immer die Zwischenstationen genannt werden, sondern schon das Ziel.
Aber sobald »diese Liebeserwartungen zum primären Motiv des Sichfindens und der Heirat der Ehepartner werden«, mahnte Helmut Schelsky schon 1955 in seinem Werk Soziologie der Sexualität, »muß ein Familienleben (…) diese Ansprüche enttäuschen«. Die »ursprüngliche Gemeinsamkeit der erotischen Erlebniswelt« reiche nicht aus. Sex allein, und sei es noch so »guter Sex«, kann nicht der Klebstoff sein, der eine Ehe zusammenhält. Erst recht nicht, wenn die Bedeutung der sexuellen Erfüllung überstrapaziert wird. Es muss noch etwas hinzukommen; im Alter muss etwas anderes an die Stelle der Sexualität treten können. Wenn es nicht Tradition, Sitte und Gesetz sind, dann ist es für Schelsky die gegenseitige Fürsorge.
Die Tragik heutiger Liebesbeziehungen liegt darin, dass die Fürsorge für Kinder und die Fürsorge füreinander im Alter von der Gesellschaft immer geringer gewürdigt, die Bedeutung der Sexualität hingegen immer höher veranschlagt wird.
In dem Lied Have You Ever Really Loved a Woman von Bryan Adams heißt es, dass der schmachtende Liebhaber bereits die ungeborenen Kinder – »unborn children« – in den Augen der Frau erkennt. Es passt eigentlich nicht zu dem Film Don Juan DeMarco, für den der Song geschrieben wurde, denn ein Don Juan (der sowieso nur eine fiktive Figur ist) will nicht eine Frau lieben, sondern möglichst viele besitzen und in deren Augen auch nicht nach ungeborenen Kindern Ausschau halten.
»Eine Mutter wird geboren, die Frau stirbt?« So dramatisch – wenn auch mit Fragezeichen – wird es in der Rheingold-Studie für die Firma Milupa beschrieben, die der »deutschen Angst vorm Kinderkriegen« auf die Spur kommen will und nachfragt, worin sie denn begründet sei. Da wird erwartungsgemäß die Sorge genannt, dass das »liebe Geld« nicht ausreichen könnte. Doch auch die Angst vor dem Rollenwechsel sei groß. Frauen verhielten sich nach der Geburt eines Kindes wie multiple Persönlichkeiten. »Einerseits möchten sie voll und ganz Mutter sein, andererseits aber auch als Frau keine Veränderungen zulassen und die attraktive Lebenspartnerin bleiben, die selbstständig ihren Weg geht, so als hätte sie gar kein Kind.«
Da die Frauen nicht willens oder fähig sind, in diesem Konflikt klare Prioritäten zu setzen, heißt das: Das Kind stört. Es ist der Mutter im Weg, die sich von ihrer alten Rolle nicht trennen mag, bei der es in hohem Maße um Sex und um sexuelle Attraktivität ging. Die Schlagzeile aus der Bild-Zeitung kann man auch umdrehen. Dann erkennen wir die heimliche Leitlinie unseres Lebens: »Lust da, Baby weg!« Hauptsache, wir haben unser Vergnügen.
Wenn man den Schlagerweisheiten glaubt, dann wollen Frauen sowieso »nur spielen«, sie wollen »fun«, wie es bei Cindy Lauper heißt, die fröhlich verkündet, was »girls« in Wirklichkeit wollen, »fun« nämlich, »that’s what they really want«. Sie wollen bloß ihr Vergnügen. Mehr nicht. Jedenfalls in der Freizeit.
Was wollen sie in der Politik? Auch das Vergnügen. So sieht es auf den ersten Blick aus. Doch wollen sie das wirklich? Die Journalistin Dale O’Leary war nicht nur auf der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, sie war auch bei den Vorbereitungstreffen, sie hat sich die Referate angehört, sie hat hinter die Kulissen geschaut und hat versucht herauszukriegen, was mit The Gender Agenda – so auch der Titel ihres Buches von 1997 – angestrebt wird; sie wollte wissen, was die mächtigen Frauen des Gender-Establishments wirklich wollen. Das Motto der Konferenz in Peking lautete bekanntlich »Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden« – wer könnte dagegen sein? Es klingt, als wäre es von Herzen gut gemeint und letztlich harmlos.
Doch was wollen diese Frauen wirklich?
Dale O’Leary hat es zu fünf programmatischen Forderungen zusammengefasst, die das Programm des sogenannten Gender Mainstreaming erklären, das mit der 4. Weltfrauenkonferenz in die Welt gesetzt wurde. Dabei taucht immer wieder die Formulierung »die Welt braucht« auf. Das erinnert womöglich so manchen Alt-Hippie an den Song What the World Needs Now, in dem es heißt, dass die Welt vor allem Liebe brauche, »love, sweet love«. Aber um Liebe geht es nicht. Es geht um das Vergnügen, das uns winkt, wenn wir die Postulate des Gender Mainstreaming umsetzen.
Die Forderungen wirken in ihrer Maßlosigkeit so abwegig, dass man leicht verleitet wird, sie nicht ernst zu nehmen. Nimmt man sie jedoch ernst, erkennt man schnell eine finstere Anti-Utopie: Wir erkennen die Zerstörung der Familie und der Liebe; die fünf Punkte sind eine Beschreibung eines Endstadiums der Menschheitsgeschichte und eine verdeckte Kriegserklärung gegen Kinder.
Bei Dale O’Leary liest es sich so:
1.In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeit-Mütter.
2.Da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt.
3.In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt; es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder.
4.Die Welt braucht eine 50/50-Männer/Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen.
5.Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden.
Nun will ich auch einen Satz bilden, in dem ein »müssen« vorkommt: Wir müssen aufhören, das lediglich für eine abseitige Spinnerei zu halten, die uns nicht betrifft. Vergleichen wir diese Grundforderungen von 1995 mit der realen Situation von heute, so können wir sehen, wie weit die Entwicklung schon vorangeschritten ist. Nicht etwa weil wir es so wollen, sondern weil Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die diese Entwicklung steuern. Wer es auf Fördergelder abgesehen hat oder Applaus für seine Meinungsäußerung sucht, sollte die Punkte unbedingt beachten. Wer sich vor Strafe schützen will, ebenfalls.
Es geht nicht nur um Vergnügungen. Hier wird eine Drohkulisse aufgebaut, die sich nur notdürftig hinter dem Versprechen von »mehr sexuellen Vergnügungen« versteckt, es blitzt immer wieder die Bereitschaft auf, die Forderungen auch mit dem nötigen Nachdruck durchzusetzen – das heißt: mit gesetzlichen Regelungen und mit harten Strafen. Das Programm läßt keine Alternativen zu. Niemand muss ja sagen, aber wehe, jemand sagt nein! Das ist nicht vorgesehen. Man kann nur »Gefällt mir« anklicken.
Wer auch nur zu einem dieser Punkte – Gleichstellung, Abtreibung, Förderung von Homosexualität, frühkindlicher Sex, Quote, Vollzeit-Berufstätigkeit der Frauen und Religionsfeindlichkeit – in Opposition geht, begibt sich ins gesellschaftliche Abseits und gehört nicht mehr zur Konsensgesellschaft.