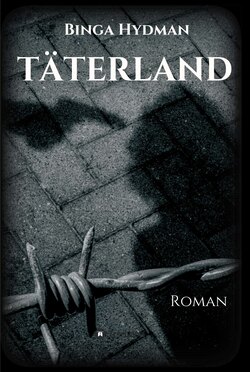Читать книгу Täterland - Binga Hydman - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. Kapitel
Entscheidungen und Erkenntnisse
Die ersten Wochen in der Kaserne empfand Martin von Amsfeld als eine Tortour. Gemäß des Gestellungsbefehls meldete er sich am 1. Oktober bei der 74. SS-Standarte in Greifswald, um von dort aus weiter nach Anklam zu reisen. Dort wurde er dem 2. Sturmbann und 7. Sturm zugeteilt. Ein Sturmbann hatte ungefähr die Größe eines Bataillons und ein Sturm entsprach in der Anzahl seiner Soldaten der Stärke einer üblichen Kompanie. Nachdem er an den ersten beiden Tagen seine Ausrüstung und seine schwarze Uniform erhalten hatte, folgte im Anschluss daran eine medizinische Untersuchung. Alle Wege, die er innerhalb dieser ersten Tage als SS-Anwärter zwischen Kleiderkammer, Sanitätsbereich und Schreibstube zurücklegen musste, wurden im Laufschritt absolviert. Überhaupt war der Ton hier deutlich rauer als er es aus dem RAD-Lager gewohnt war. „Bewegen sie ihren verdammten Hintern, Mensch. Wo kein Schnee liegt kann gelaufen werden!“ Schon nach wenigen Stunden hatte Martin begriffen, dass er hier nichts zu lachen haben würde. Für einen kurzen Moment verfluchte er den Oberfeldmeister Meinhard und wünschte sich, er hätte sich doch besser von der Wehrmacht zum Wehrdienst einziehen lassen. Der Untersturmführer, der ihm quer über den Exerzierplatz zu brüllte, dass er seine Beine in die Hand nehmen sollte, war sein Kompaniechef und hieß Fritz Maaßen. Der Mann verstand keinerlei Spaß, das war Martin schon nach wenigen Sekunden klar. Maaßen, ein gewichtiger ehemaliger Hauptfeldwebel des Heeres, brüllte eigentlich immer. Es schien fast so, als ob seine Stimmbänder nur eine einzige Lautstärke hervorbrachten. „Sie da! Ich glaube es hackt!“, donnerte sein überlautes Verbalorgan über den Hof, wenn sich einer seiner Männer erdreistete nicht im Laufschritt an ihm vorbei zu eilen. Das kann ja heiter werden, ging es Martin durch den Kopf. Dann rannte er einmal mehr über den sonst leeren Hof in Richtung der Unterkunft. Nach einigen Tagen hatte Martin sich an die Schleiferei und die Lautstärke seines Kompaniechefs gewöhnt. Die Ausbildung war hart. Die jungen Rekruten wurden von morgens bis abends gedrillt und durch das morastige Gelände getrieben. Formaldienst, Waffenkunde, Gefechtsdienst im Gelände und Sport wurden durch Unterrichte in Rassenlehre, Weltanschauung abgelöst. Martin, dem der militärische Drill irgendwann sogar anfing Spaß zu machen, fiel seinem Kompaniechef bald positiv auf.
Eines Morgens wurde Alarm gegeben. Die SS-Rekruten sprangen aus ihren Betten und zogen, so schnell sie es konnten, den auf einem Stuhl neben dem Bett stets vorbereiteten Gefechtsanzug an. Nur wenige Minuten später stand der 7. Sturm abmarschbereit auf dem Kasernenhof. Es dämmerte bereits und hinter dem nahegelegenen Wäldchen machte sich die blutrote Sonne daran, über das Firmament zu kriechen. Marin überprüfte seinen mit Platzpatronen geladenen Karabiner K98. Untersturmführer Maaßen, der ebenfalls in Gefechtsuniform gekleidet war, trat vor die Front der angetretenen Männer.
„Guten Morgen meine Herren.“ „Guten Morgen Herr Untersturmführer“, antworteten die Rekruten im Chor. Der Vorgesetzte lächelte zufrieden. „Männer, heute werden wir ins Manöver ziehen. Wir werden die nächsten drei Tage auf dem Truppenübungsplatz verbringen. Nach einer Marschzeit von höchstens 5 Stunden sollten sie unser Biwak erreichen. Danach beginnen wir mit der Stationsausbildung.“ Er machte eine kurze Pause. Dann ließ er seinen prüfenden Blick über die vor ihm angetretenen Männer schweifen. „Soweit alles klar?“ „Jawohl Herr Untersturmführer!“, donnerte es ihm entgegen. „Gut, die eingeteilten Gruppenführer zu mir!“ Vier Rekruten schlugen die Hacken zusammen und traten an den Vorgesetzten heran. Martin war ebenfalls als einer der Unterführer eingeteilt worden. „Also meine Herren. Sie wissen was zu tun ist. Führen sie ihre Gruppen auf dem kürzesten Weg zu diesem Wäldchen. Dort erhalten sie dann neue Befehle.“ Die vier Männer blickten auf die vor ihn ausgebreitete Geländekarte. Nach dem sie sich die Strecke eingeprägt hatten, gingen sie zurück zu ihren Gruppen und ließen Marschbereitschaft herstellen. Martins Gruppe wurde als letzte in Marsch gesetzt. In Abständen von fünfzehn Minuten verließen die vier Abteilungen die Kaserne. Jede Gruppe trug neben der persönlichen Ausrüstung jeweils zwei große Munitionskisten bei sich. In eine der beiden Kisten hatte man vor ihren Augen nassen Sand hineingefüllt und sie anschließend verplombt. Die Kiste wog ungefähr 80 kg und die Männer trugen sie zu zweit. Martin war mit seiner Gruppe gerade fünf Kilometer weit gekommen, als sie auf einem Feldweg plötzlich Gewehrfeuer hörten. „Voll Deckung!“, brüllte Martin. Die Männer warfen sich in den Staub. Aus einem der Maisfelder heraus erkannten sie das Mündungsfeuer eines MG 34. Nach wenigen Feuerstößen trat einer der Ausbilder, ein Hauptscharführer, auf den Weg hinaus und sagte grinsend. „Viel zu langsam! Im Ernstfall wäre die Hälfte von euch Warmduschern bereits tot!“ Martin erhob sich und klopfe den Staub von seiner Uniform. „Alles auf!“, schrie er. Die Männer nahmen ihre Marschformation wieder ein und trotteten hinter ihrem Gruppenführer her. Wenige Kilometer später musste die Gruppe das kleine Dörfchen Labuhn passieren. Am Dorfeingang erwartete sie ein „Juden sind her unerwünscht“ – Schild, dass man direkt unter dem Ortsnamen montiert hatte. In Amsfeld hatte der Ortsgruppenleiter Matuchek ebenfalls ein solches Schild anbringen lassen. Paul Gerhard von Amsfeld hatte daraufhin allerdings sofort angeordnet, dass es wieder zu entfernen sei. „Solange das Dorf meinen Namen trägt, wird hier kein solches Schild aufgestellt“, ließ er den verdutzten Ortsgruppenleiter wissen. Der fügte sich zwar zunächst dem Umstand, war sich aber sicher, dass er es diesem eingebildeten Freiherrn irgendwann schon zeigen würde. Martin war mit seinem Vater daraufhin in Streit geraten, denn er selbst hätte es gut gefunden dieses Schild als ein Zeichen der nationalsozialistischen Gesinnung des Dorfes anzubringen. Sein Vater hatte ihn während dieser Auseinandersetzung nur stumm gemustert und war dann wortlos zu den Ställen herübergegangen.
Vor der im Jahre 1850 erbauten kleinen neugotischen Backsteinkirche legte die Gruppe von Amsfeld eine Pause ein. Das Wäldchen, in dem sie erfahren würden, wie es für die weitergehen sollte, lag etwa sechs Kilometer südöstlich von Labuhn. Als sie dort ankamen erwartete sie bereits ein bekanntes Gesicht. Untersturmführer Maaßen lehnte an einem Baum und rauchte eine Zigarette. „Wurde ja auch langsam Zeit, dass sie hier auftauchen“, feixte er, offenbar bestens gelaunt. Martin schlug die Hacken zusammen und hob die Hand zum Hitlergruß. „Heil Hitler, Herr Untersturmführer. Ich melde Gruppe vollzählig angetreten.“ Maaßen schnippte die Zigarettenkippe weg. „Ja,ja. Schon gut. Kommen sie mit.“ Martin folgte dem Offizier in einen primitiven Unterstand. Dort erwarteten sie die anderen drei Gruppenführer. Maaßen kam gleich zur Sache.
„Also, wir werden in den nächsten zwei Tagen die Partisanenbekämpfung üben. Das bedeutet sie werden es mit irregulären Kampfgruppen zu tun haben, die weder Uniform noch Hoheitsabzeichen tragen werden. Der 6. Sturm wird in entsprechendem Räuberanzug agieren und für uns so den Feind darstellen. Ihre Aufgabe wird es sein, diese Partisanen aufzuspüren, festzunehmen, zu verhören und dann die für eine solche Situation richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich werde ganz in der Nähe sein und sie bei ihren Schritten beobachten und bewerten. Fragen?“ Die vier eingeteilten Gruppenführer schauten sich erst gegenseitig und dann ihren Vorgesetzten an. „Nein, Herr Untersturmführer.“ „Gut dann kann es ja losgehen. Die Gruppen Schierhorn und von Amsfeld übernehmen die östliche Seite des Waldes. Die anderen beiden die westliche. Wegtreten!“
Wieder Hakenschlagen, dann kehrten die vier Männer zu ihren jeweiligen Gruppen zurück. Am ersten Tag des Manövers wurden die Rekruten des 7. Sturms bis zur Erschöpfung kreuz und quer durch den Wald gehetzt. Dabei kam es zu diversen Feuerüberfällen durch Partisanen, Sabotageanschlägen und Dauerbeschuss. In der anschließenden Nacht wurden die Übungen fortgesetzt, so dass die erschöpften Männer nicht mehr als ein bis zwei Stunden zur Ruhe kamen. Als Martin seine Gruppe am darauffolgenden Tag erneut ins Gefecht führte, waren sie alle übermüdet. Jeder wünschte das Ende der Übung herbei, doch dieser Wunsch wurde ihnen nicht erfüllt. Es folgten weitere Scharmützel mit kleineren Partisanengruppen, die ganz plötzlich aus dem Nichts auftauchten und genauso schnell wieder im dichten Unterholz des Waldes verschwunden waren. Gegen Mittag waren dann auch viele der Männer völlig entkräftet. Am Nachmittag endete sich die Situation dann zu Gunsten der SS-Rekruten. Die vermeintlichen Partisanen ließen sich nach und nach gefangen nehmen und wurden im Gänsemarsch in das Biwak zurückgeführt. Auch Martins Gruppe hatte Glück gehabt und auf einer Lichtung etwa 30 gefangene Partisanen zusammengetrieben. Nach dem sie den Gegner entwaffnet und andeutungsweise gefesselt hatten, wurden die vermuteten Anführer in ein Zelt geführt und dort verhört. Die Informationen, die sie dabei preisgaben, wurden durch einen Funker weitergeleitet. An diesem Punkt war das eigentliche Manöver vorbei. Martin ließ über Funk bei Maaßen nachfragen, wie jetzt weiter zu verfahren sei. „Verfahren sie entsprechend!“ Martin schaute seinen Funker für einen Moment nachdenklich an, dann zuckte er mit den Schultern und ging hinüber zu den Gefangenen.
Etwa vier Stunden später saßen die erschöpften Angehörigen des 7. Sturm im Mannschaftsheim ihrer Kaserne und warteten auf den Kompaniechef. Der war nach der Rückkehr mit seinen Ausbildern in das Stabsgebäude hinübergegangen, um dort eine erste Manöverkritik zu erstellen. „Achtung“, brüllte Martin in den Schankraum des Mannschaftsheims hinein. Die eben noch ins Gespräch vertieften Rekruten sprangen auf und nahmen Haltung an. Maaßen und seine Unteroffiziere betraten den Saal und setzten sich an das Ende eines langen Tisches. „Also, meine Herren. Wir haben soeben ihre Leistungen der letzten drei Tage bewertet und werden ihnen gleich mitteilen, was sie richtig und was sie falsch gemacht haben.“ Er zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch dann genussvoll in Richtung der Zimmerdecke. „Falsch haben sie so einiges gemacht. Richtig aber nur wenig.“ Er lachte bellend in die Stille des Raumes hinein. Nur die Unteroffiziere schienen diese Feststellung ebenfalls witzig zu finden, denn sie stimmten in sein Lachen ein. Die Rekruten des 7. Sturms allerdings blieben stumm. „Also. Militärisch waren ihre Heldentaten in der Tat keine Glanzleistung. Die allermeisten von euch wären bereits am ersten Abend irgendwo hinter einer Latrine verscharrt worden, weil sie in einem echten Kampfeinsatz bereits eine Kugel im Kopf gehabt hätten. Der Schanz- und Stellungsbau war ebenfalls lausig, so dass den kümmerlichen Rest von euch, die Artillerie des Gegners in kürzester Zeit in die Hölle geschickt hätte.“ Sein Blick war jetzt starr auf die vor ihm sitzenden Männer gerichtet. „Aber am erbärmlichsten war dann ihr glanzloser, jämmerlicher Umgang mit den gefangenen Partisanen.“ Maaßen schlug ein kleines Buch auf, dass er vor sich auf den Tisch gelegt hatte. „Ich hatte ihnen gesagt, dass ich sie beobachten würde. Das habe ich getan. Die Gruppen Schierhorn und Schneider haben offensichtlich die Genfer Konvention auswendig gelernt und die Gefangenen nach allen Regeln der Kriegskunst in ein Ferienlager an die Sommerfrische geschickt. Natürlich erst nach dem sie die Gefangenen freundlich gebeten haben, doch bitte keinen Widerstand mehr zu leisten.“ Der Spott in seiner Stimme war unüberhörbar. „Die Gruppe Mikulsky hat ihre Gefangenen überhaupt nicht verhört und dann ein eigenes kleines Kriegsgefangenenlager eröffnet.“ Seine flache Hand hieb mit einem lauten Krachen auf die Tischplatte, so dass ein paar halbvolle Gläser einen kleinen Satz machten. „Eine Bewachung, die Verpflegung und eine Unterkunft. Das bedeutet also, ihre Männer müssen ihr Futter mit dem Feind teilen, der eben noch ihre Kameraden umgelegt hat. Außerdem können Männer, die zur Bewachung von Gefangenen abgestellt werden müssen, nicht kämpfen!“ Maaßen schüttelte den Kopf und blickte den stämmigen SS-Anwärter Erik Mikulsky an, der auf seinem Stuhl immer kleiner geworden war. „Mikulsky, sie sollten wirklich zur Heilsarmee gehen. In der SS haben sie nichts verloren.“ Für einen Moment herrschte in den verqualmten Schankraum eine völlige Stille, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Dann seufzte der Untersturmführer gekünstelt und setzte ein breites Grinsen auf. „Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Die Gruppe des SS-Anwärters von Amsfeld hat vorgemacht, wie man eine solche Situation angeht und bereinigt.“ Alle Augenpaare im Saal blickten jetzt auf Martin. „Von Amsfeld, sie stellen in dieser Laienspielgruppe den einzigen Lichtblick dar.“ Maaßen sprang auf, so dass sein Stuhl nach hinten kippte. Dann stemmte er die Hände in die Hüften und erneut wanderte sein Blick durch die Reihen der Rekruten. „SS-Mann von Amsfeld hat diese verdammten Partisanen scharf verhört. Dann hat er sie durchsuchen lassen und anschließen anständig erschossen.“ Maaßen lachte sichtlich amüsiert. Er war an Martin herangetreten und schlug ihm nach den letzten Worten kameradschaftlich auf die Schulter. „Sie sind mir der Richtige. Diese Partisanen haben deutsche Soldaten getötet und gehörten keiner regulären Armee an. Für solche Mörder darf kein Gesetz gelten oder menschliche Gefühlsduselei. Diese Kerle gehörten an die Wand gestellt.“ Den Rest des Abends feierten die Rekruten bis tief in die Nacht hinein. Martin war schon bald sturzbetrunken. Es war bereits weit nach Mitternacht, als er in seine Stube zurücktaumelte. Erschöpft, aber glücklich ließ er sich in seine Koje fallen. Der Kompaniechef hatte ihn nach der Ansprache im Saal des Mannschaftsheims noch kurz bei Seite genommen und ihm mitgeteilt, dass er dafür sorgen würde, dass Martin nach dem Ende der Ausbildungszeit eine Versetzung zur SS-Unterführerschule erhalten würde. „Männer wie sie braucht die SS. Sie haben bei uns eine große Zukunft vor sich!“ Martin schloss die Augen und war schon eine Minute später eingeschlafen.
*****
Der schmale steinerne Niedergang hinunter in die Gruft war seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Dichtes Efeu hatte sich überall auf dem alten, gemauerten Kalkstein ausgebreitet und das Unkraut wucherte aus den Ritzen des brüchig gewordenen Mörtels. Freiherr von Amsfeld wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. In seiner Hand hielt er eine große Heckenschere, mit der er, seit Stunden den dichten Efeubewuchs entfernte. Als er wenig später die ausgetretenen Treppen zu der Gruft herunterging, vermutete er, dass er diesen Raum unterhalb der kleinen Kapelle etwa zwanzig Jahre lang nicht mehr betreten haben dürfte. Die alte schwere Holztür war ebenfalls zu gewuchert und die Eisenbeschläge waren verrostet und hatten die Farbe der Holztür angenommen. Der große Schlüssel, den er über viele Jahre in einer kleinen Schatulle in seinem Schreibtisch aufbewahrt hatte, passte und nach anfänglichen Schwierigkeiten ließ er sich schließlich drehen. Ein vernehmbares Knacken, dann das ächzten der alten Holzbohlen und die schwere Tür öffnete sich quietschend. Moderige kalte Luft schlug ihm entgegen. Es riecht nach Tod, dachte er und betätigte den mit Spinnweben überzogenen Lichtschalter. Zwei mickrige Glühbirnen erleuchteten den mit großen Quadersteinen gemauerten Raum, der sich direkt unterhalb des kleinen Gotteshauses befand. Als einer seiner Vorfahren diesen Raum vor langer Zeit hatten bauen lassen, wollte der damalige Gutsherr hier seine letzte Ruhestätte erhalten, doch daraus wurde nichts. Nach der Fertigstellung stellte man fest, dass der mit großen Granitplatten versehende Boden der Gruft plötzlich um einen halben Meter abgesackte, weil man beim Bau nicht bemerkt hatte, dass unter dem Gebäude eine große Wasserader verlief. Also wurden in dem kalten Gemäuer erst Vorräte und später dann Gerümpel gelagert. Auch jetzt war der etwa sieben Meter lange und fünf Meter breite Raum nicht leer. In der hinteren Ecke stand ein alter Kleiderschrank, dessen linke Tür nur noch durch ein letztes intaktes Scharnier daran gehindert wurde auf den Boden zu fallen. Auf dem Boden lagen eine Unmenge leerer Fässer und Flaschen herum. Während an der langen Wand zu seiner Linken ein Stapel morscher Weinkisten ihrem irdischen Ende entgegengingen. „Was tust du hier?“ Die sanfte Stimme seiner Frau ließ ihn herumfahren. Er hatte sie nicht kommen gehört. „Ich bereite diesen Raum vor“, flüsterte er leise. „Wofür bereitest du ihn vor?“ fragte sie und flüsterte nun ebenfalls. Er legte die Heckenschere auf eine der maroden Kisten und blickte sie an. „Ich habe einigen Menschen versprochen sie hier für eine Weile unterzubringen.“ Sie schwieg und er fuhr fort. „Es sind ein paar Menschen, die sich vor den Nazis verstecken müssen, um nicht in ein Konzentrationslager eingewiesen zu werden.“ Helene von Amsfeld machte einen Schritt auf ihren Mann zu und ergriff seine Hand. „Das ist gefährlich Paul. Wenn man diese armen Seelen bei uns findet sind wir ebenfalls in Gefahr.“ In ihrem Blick lag keinerlei Vorwurf, sondern ein Anflug von Angst. „Ich weiß meine Liebe, aber wir müssen helfen. Denke an Ursula und denke an das Unrecht, das diese Banditen in unser aller Namen begehen.“ Sie küsste seine Hand und nickte stumm. „Du bist ein guter Mann Paul und ich liebe Dich. Sollte man uns verhaften, würde es mir nichts ausmachen solange wir zusammenblieben.“ Dann drehte sie sich wortlos um und stieg die Treppen hinauf.
Der Lastkraftwagen holperte die schmale Straße entlang. Die Nacht lag über dem Dorf und in den Häusern waren bereits alle Lichter erloschen. Die Bewohner von Amsfeld schliefen den Schlaf der Gerechten. Als der LKW den kleinen Marktplatz und die Kirche passiert hatte, bog er nach rechts ab und erreichte nach einigen hundert Metern den Hof der Familie von Amsfeld. Die Bremsen quietschten und das Motorgeräusch erstarb. Türen wurden geöffnet und eilige Schritte halten durch die pechschwarze Nacht. Walter Empbusch trat an die Rückseite der Ladefläche heran und schlug die Plane zurück. „Los, alle raus. Macht schnell.“ Leises Stimmengewirr folgte. Dann sprangen mehrere Schatten von der Ladefläche herunter. In dem großen Wohnhaus war jetzt ein Licht zu erkennen. Die Tür öffnete sich und Paul Gerhard von Amsfeld trat aus dem Flur auf die Treppe hinaus. „Mir nach!“, flüsterte er und die kleine Gruppe folgte ihm. Sie erreichten den Niedergang, der in die Gruft unterhalb der kleinen Kapelle führte. Im Inneren hatte der Hausherr in den letzten Tagen versucht, dem fensterlosen Keller ein wenig Wohnlichkeit einzuhauchen. Die alten Kisten, der marode Schrank und die unzähligen leeren Flaschen waren verschwunden. Stattdessen hatte er je zwei schmale Etagenbetten aufgebaut, auf denen je ein Kissen und eine Decke lag. In der Mitte des Raums stand ein alter Esstisch und vier einfache Stühle. Gleich dahinter erkannte Empbusch ein barockes Sofa, das in diesem wenig wohnlich wirkenden Keller irgendwie fehl am Platz wirkte. Direkt daneben erleuchtete eine Stehlampe die unwirkliche Szenerie. Ihr Licht würde aber ausreichen, um diesem Raum etwas wohnlicher wirken zu lassen. Auf der anderen Seite dieser unterirdischen Notunterkunft befand sich ein großes Bücherregal, in das einige Dutzend Bücher gestellt worden waren. Am hinteren Ende der Gruft waren die schweren Bodenplatten entfernt worden. Hinter einer hölzernen Abtrennung befand sich ein Loch im Boden. Empbusch trat an die dunkle Öffnung heran.
Er bemerkte, dass man hier ein etwa zwei Meter tiefes kreisrundes Loch gegraben hatte, das etwa den Durchmesser einer Schallplatte hatte. Daneben standen gefüllte Eimer mit Wasser. „Ich habe dort unten einen Durchbruch zu einer unterirdischen Wasserader geschaffen. Dieses Loch dient ihnen als Toilette. Der Geruch dürfte sich also in Grenzen halten, da die Exkremente von dem dort unten entlang fließenden Wasser weggeschwemmt werden sollten“, erklärte von Amsfeld, der die fragenden Blicke seiner Gäste bemerkt hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass eine Frau unter ihnen war. „Mein Name ist von Amsfeld. Sie werden für einige Zeit meine Gäste sein“. Nacheinander gaben sich die Anwesenden die Hand. Die Frau, eine zierliche Mittdreißigerin mit rotem Haar und Sommersprossen stellte sich als Irmgard Neitzel vor. Die hübsche Frau hatte dem Parteivorstand der SPD in Frankfurt an der Oder angehört und war nach dem Verbot der Partei und der Verhaftung der allermeisten ihrer Genossen untergetaucht. Als politisch aktive Kraft war sie 1918 eine der wenigen weiblichen sozialdemokratischen Persönlichkeiten des Arbeiter- und Soldatenrats in Preußen gewesen. Von 1919 bis 1929 saß sie als Abgeordnete für die SPD im Stadtparlament in Rummelsburg, bevor sie 1930 für die SPD in den preußischen Landtag gewählt wurde. Als nächstes stellte sich ein kleiner bereits leicht ergrauter Mann als Willy Riesler vor. Der Sohn eines Droschkenkutschers und gebürtige Stettiner wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. 1905 trat der gelernte Fuhrmann der SPD bei und wurde schon bald einer ihrer aktivsten Funktionäre in Preußen. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges übernahm er die Geschäftsführung des deutschen Metallarbeiterverbands in seiner Heimatstadt. Nur wenig später wurde der bei den Arbeitern sehr beliebte Gewerkschaftsführer in den preußischen Landtag gewählt. Im Zuge der Machtergreifung und anlässlich der Zerschlag der Gewerkschaften durch die Nazis war Riesler am 2. Mai 1933 durch die Gestapo verhaftet worden, wurde aber nach intensiven Verhören zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf das Anraten einiger politischer Wegbegleiter tauchte der ehemalige Abgeordnete nach seiner Freilassung unter und hatte die letzten vier Jahre im Untergrund verbracht. Der dritte SPD-Funktionär war optisch das genaue Gegenteil von dem kleinen und schmächtigen Riesler. Wilhelm Schnepphorst maß knapp zwei Meter und war ein wahrer Koloss. Der große Endvierziger wog mindestens 120 Kilo und seine Hände hatten die Größe von Baggerschaufeln. Schnepphorst blickte auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Wie Riesler hatte sich der gelernte Schreiner bereits früh den Sozialdemokraten angeschlossen und war in seiner Heimatstadt Kolberg schnell zu einem der führenden Gewerkschaftsfunktionäre aufgestiegen. In den zwanziger Jahren leitete er bis zum Verbot durch die Nazis den Pressedienst der SPD in Preußen.
Nach einer kurzen Haftstrafe wurde er 1934 freigelassen und tauchte unter. Seit diesem Zeitpunkt hatte er sich bei alten Parteigenossen in Stettin versteckt. Hier war er auch mit Riesler zusammengetroffen. „Und sie heißen?“ Die Frage richtete Paul Gerhard von Amsfeld an den vierten seiner neuen Gäste. „Ich heiße Herman Schöneberg. Es freut mich sie kennenzulernen, auch wenn die Umstände unseres Zusammentreffens nicht gerade die angenehmsten sind.“ Schöneberg machte einen Schritt auf seinen Gastgeber zu. „Es freut mich ebenfalls Herr Schöneberg.“
Der fünfundsechzigjährige Rechtsanwalt wirkte in der Umgebung dieses dunklen Verlieses deplatziert. Die Kleidung war die eines typischen Beamten und sein Gehstock mit Elfenbeinverzierung verlieh ihm den Glanz einer früheren bürgerlichen Oberschicht. Der Sohn eines erfolgreichen jüdischen Getreidehändlers aus Stettin studierte nach dem Abitur Jura und erhielt im Jahre 1895 seine Zulassung als Rechtsanwalt und Notar. Im Ersten Weltkrieg war er an der Westfront 1917 bei einem Feuergefecht schwer verwundet worden und hatte daraufhin das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhalten. Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Jahre 1918 trat er im Bankhaus Mendelsohn die Stelle eines Syndikus an, die er bis 1933 behielt.
Nach der Machtübernahme durch die Nazis verlor er 1935 kurz nach der Einführung der Nürnberger Rassegesetze seine anwaltliche Zulassung und wurde aus der Anwaltskammer ausgeschlossen. Als ein angetrunkener SA-Trupp an einem Sonntagabend im Jahr 1936 sein Haus stürmte und völlig verwüstete, hielt der überzeugte Junggeselle die Zeit für gekommen sich unsichtbar zu machen. Noch in der gleichen Nacht verschwand er aus seinem Haus und versteckte sich zunächst bei Freunden. Wenig später war Schöneberg dann zu Walter Empbusch gebracht worden.
Als der Morgen dämmerte und die Sonne träge über den Horizont kroch, befand sich Walter Empbusch mit seinem LKW schon auf dem Rückweg. In der Gruft unter der Kapelle hatte sich die neuen Bewohner auf die schmalen Betten gelegt, um sich etwas auszuruhen. Paul Gerhard war gerade dabei die Pferde zu striegeln, als einer seiner Landarbeiter in den Stall trat. „Herr von Amsfeld. Wir würden gern ein paar der alten Weinkisten aus der Gruft herausholen. Unsere Buben wollen sich daraus ein paar Seifenkisten bauen. Spricht etwas dagegen?“ Der Freiherr glaubte, dass ihm für einen Moment das Herz stehen bleiben würde. „Die Kisten habe ich vor einigen Tagen herausgeholt und neben dem großen Schuppen abgelegt. Die Kinder können sich die Kisten dort ruhig wegnehmen.“ Der Landarbeiter nickte dankbar, zog dann aber verwundert die rechte Augenbraue hoch. „Herzlichen Dank. Warum haben sie die Kisten denn überhaupt aus dem Rattenloch herausgeholt? Das hätten wir doch für sie erledigen können“, fragte er neugierig. „Das Rattenloch, wie sie es nennen, ist mit Grundwasser vollgelaufen. Sie wissen doch sicher, dass unter der Kapelle einer Wasserader verläuft.“ Paul Gerhard versuchte möglichst verärgert zu klingen. „Das ist jetzt also kein Rattenloch mehr, sondern eher ein Aquarium.“ Bei diesen Worten zuckte er mit Schultern, so als ob er es sich bei dem vermeintlichen Wassereinbruch um eine Strafe Gottes handelte, gegen die man leider nichts machen konnte. „Ich verstehe. Die Kinder werden sich über das Holz sehr freuen. Besten Dank Herr von Amsfeld.“ Nach diesen Worten drehte sich der Mann um und ging. Eines der Pferde wieherte leise und Paul Gerhard ließ sich müde auf einem Schemel nieder. Das war knapp, dachte er. In Zukunft würde er darauf zu achten haben, dass sich niemand dem Eingang der Gruft nährte.
*****
Die Grundausbildung war vorbei. Nachdem die SS-Anwärter des 7. Sturms ihren Treueeid auf den Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches abgelegt hatten, erhielten sie in einer feierlichen Abschlusszeremonie ihren SS-Dolch und wurden damit als Mitglied in die SS aufgenommen. Schon ein paar Tage zuvor war ihnen ihre jeweilige Blutgruppe auf den Arm tätowiert worden. Voller Stolz betrachtete Martin den schlanken, blanken Stahl des Dolches auf dem man „Unsere Ehre heißt Treue“ eingraviert hatte. Nun war er also ein echter SS-Mann, ging es ihm durch den Kopf. Als Lehrgangsbester und mit Auszeichnung hatte er die harte entbehrungsreiche Ausbildung hinter sich gebracht. Sein Kompaniechef Fritz Maaßen hielt Wort und schlug ihn für die Laufbahn der Scharführer vor, was den Feldwebeldienstgraden der Wehrmacht entsprach. Er würde schon bald die Unterführer-Schule besuchen. Zunächst aber durften die neuen SS-Männer für ein paar Tage in den Urlaub fahren. Martin und ein einige seiner Kameraden überlegten, ob sie nicht nach Berlin fahren sollten, um dort mal so richtig die Sau rauszulassen, aber letztendlich wollte dann doch jeder von ihnen zunächst nach Hause zu seiner Familie fahren. Ein Omnibus brachte die Männer am darauffolgenden Tag zum Bahnhof. Nach einer herzlichen Verabschiedung trennten sich ihre Wege. Der ein oder andere von ihnen würde sich schon sehr bald wiedersehen. Dann allerdings auf einem echten Schlachtfeld, auf dem echte Kugeln über ihre Köpfe hinweg fliegen würden.
Es sollte eine Überraschung für seine Eltern werden. Martin, stieg aus dem Zug der Deutschen Reichsbahn und blickte auf eine der beiden großen Uhren, die in der kleinen Bahnhofshalle aufgehängt worden waren. Es war 13 Uhr. Zunächst hatte er vorgehabt seinen Besuch zu Hause anzukündigen, doch dann überkam ihn der Wunsch, sie zu überraschen. Um 13.30 Uhr ging es dann mit dem kleinen cremefarbenen Omnibus von Rummelsburg nach Amsfeld. Es war ein herrlicher Sommertag und die Fahrt würde eine knappe Stunde dauern. Dichte Wälder, scheinbar nicht enden wollende Felder und anmutig in die Landschaft eingebettete tiefblaue Seen, zogen an ihm vorbei. Die holperige Straße machte eine leichte Linkskurve und zwischen den Weizenfeldern erkannte er den Kirchturm seines Heimatdorfes. Als er wenige Minuten später durch die Hauptstraße von Amsfeld in Richtung des Gutshofs seines Vaters lief, warfen ihm einige Bewohner verstohlene Blicke zu. In seiner schwarzen SS-Uniform erkannte ihn offenbar nicht jeder sofort. Der ein oder andere Bekannte grüßte verlegen, während einige Bewohner demonstrativ so taten, als hätten sie ihn nicht gesehen. Nach wenigen Minuten erreichte er das elterliche Gut. Auf dem großen Hof sah alles aus wie immer.
Nur der Eingang zu der Gruft der kleinen Kapelle schien von Unkraut und wucherndem Efeu befreit worden zu sein. Er wollte gerade die große Eingangstreppe des Wohnhauses hinaufgehen, als er seine Mutter entdeckte. Helene trug eine leuchtend rote Schürze und hielt einen Besen in der Hand. „Hallo Mutter.“ Die Frau zuckte erschrocken zusammen. Dann erkannte sie ihren Sohn. „Mein lieber Junge!“, rief sie, ließ den Besen fallen und stürzte auf ihn zu. Der typische süßliche Duft seiner Mutter, den er schon als Kind so geliebt hatte, stieg ihm in die Nase, als sie ihn mit Tränen in den Augen in ihre Arme schloss. „Das ist aber eine Überraschung.“ Ihr Finger strich sanft über seine Wange. „Ich habe ein paar Tage Urlaub bekommen, bevor ich wieder nach Lauenburg muss.“ Seine Mutter wischte sich ihre Hände in der Schürze ab und fuhr sich dann durch ihr langes blondes Haar. „Komm erst einmal herein. Du wirst sicher Hunger haben.“ Sie ergriff seine Hand und zog ihn mit sich in die große Küche des Hauses. Am frühen Abend hörte Martin das Geräusch eines Autos. Neugierig schob er die Gardine bei Seite und blickte hinaus. Er erkannte den grünen Opel Kadett seines Vaters, der da durch das kleine gemauerte Tor auf den Hof fuhr. Er erhob sich und machte sich auf den Weg, um seinen Vater zu begrüßen. Der Opel Kadett parkte direkt neben dem großen Stall und Martin konnte sehen, wie sein Vater einige Pappkartons aus dem Kofferraum herausnahm und sie in den Stall brachte. „Guten Tag Vater.“ Der alte Mann fuhr erschrocken herum und hätte dabei fast einen der Kartons fallen lassen. „Hallo Sohn.“ Die beiden Männer standen sich in einem Abstand von einem Meter gegenüber und musterten sich. Dann machte der Vater einen Schritt auf den Sohn zu und gab ihm die Hand. So standen sie eine Weile schweigend da, bis Martin durch einen Schritt rückwärts den alten Abstand zwischen ihnen wiederherstellte. Der Blick seines Vaters glitt über die schwarze Uniform und Martin meinte in den Augen seines Vaters eine gewisse Abneigung gegen das schwarze Tuch zu erkennen. In den letzten zwei Jahren hatte sich Vater und Sohn immer weiter voneinander entfernt und auseinandergelebt. Wie in so vielen anderen deutschen Familien in Deutschland, war es in der Vergangenheit auch im Haus von Amsfeld immer häufiger zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn gekommen. Der liberale und der Demokratie gewogene Freiherr hielt mit seiner ablehnenden Haltung den Nazis gegenüber nicht hinter dem Berg, während Martin sich immer mehr zu einem begeisterten Nazi mauserte. Nach seiner Rückkehr aus dem Reichsarbeitsdienst war er ideologisch ganz auf die Linie der Nazis eingeschwenkt.
Die politische Kluft zwischen den beiden war schon bald so tief, dass sich kaum noch ein vernünftiges Gespräch entwickeln konnte. Martin, der wie viele andere junge Menschen, fest daran glaubte bereits alles besser zu wissen, reagierte häufig wütend. Er verstand einfach nicht, warum sein Vater es nicht akzeptieren wollte, dass Deutschlands Zukunft dem Nationalsozialismus gehören würde. Immer häufiger unterbrach er seinen Vater, belehrte ihn barsch und setzte dann zu einer Ansprache im Stile eines Josef Goebbels an. Nicht selten endeten solche Wortgefechte im Streit und durch das Fehlen eines normalen Maßes an der Fähigkeit zur Selbstkritik fühlte, sich Martin nach jeder dieser Eskalationen stets im Recht. Paul Gerhard, der das herrische und respektlose Auftreten seines Sohnes kaum noch ertragen konnte, zog sich mehr und mehr in sich selbst zurück. Der ehemalige DDP-Abgeordnete litt unter der stetigen Selbstgerechtigkeit seines Stammhalters und sah sich doch nicht in der Lage, etwas gegen diese Entwicklung zu tun. Helene, der die angespannte Stimmung zwischen ihrem Mann und dem Sohn nicht verborgen geblieben war, versuchte, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln. Doch irgendwann gab sie es auf. Paul Gerhard, der früher stets gut gelaunte und humorvolle Geschichtenerzähler, schwieg nun meist und wich jedem längeren Gespräch mit seinem Sohn aus. Eine eigene Meinung vertrat er nur noch selten, wohlwissend, dass Martin jedes seiner Worte sofort in Frage stellen würde. Vor einigen Monaten war es kurz vor Martins Einberufung zur SS zu einem schlimmen Wutausbruch des Jungen gekommen. „Du verfluchter Judenfreund!“, hatte er seinem völlig fassungslosen Vater ins Gesicht gebrüllt, als der einmal mehr versuchte, auf die in seinen Augen ungerechtfertigte Ausgrenzung der Juden in Deutschland hinzuweisen. Der inakzeptable Kontrollverlust des Sohnes versetzte dem Vater einen Schock, von dem er sich nie wieder ganz erholen sollte. Der grenzenlose Schmerz, den Paul Gerhard in diesem Moment empfand, blieb und würde sich für den Rest seines Lebens wie ein Krebsgeschwür in ihn hineinfressen. Martin selbst schien dieser Vorfall nicht weiter zu belasten. Ihm waren die Gefühle seines Vaters nur selten einen Gedanken wert und wenn er dann doch in einem Anflug von emotionaler Gefühlsregung einmal über dessen Gefühlswelt nachdachte, verstand er sie einfach nicht. Aus dem netten Jungen war in nur wenigen Monaten ein gefühlskalter SS-Mann geworden.
„Wie lange wirst du bleiben?“ Die Frage hatte Martin nicht erwartet. Er will nicht einmal wissen, wie es mir ergangen ist, stellte er enttäuscht fest. Der Unmut schien ihm ins Gesicht geschrieben zu sein, denn sein Vater beeilte sich, zu sagen „Eine schneidige Uniform hast du da an.“ War das sarkastisch gemeint? Martin blickte für eine Sekunde verunsichert an sich herunter und beschloss dann die Worte als freundliche Gesprächseröffnung zu verstehen. „Danke. Seit gestern darf ich auch meinen Dolch dazu tragen.“ Er hatte sich bemüht, möglichst abgeklärt zu klingen, konnte aber seinen Stolz über diese Tatsache nicht ganz verbergen. „Also, wie lange wirst du bleiben?“ Paul Gerhard hatte einen weiteren Karton aus dem Heck des Opels genommen, um ihn in den Stall zu tragen. „Ein paar Tage. Ich wurde zurück nach Lauenburg kommandiert um an der Unterführerschule zum Scharführer ausgebildet zu werden?“ Wieder hob sein Vater einen Karton aus dem Kofferraum und trug es zu den anderen Kisten in den Stall. „Was ist da drin?“ Martin zeigte auf eine der Schachteln. „Nichts Besonderes. Sind nur ein paar Konserven, die ich günstig erstehen konnte.“ Martin wunderte sich zwar, warum sein Vater Dutzende von Konservendosen im Pferdestall einlagerte, obwohl sie doch im Wohnhaus über eine große Speisekammer verfügten, beschloss aber nicht weiter darüber nachzudenken. Was geht mich das an, dachte er. Soll er doch seinen Krempel lagern, wo der Pfeffer wächst. „Du wirst also ein Scharführer?“ Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. „Ja. Irgendetwas falsch daran?“, erwiderte Martin bereits leicht gereizt und stemmte während dieser Worte die Fäuste in die Hüften. „Nein, du wirst schon wissen was du tust.“ Paul Gerhard lächelte, aber das Lächeln erreichte nicht seine Augen. Innerlich verursachte dieser Entschluss des eigenen Sohnes, eine Karriere innerhalb der SS anzustreben, eine verzweifelte hilflose Wut. Doch er würde schweigen. Einer weiteren dieser traurigen, verbalen Auseinandersetzungen fühlte er sich nicht mehr gewachsen. Er war des ewigen Kampfes um Worte müde. Am Abend saßen Eltern und Sohn auf der Terrasse des Hauses und genossen die letzten warmen Sonnenstrahlen des Tages. Helene hatte ein paar Käsebrote geschmiert und eine Flasche Rotwein aufgemacht. Die große Terrasse lag auf der Rückseite des großen Wohnhauses. Von hier aus hatte man einen herrlichen Blick auf einen kleinen nahegelegenen See. Dahinter erstreckte sich eine riesige Waldfläche. Am rechten Rand des Seeufers lagen zwei kleine Holzboote an einem Steg und dümpelten träge vor sich hin. Ein Bussard segelte lautlos mit ausgebreiteten Schwingen über ihre Köpfe hinweg, um sich dann anmutig auf dem Dach eines Jagdstandes niederzulassen. „Ist es nicht schön hier?“, seufzte Helene und nippte an ihrem Weinglas. Paul Gerhard und Martin nickten zustimmend. Als die Sonne langsam hinter den Wipfeln des Waldes verschwand, erhob sich der Gutsherr und streckte sich. „Ich habe noch etwas zu erledigen“, ließ er seine Frau und seinen Sohn wissen und ging ohne ein weiteres Wort davon. Helene steckte sich eine Zigarette an und schenkte sich ein weiteres Glas Wein ein. Dann reichte sie die Flasche an Martin weiter, der sich ebenfalls bediente. Er hatte seine schwarze Uniform gegen ein kurzes Hemd und eine Leinenhose getauscht. „Dein Vater liebt dich“. Helene blies den Rauch in Richtung des Abendhimmels und lehnte sich bequem in ihrem Stuhl zurück. Ihr Blick ruhte jetzt auf ihrem Sohn, der weiterhin wortlos auf den angrenzenden See blickte. „Als du ihn damals angeschrien hast..“, sie zögerte einen Moment. Dann fuhr sie leise fort „…er hat das nie verwunden. Dein Vater ist ein guter Mann, der sicherlich nicht perfekt ist. Wir alle haben unsere Fehler und Schwächen.“ Sie schwieg für einen Moment. „Du bist zu weit gegangen Martin und solange du ihm nicht zeigst, dass es dir leid tut, wird diese Sache ewig zwischen euch stehen.“ Jedes ihrer Worte trafen Martin wie ein Peitschenschlag. Nun war also auch seine Mutter gegen ihn, ging es ihm durch den Kopf.
„Er sitz auf seinem hohen Ross und hält sich für den Inbegriff der Menschlichkeit. Wir leben in einem neuen Zeitalter, Mutter. In Deutschland weht ein neuer Wind. Juden und Asoziale haben in unserer Volksgemeinschaft nichts mehr verloren.“ Martin blickte seine Mutter jetzt an, die seinem Blick standhielt. „Wer die Juden bedauert oder ihnen sogar hilft, wird Schwierigkeiten bekommen“. Dann erhob er sich und stellte sein Glas auf den kleinen Tisch zurück. „Du vergisst offenbar, dass du von einer Jüdin erzogen worden bist.“ Helene hatte sich nun ebenfalls von ihrem Stuhl erhoben. Der eben noch sanfte mütterliche Gesichtsausdruck war dem einer strengen Ernsthaftigkeit gewichen. „Ich sage es dir jetzt ein einziges Mal und dann nie wieder. Dieser ganze antisemitische Hass, der irrwitzige Rassenwahn und der Germanenkult dieser Leute, wird Deutschland über kurz oder lang in einen Krieg stürzen, den wir verlieren werden. Dein Vater hat das bereits vor langer Zeit erkannt. Die Familie von Amsfeld war immer schon sehr liberal und weltoffen. Die christlichen Werte sind uns heilig. Diese neue Religion in ihren schwarzen Uniformen predigt Tod, Hass und Gewalt. Weißt du worunter dein Vater am meisten leidet?“ Sie trat an Martin heran und ihr süßer Duft stieg ihm in die Nase. „Er hat versucht dir etwas seiner Werte zu vermitteln. Du jedoch…“, ihre Stimme war jetzt von einer unendlichen Traurigkeit erfüllt. „… willst stets beweisen, dass er sich irrt. Es tut mir leid mein Sohn, aber du hast wirklich rein gar nichts begriffen.“ Nach den letzten Worten drehte sie sich um und ging davon. Der Bussard hatte sich wieder in die Luft erhoben und schwebte majestätisch über den See hinweg. Martin stand noch eine ganze Weile so da und blickte gedankenverloren in die hereinbrechende Nacht. Dann ging auch er ins Haus zurück. Er wusste jetzt, was er zu tun hatte.
„Der Dosenfraß ist wirklich widerlich.“ Im Halbdunkel des Gewölbes erhob sich eine in Wolldecken gehüllte Gestalt von einer der schmalen Pritschen und reckte sich. Seit einer guten Woche hatten die vier Menschen, die sich diesen feuchten und kalten Unterschlupf unterhalb einer Kirche teilten, kein Tageslicht mehr gesehen. Jeden Abend erschien Paul Gerhard von Amsfeld, um frisches Wasser und einige Lebensmittel vorbeizubringen. „Wie lange werden wir noch hier unten herumsitzen müssen?“, fragte Irmgard Neitzel in das Halbdunkel hinein. Willy Riesler, der seit Stunden rastlos um den klapprigen Esstisch herumwanderte, lächelte den Schatten an, von dem er vermutete, dass er der hübschen Frau gehörte. „Unser Gastgeber hat gestern eine Nachricht von Empbusch erhalten. Wir sollen in zwei Tagen in die Tschechei gebracht werden.“ Am anderen Ende der Gruft räusperte sich Hermann Schöneberg. „Es ist wahrlich kein Vergnügen in diesen feuchten Mauern zu hausen. Dennoch ziehe ich ihre Gesellschaft einer Verhaftung durch die Gestapo jederzeit vor.“ „Da sagen sie ein paar wirklich wahre Worte Herr Schöneberg!“, seufzte der Hüne Wilhelm Schnepphorst und kratze sich dabei genüsslich am Hinterkopf.
Die vier Schicksalsgenossen hatten nach einiger Zeit in dem fensterlosen Keller jedes Zeitgefühl verloren. „Ich vermisse die Sonne.“ Irmgard Neitzel trat an das Bücherregal heran und zog eines der Bücher heraus. „Die Buddenbrooks, von Thomas Mann“ las sie halblaut und wie zu sich selbst. „Das ist eine echter Klassiker Fräulein Neitzel. Lesen sie es unbedingt, denn in Deutschland haben die Nazis Thomas Mann und seine Bücher verboten“, sagte Hermann Schöneberg an die junge Frau gewandt. Plötzlich vernahmen die vier ein Geräusch. Jedes Gespräch erstarb und eine fast spürbare Stille erfüllte die unterirdische Totenkammer. Da war es wieder. Es war ein leises Kratzen, das sich alle paar Sekunden zu wiederholen schien. Vorsichtig trat Wilhelm Schnepphorst an die dicke Eichentür heran und legte sein Ohr auf das alte Holz. Die Anwesenden hielten den Atem an. Dann veränderte sich das Kratzen zu einem leisen Klopfen. Der Hüne an der Tür zog erschrocken das Ohr von der Tür. „Da ist jemand“, flüsterte er in die Dunkelheit hinein. Niemand sprach ein Wort. Irmgard Neitzel hatte die Knie angezogen und den Kopf in den Schoß gedrückt. Plötzlich bewegte sich der schwere schmiedeeiserne Türgriff. Da versuchte jemand die Tür zu öffnen. Schnepphorst überprüfte, ob sich der Schlüssel in dem Schloss befand. Er steckte, also war die Tür definitiv abgeschlossen.
Aber würde, wer auch immer dort draußen war, sich damit zufriedengeben? Dann Stille. Nur der flache regelmäßige Atem der vier Schicksalsgenossen unterbrach die angespannte Ruhe. „Was tust du da?“ Jetzt war die Stimme von Paul Gerhard von Amsfeld zu hören. „Ich habe gesehen, dass du den Eingang der Gruft vom Efeu befreit hast und wolle einen Blick hinein werfen“, sagte eine unbekannte Stimme, die aber deutlich jünger klang, als die tiefe Baritonstimme des alten Gutsherrn. „Du kannst da nicht hinein gehen mein Sohn, der ganze Raum steht unter Wasser.“ Es folgte eine kurze Pause und Schnepphorst, der immer noch an der Tür horchte, bemerkte, dass die Türklinke sich wieder in ihre Ausgangsposition zurückbewegte. „Ich wundere mich nur darüber, dass du dir die Mühe gemacht hast das ganze Grünzeug wegzuschneiden, um dieses dunkle Loch zu beäugen. Da war doch seit Jahren niemand mehr drin.“ Offenbar standen die beiden Männer jetzt genau vor der Tür, denn die Stimme des Gutsherrn war jetzt klar und laut zu verstehen. „Ich habe mich daran erinnert, dass dort unten ein paar alte Weinkisten aus Holz liegen müssten. Die Kinder unserer Arbeiter wollten sich ein paar Seifenkisten bauen und einer der Männer hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar brauchbare Holzreste für sie hätte.“
„Wir sollten in den nächsten Tagen das Wasser abpumpen, sonst zieht die Feuchtigkeit durch das Gemäuer noch in die Wände der Kapelle“, sagte die junge Stimme. Paul Gerhard von Amsfeld murmelte daraufhin etwas Unverständliches, aber er musste irgendetwas gesagt haben, das den anderen das Interesse an der Gruft verlieren ließ. Dann hörten sie Schritte, die sich entfernten. Willy Riesler war der Erste, der es wagte, wieder zu sprechen. „Es war sein Sohn“, stellte er fest. „Ja, den Eindruck hatte ich auch“, erwiderte Irmgard Neitzel leise. „Daran können sie ermessen in was für Zeiten wir leben“, hörten sie den jüdischen Anwalt traurig sagen. “Der Vater muss den eigenen Sohn belügen, um ein paar unschuldige Menschen vor der Verhaftung durch die Gestapo zu schützen.“
*****