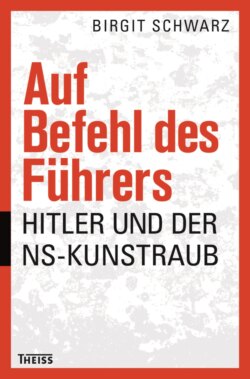Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
Der „Führervorbehalt“ und der größte Kunstraub aller Zeiten
ОглавлениеEs war wahrscheinlich der größte Kunstraub aller Zeiten: Jedenfalls stellte der amerikanische Ankläger beim Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg, Robert G. Storey, fest, dass das, was sich Hitlerdeutschland an Kunstgegenständen angeeignet hatte, alle Schätze des Metropolitan Museum of Art in New York, des Britischen Museums in London, des Louvre in Paris und der Tretjakow-Galerie in Moskau zusammengenommen übertraf.1 Dabei stützte sich Storey unter anderem auf Untersuchungen einer amerikanischen Untersuchungseinheit für Kunstraub, die Art Looting Investigation Unit (ALIU), die der amerikanische Nachrichtendienst Office of Strategic Services (OSS) im November 1944 eingerichtet hatte, um zum nationalsozialistischen Kunstraub zu recherchieren.
Die ALIU setzte sich aus hochrangigen Fachleuten, Kunsthistorikern, zusammen; für die Untersuchung des NS-Kunstraubes waren Theodore Rousseau, James Plaut und S. Lane Faison Jr. zuständig.2 Sie spürten 16 Hauptbeteiligte am NS-Kunstraub auf, verhafteten und verhörten sie, oft wochenlang. Unter den Verhörten befanden sich Maria Almas-Dietrich und Karl Haberstock, Hitlers wichtigste Kunsthändler, Heinrich Hoffmann, sein Fotograph und langjähriger Kunstberater, Kajetan Mühlmann, eine zentrale Figur für den Kunstraub in Österreich, Polen und den Niederlanden und Hermann Voss, der Nachfolger des 1942 verstorbenen Sonderbeauftragten Hans Posse. In drei Monaten, vom 10. Juni bis 15. September 1945, entstanden 13 Detailed Interrogation Reports über die einzelnen Akteure. Darauf aufbauend wurden in den folgenden drei Monaten vier thematisch angelegte Consolidated Interrogation Reports ausgearbeitet, ein Bericht über die Aktivitäten des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg (ERR), ein weiterer über die Kunstsammlung Hermann Görings und schließlich Faisons Linz-Report (Hitler’s Museum and Library), der am 15. Dezember 1945 abgeschlossen war, sowie ein Abschlussbericht.
Die Berichte waren für die Vorbereitung der Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse bestimmt, sodass Eile geboten war. S. Lane Faison musste sich innerhalb kurzer Zeit ein Bild von den Aktivitäten des „Sonderauftrags Linz“ – der informellen Kunstraub- und -verteilungsorganisation – sowie von Art und Umfang des von diesem zusammengetragenen Bestandes machen. Damit war ihm eine besonders schwierige Aufgabe zugefallen, denn während die Kunsträuber Alfred Rosenberg und Hermann Göring noch lebten und befragt werden konnten, waren Hitler und sein erster, für den Kunstraub maßgeblicher Sonderbeauftragter Hans Posse tot. Dessen Nachfolger Hermann Voss war als Zeitzeuge wenig brauchbar und lieferte nur vereinzelt verwertbare, oft (absichtlich?) widersprüchliche Informationen. Er hatte die laufenden Geschäfte weitgehend seinen Mitarbeitern Gottfried Reimer und Robert Oertel überlassen, die den amerikanischen Verhöroffizieren wiederum nicht zur Verfügung standen, da sie sich in der sowjetischen Besatzungszone befanden.
Hermann Voss gab an, keine beschlagnahmten Kunstwerke in den Bestand des „Sonderauftrags Linz“ aufgenommen zu haben. Das entsprach nicht der Wahrheit, doch war dies mit den Unterlagen, die Faison zur Verfügung standen, nicht nachzuweisen. Faisons größtes Manko war, dass er keinen Zugriff auf die Zentralregistrierung des „Sonderauftrags Linz“ hatte, da diese sich in Dresden und damit in der sowjetischen Besatzungszone befand. Die umfangreichen Karteien und die Akten des „Sonderauftrags“ waren von der Sowjetarmee beschlagnahmt worden. Selbstverständlich bemühten sich die Amerikaner um Einsichtnahme; Faison ging am 15. September 1945 noch davon aus, dass die Bemühungen von Erfolg gekrönt sein würden.3 Seine Hoffnung trog, die Russen stellten die Unterlagen und Karteien nicht zur Verfügung. Das war vermutlich eine Folge des Umstandes, dass die westlichen Alliierten auf einer Länge von etwa 650 Kilometern mehr als 150 Kilometer tief in die sowjetische Besatzungszone vorgedrungen waren und dass US-Einheiten an 34 Orten, in Bergwerken und Auslagerungsdepots, die evakuierten Objekte sowie die dazugehörigen Dokumentationen sichergestellt und entfernt hatten.4
Faison stand also wenig Material zur Verfügung, um ein Bild von Hitlers Kunstraub zu zeichnen. Elf Aktenbände Korrespondenz des „Sonderauftrags“ mit der Reichskanzlei tauchten zu spät auf, um noch ausgewertet werden zu können.5 Dennoch musste er in seinem Abschlussbericht eine Einschätzung des Umfanges der Hitler-Sammlungen abliefern. Eine ungefähre Vorstellung ließ sich, wie er annahm, über die Einlagerungen im Salzbergwerk von Altaussee gewinnen. Das Bergwerk war gegen Ende des Krieges zum zentralen Bergungsort der Hitler-Sammlungen geworden. Der amerikanische Untersuchungsoffizier erstellte eine summarische Inventarliste, die 5350 „alte Meister“ und 21 zeitgenössische Gemälde als Bestand des „Sonderauftrags Linz“ bezeichnete.6 Sie basiert auf einer Zusammenfassung der Einlagerungen im Salzbergwerk Altaussee, die im Mai 1945 von dem für das Bergwerk zuständigen Ingenieur Max Eder und dem für die Kunstwerke verantwortlichen Restaurator Karl Sieber erstellt worden war.7 Die Verfasser, beide keine Kunsthistoriker, hatten keinerlei Einblick in den Fundus des „Sonderauftrags Linz“. Der zuständige Referent des „Sonderauftrags“, Gottfried Reimer, war seit der Zerstörung Dresdens im Februar 1945 nicht mehr in Altaussee aufgetaucht. Die summarische Aufstellung, welche nur Konvolute in den verschiedenen Bergwerkräumen aufführt, war im Grunde genommen völlig unbrauchbar, weil grob mangelhaft, was die Autoren sogar angaben: „In dieser Aufstellung ist eine sehr große Anzahl von Kunstgütern, von denen z.Zt. die Einlagerungslisten nicht vorliegen, unberücksichtigt geblieben.“ So ignorierten sie etwa die 1000 Kisten des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg, obwohl diese Kunstwerke enthielten, die für Hitlers Museumsprogramm vorgesehen waren.8
Das einzige detaillierte Inventar, das Faison zur Verfügung stand, war das des Depots im Führerbau in München, das knapp 4000 Objekte umfasst. Dort waren vor allem die Ankäufe eingegangen, die der „Sonderauftrag“ in Deutschland, den besetzten Westgebieten und in Italien für das „Führermuseum“ getätigt hatte. Trotz seiner eklatanten Mängel wurde die Geschichte des „Sonderauftrags“ auf Basis von Faisons Linz-Report und damit auf der Materialbasis des Münchner Depots weitergeschrieben. Die Bild-Datenbank Sammlung Sonderauftrag Linz, die das Deutsche Historische Museum in Berlin gemeinsam mit dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen im Sommer 2008 ins Internet gestellt hat, wurde auf dem Münchner Karteibestand aufgebaut. Im Vorwort heißt es, bis 1945 seien ungefähr 560 Werke aus Beschlagnahmungen in die Sammlung des „Sonderauftrages Linz“ gelangt.9
Karl Sieber, Zusammenfassung der Einlagerungen im Salzbergwerk Altaussee, Mai 1945, Bundesdenkmalamt Wien, Archiv
Dabei hatte Faison schon 1945 im Linz-Report klar zum Ausdruck gebracht, dass der „Sonderauftrag“ Erstzugriff auf die gesamte NS-Raubkunst hatte: „Nevertheless, the Sonderauftrag Linz had first claim upon all works of art looted by Germany“.10 Er erklärte diesen daher zur kriminellen Organisation und empfahl eine Anklage vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg. Dem kamen die Ankläger jedoch nicht nach. Die Verantwortlichen des „Sonderauftrags Linz“ sind auch nicht in den Nürnberger Folgeprozessen angeklagt worden. Der Umstand, dass belastbares Beweismaterial wie etwa die zentrale Registrierung in Dresden fehlte, dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.
Tatsächlich hatte der „Sonderauftrag Linz“ Zugriff auf die Kunstraubbestände aus Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Polen, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Die sogenannte „Führerauswahl“ aus diesem Fundus lagerte nicht im Führerbau in München, sondern in anderen Depots, etwa in Berlin sowie in Klöstern und Schlössern in Österreich und Bayern. Zum Zugriff berechtigt wurde der „Sonderauftrag“ durch den „Führervorbehalt“, ein Erstzugriffsrecht auf Raubkunst, das sich Hitler selbst eingeräumt hatte. Zum ersten Mal formulierte ein Rundschreiben der Reichskanzlei vom 18. Juni 1938 diesen Anspruch, und zwar hinsichtlich der in Österreich nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich beschlagnahmten jüdischen Kunstsammlungen. Der Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, sandte das Schreiben an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, an verschiedene Reichsminister sowie an den Reichsstatthalter in Österreich, Arthur Seyß-Inquart, und den „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“, Josef Bürckel.
Der „Führervorbehalt“ vom 18. Juni 1938, Bundesdenkmalamt Wien, Archiv
„Bei der Beschlagnahme staatsfeindlichen, im besonderen auch jüdischen Vermögens in Österreich sind u.a. auch Bilder und sonstige Kunstwerke von hohem Wert beschlagnahmt worden. Der Führer wünscht, dass diese zum großen Teil aus jüdischen Händen stammenden Kunstwerke weder zur Ausstattung von Diensträumen der Behörden oder Dienstzimmern leitender Beamter verwendet, noch von leitenden Persönlichkeiten des Staates und der Partei erworben werden. Der Führer beabsichtigt, nach Einziehung der beschlagnahmten Vermögensgegenstände die Entscheidung über ihre Verwendung persönlich zu treffen. Er erwägt dabei, Kunstwerke in erster Linie den kleineren Städten in Österreich für ihre Sammlungen zur Verfügung zu stellen.
Indem ich Ihnen hiervon Kenntnis gebe, bitte ich im Auftrag des Führers, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, damit eine Verfügung über das in Österreich beschlagnahmte Vermögen bis auf weiteres unterbleibt.“11
Ein Jahr später wurde der Anspruch Hitlers auf jene Kunstwerke ausgedehnt, die nach Maßgabe des österreichischen Denkmalschutzgesetztes sichergestellt waren, und bald darauf auch auf den Kunstbesitz der aufgelösten österreichischen Klöster und Stifte erweitert. Durch Rundschreiben vom 9. Oktober 1940 wurde der „Führervorbehalt“ für das übrige Reichsgebiet und durch Erlass vom 18. November 1940 für die besetzten und noch zu besetzenden Gebiete ausgesprochen. Am Ende des Dritten Reiches stand die gesamte Raubkunst Europas unter „Führervorbehalt“ und die „Führerauswahl“ daraus, die Hitler für sein Verteilungsprogramm zur Verfügung stand, betrug nicht 560 Objekte, wie die offizielle deutsche Datenbank angibt, sondern annäherungsweise das Hundertfache.