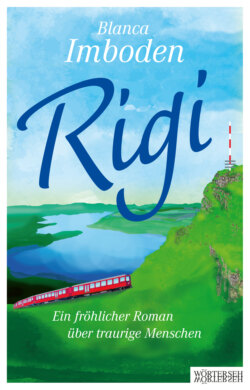Читать книгу Rigi - Blanca Imboden - Страница 14
4 Rigi-Pinguine
ОглавлениеBei sonnigstem Wetter fahre ich mit Moritz mit der großen Seilbahn von Weggis aus auf die Rigi. Die Aussicht wird mit jedem gewonnenen Höhenmeter schöner. Der Vierwaldstättersee tut sich vor uns auf, mit dem Urnersee und dem Küssnachter Becken. Stolz steht der Pilatus da, und gefühlt tausend andere Berge präsentieren sich, beispielsweise das Stanserhorn oder der Niederbauen. Eine bezaubernde, beeindruckende Aussicht. Es ist, als würde sich die Welt uns zu Füßen legen, mehr und mehr.
Sofort fühle ich den altbekannten Stich im Herzen: Das möchte ich jetzt mit Mario erleben, ihm wenigstens ein Foto ins Büro senden können oder am Abend begeistert davon erzählen dürfen. So ist es immer, wenn ich etwas Schönes erlebe. So ist es erst recht, wenn ich etwas Schlechtes erlebe.
Abgesehen davon: Ich sollte viel öfter in die Berge fahren. Schon in der Bahn spüre ich, wie gut mir das tut, abzuheben, alles unter mir zu lassen, in die Höhe zu schweben, die Welt von oben zu betrachten.
Moritz und ich sind ein wenig verlegen, wir treffen uns ja erstmals außerhalb der Gruppe. Er trägt wie immer ein kariertes Hemd und Jeans, dazu eine Jeansjacke. Seine Haare stehen in alle Richtungen von seinem Kopf ab und haben rein gar nichts mit einer Frisur zu tun. Ob das Absicht ist? Wir wissen so viel voneinander und doch eigentlich nichts. Ich weiß nicht einmal, was Moritz arbeitet.
Ich frage ihn, und er erzählt: »Ach, ich habe eine kleine Autowerkstatt in Weggis.« Er zeigt mir seine riesigen Hände, die teilweise ein bisschen schwarz sind, vor allem um die Fingernägel herum. »Sorry, ich lag gerade noch unter einem Auto. Ein Notfall. Ich konnte mal wieder nicht Nein sagen. Ich liebe halt meine Arbeit. Es ist das, was ich immer machen wollte. Aber ich habe zuerst eine Bürolehre gemacht, weil meine Eltern für mich andere Pläne hatten. Das hat mir dann im Nachhinein auch nicht geschadet.«
Ich mag zufriedene Menschen, die sich ihre Träume erfüllt haben. Viele hängen in unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen fest, nur weil sie den Mut und die Energie nicht aufbringen, etwas zu ändern, bis sie irgendwann zu alt dafür sind. Und mit ihrer Unzufriedenheit vergiften sie alle um sich herum. So war es bei meinem Vater. Er hatte Schreiner gelernt, weil Opa ihm diesen Beruf aufgedrängt hatte. Er war nie gern Schreiner. Aber er blieb es. In den letzten Berufsjahren hat er nur noch Küchen eingebaut. Er beschwerte sich darüber, wie wenig Qualität noch gefragt sei. Er jammerte: »Es muss alles nur schnell gehen. Wenn wir einen Fehler machen, etwas nicht so genau zusammenpasst, lassen wir es trotzdem so. Nur wenn der Kunde reklamiert, wird nachgebessert. Wenn er es nicht merkt, haben wir Zeit und Geld gespart. Das ist doch keine Arbeitsmoral.« Aber er hat einfach weitergemacht und davon geträumt, was er alles einmal anstellen werde, wenn er pensioniert sei. Leider ist er kurz nach seiner Pensionierung gestorben. Sein unzufriedenes Leben und sein viel zu schnelles Ableben haben mich sehr geprägt. Zumindest verschiebe ich genau deshalb nichts, was mir wichtig ist, auf später und noch später. Vor allem nicht das Leben.
Ich erzähle Moritz ein wenig von meiner Arbeit als Schreibende.
»Und was hat dein Mario gearbeitet?«, will er dann wissen.
»Er war bei der Steuerverwaltung angestellt«, antworte ich.
Moritz lacht.
Ich habe auch gelacht, als mir Mario das einst, als wir uns kennen lernten, erzählte. Man bekommt keinen Sympathiebonus, wenn man sagt, dass man als Steuerbeamter arbeitet. Mario fand das nicht schlimm. Auf entsprechende Bemerkungen oder Blicke erwiderte er immer: »Ihr wollt Schulen, Spitäler, Straßen. Ich beschaffe die Kohle dafür.« Damit brachte er die Leute schnell zum Schweigen. Mario war durch und durch ein Zahlenmensch. Er wühlte sich gern durch undurchdringlich scheinende Abrechnungsdschungel, um den entscheidenden Fehler zu finden, den kleinen Betrug oder den irrtümlichen Zahlendreher.
Auf Rigi Kaltbad, 1433 Meter über Meer, setzen Moritz und ich uns zuerst auf dem Dorfplatz ins Restaurant, trinken Kaffee und essen Rüeblitorte dazu. Wir reden gar nicht so viel, schauen einfach, beobachten, atmen die herrliche Höhenluft und lassen uns die Sonne auf die Nase scheinen. Es riecht anders hier oben, würziger, frischer. Auf Rigi Kaltbad könnte man in die Zahnradbahn nach Rigi Kulm umsteigen, die von Vitznau aus startet. Es herrscht ein emsiges Kommen und Gehen aller Nationalitäten: Wanderer, Ausflügler, Touristen. Kinder fahren auf Dreiradvelos und Laufrädern über den Platz. Hunde bellen sich an. Ein Reiseleiter schreit nach einem verlorenen Gruppenmitglied. Dazwischen gibt es kleine Momente unglaublicher Ruhe.
»Man sollte viel mehr in die Höhe reisen«, sage ich irgendwann. »Es tut gut.«
»Stimmt«, bestätigt Moritz. »Ich habe ein Jahresabonnement der Rigi-Bahnen, benütze es aber viel zu wenig. Die Rigi ist mein Hausberg, war es schon immer.«
Nach dem Kaffee spazieren wir Richtung Känzeli, einem der besonderen Aussichtspunkte der Rigi, wo wir eine Weile stehen und schauen. Ich bin beeindruckt. Wir leben wirklich im Paradies.
»Dort ist das Stanserhorn. Dahinter siehst du Eiger, Mönch und Jungfrau …«, erklärt Moritz und stochert mit dem Zeigefinger in die entsprechende Richtung.
Schon lustig, dass Männer immer das Gefühl haben, den Frauen die Welt erklären zu müssen. Die Berge sind mir bestens bekannt. Ich war eine Gipfelstürmerin. Zugegeben: früher einmal – ganz früher. Mario und ich waren damals sportlich und ehrgeizig. Wir wollten auf jeden Berg rund um den Vierwaldstättersee. Es hat Spaß gemacht, ein Ziel, eine Herausforderung, einen sportlichen Plan zu haben. Aber dann wurde ich schwanger, und mit Marie veränderte sich unser Leben total. Ich glaube, wir brauchten keine sportlichen Herausforderungen mehr, wo doch das Leben als junge Familie die größte Herausforderung überhaupt war, zumal Marie ein Schreibaby war und uns manchmal fast zum Wahnsinn und in die totale Erschöpfung trieb.
Auf dem Rückweg vom Känzeli besuchen wir die Felsenkapelle, weil wir bis zur nächsten Talfahrt noch Zeit übrighaben. Die Kapelle wurde direkt an den Felsen gebaut, versteckt hinter Felsen, eingebettet in Felsen.
Hier stehe schon seit 1585 eine Kapelle, weiß Moritz. Diese hier sei allerdings erst 1779 gebaut worden. »Die Sage berichtet, dass sich Anfang des 14. Jahrhunderts drei fromme Schwestern in diese Wildnis zurückgezogen hatten, um gewalttätigen Vögten zu entfliehen, die sie entführen wollten«, beginnt mir Moritz nun ausführlich zu erzählen. »Die jungen Frauen führten hier ein so heiliges Leben, dass nach ihrem Tod eine Quelle mit heilendem Wasser entsprungen ist. Schwesternborn nannte man die Quelle. Viele Menschen suchten Heilung, indem sie im kalten Quellwasser badeten. Daher stammt der Name Kaltbad. Noch heute kommen Leute mit leeren Flaschen und holen hier Wasser.«
Ich wusste gar nicht, dass hier einmal ein Heilbad war. Gut, ich wusste bisher gar nichts über die Rigi, war ja auch viel zu selten da.
Moritz ereifert sich: »Doch, doch! 1540 findet man eine erste Erwähnung der Kaltbad-Quelle als heilende Kraft, nachdem Barthli Joler aus Weggis beim Baden im kalten Wasser gesund geworden war. Woran er litt, weiß allerdings keiner mehr. Wenig später kamen schon über hundert Badetouristen täglich nach Rigi Kaltbad. Von einem Sonntag im Jahre 1601 ist bekannt, dass hundertfünfzig Frauen und Männer in diesem Wasser badeten.«
Moritz verstummt, und wir treten in den Vorraum der Kapelle und zünden Kerzen für unsere Verstorbenen an. Dann setzen wir uns auf eine der Holzbänke, hängen unseren Gedanken und Gefühlen nach.
»Ich hasse meine Mutter«, flüstert mir Moritz plötzlich zu.
Was?
Wie?
Ich sitze wie versteinert da.
Was für ein Geständnis!
Ich dachte bisher, Moritz sei ein extremes Beispiel für ein Muttersöhnchen und seine übertriebene Mutterverehrung hätte ihn in unsere Trauergruppe getrieben.
»Aber du weinst doch immer um sie?«, frage ich vorsichtig.
»Sie war so intrigant, so manipulativ, bis zum Schluss. Sie versuchte immer, alle gegeneinander auszuspielen. Lange hat sie versucht, mich und Petra – meine Frau – auseinanderzubringen. Sogar als meine Mutter krank war, hat sie noch ständig ihre Spielchen gespielt. Sie hat dem Personal im Pflegeheim, wo sie die letzten Monate lebte, erzählt, ich würde sie schlecht behandeln. Und mir hat sie erzählt, sie würde vom Personal schlecht behandelt. Das machte alles noch schwieriger, als es mit ihrer Demenzerkrankung ohnehin schon war. Ich schämte mich richtig für die Bosheit meiner Mutter. Sie war mein ganzes Leben lang immer nur gegen mich, und ich habe keine Ahnung, warum das so war. Ich hasse sie.«
Wir sitzen eine Weile ruhig beieinander und spüren seinen Worten nach. Was soll ich dazu sagen? Rosmarie, unsere Gruppenleiterin, behauptet ja, Ratschläge seien immer auch Schläge, daher solle man damit sehr zurückhaltend sein.
Doch Moritz bittet mich leise: »Sag etwas!«
Ich überlege nicht mehr und schwatze einfach drauflos, erzähle ihm, was mir gerade durch den Kopf geht: »Ich glaube, an deiner Stelle würde ich zuerst das Wort hassen streichen. Ganz. Aus deinem Wortschatz und aus deinem Denken. Hass erdrückt alles, auch den, der selber hasst. Du bist deiner Mutter vielleicht böse, vor allem aber wohl enttäuscht und wahnsinnig traurig. Vielleicht weil du jetzt, wo sie gestorben ist, weißt, dass die Chance, eine liebende Mutter zu haben, auch gestorben ist. Für immer. Ich glaube, du trauerst vor allem um das, was du vermisst und nie bekommen hast.«
Bin ich schon zu weit gegangen? Ich mustere Moritz vorsichtig von der Seite her. Er nickt. Er hat Tränen in den Augen, aber er nickt.
»Weiter!«, fordert er mich heraus.
»Ich habe einmal einen wunderschönen Satz gelesen, ich glaube auf Facebook: ›Werde selber zu dem Menschen, der dir in deiner Kindheit gefehlt hat.‹ Also hör auf zu weinen und sorge dich um deine Familie, deine Kinder, deine Frau. So liebevoll, wie du dir das von deiner Mutter gewünscht hättest. Denn die Liebe, die wir geben, kommt wieder zurück. Meistens jedenfalls.«
Ich höre mich an wie eine Fernsehpredigerin. Eine schlechte.
Moritz aber sagt: »Weiter!«
»Ich glaube, eine wichtige Lebensweisheit hat uns Rosmarie mit auf den Weg gegeben: ›Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.‹ Erinnerst du dich? Ich habe den Satz lange mit mir herumgetragen und ihn nie so ganz verstanden. Könnte er in deinem Fall nicht heißen, dass du jetzt selber für das Kind in dir sorgen musst, und das besser, als es deine Mutter tat? Hab Spaß! Gönn dir etwas! Mach all die verrückten Dinge, die du immer schon tun wolltest. Besuch mit deiner Frau einen Tangokurs oder lerne, in der Tiefsee zu tauchen. Und vor allem: Sei nachsichtig mit dir – und liebevoll.«
»Ist das alles?«
»Verzeih deiner Mutter, das wäre wohl das Größte und Wichtigste und Wirksamste. Aus irgendeinem Grund war sie so, wie sie war, und konnte nicht so sein, wie du sie dir gewünscht hättest. Aber dieser Grund ist jetzt, wo sie nicht mehr lebt, nicht mehr wichtig. Verzeihen hilft meistens, wenn nichts mehr gelöst werden kann. Aber es ist eine Königsdisziplin. Das kann nicht jeder. Ich auch nicht immer. Ich bin oft nachtragend. Doch man kann es zumindest versuchen. – Jetzt bin ich fertig. Entschuldige meine lange Ansprache, aber du hast mich darum gebeten.«
Moritz nimmt meine Hand in seine, räuspert sich und sagt dann: »Noch nie, liebe Eliane, habe ich mit jemandem so offen über meine Mutter geredet. Ich glaube, ich habe heute Dinge ausgesprochen, die noch keiner je von mir gehört hat. Keine Ahnung, was da über mich gekommen ist. Und – Eliane – noch nie hat mir jemand so deutlich – und auch so hilfreich – seine Meinung gesagt. Danke.«
Ich bin ganz gerührt und bewegt.
Wir sitzen beisammen wie die Pinguine auf dem schönen Foto. Es fehlen uns nur noch die Flossen. Ich muss schmunzeln.
»Was ist?«, will Moritz wissen. Er hat inzwischen seine Tränen getrocknet.
»Ich sag nur: Pinguine auf der Rigi!«
Jetzt grinst auch Moritz.
Schließlich will er etwas über meine Mutter hören. Irgendetwas.
Da muss ich kurz überlegen und erzähle dann: »Meine Mutter war eine schöne, elegante Frau. Sie war warmherzig und empathisch, herzlich und witzig.«
»Aber?«, fragt Moritz, als hätte er gespürt, dass da noch etwas kommen muss.
»Sie hat nach dem frühen Tod meines Vaters einfach aufgehört.«
»Aufgehört? Womit?«
»Mit allem. Ja, sie hat mit dem Leben aufgehört. Ihr Interesse an allem und jedem erlosch. Das tat mir weh. Ich hatte irgendwie keine Bedeutung mehr für sie. Sie wurde mürrisch, einsilbig, zog sich zurück. Irgendwann starb sie – viel zu jung – an einer blöden Grippe, packte den erstmöglichen Abgang.«
»Wirfst du ihr das vor? Ernsthaft?«, fragt Moritz staunend.
»Nein. Es macht mich nur traurig. – Oder doch. Manchmal ist da schon ein Vorwurf. – Ich weiß nicht. Sie war so stark, hat sich an der ständigen Unzufriedenheit meines Vaters nicht aufgerieben, sondern ihr sonniges Gemüt dagegengesetzt. Und dann das! – Ich habe jedenfalls daraus gelernt. Ich lasse mich sicher nicht so gehen.« Und während ich das so sage, glaube ich selber daran.
Moritz bestätigt mich: »Das merke ich. Das ist gut so.«
Wir verlassen die schöne Kapelle und gehen durch den Felsdurchgang, wo Moritz stehen bleibt und erklärt: »Das hier ist einer der größten Kraftplätze der Rigi. Der ganze Berg ist ein Kraftort, aber hier – genau hier – sollen 23 000 Bovis-Einheiten gemessen worden sein.«
»Bovis-Einheiten? Was ist denn das?«, frage ich erstaunt.
»Ganz genau weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass die Energiequalität eines Ortes mit einem Biometer gemessen werden kann, das ein französischer Physiker namens Bovis entwickelt hat. Die Grundskala liegt irgendwo zwischen null und zehntausend Einheiten. Bei mehr als zehntausend Einheiten spricht man von einem Kraftort.«
»Aha. Da weißt du ja doch allerhand darüber. Und das ist kein Humbug?«
Moritz zuckt mit den Schultern und meint: »Keine Ahnung, aber Bovis’ Methode soll unterdessen auch in wissenschaftlichen Kreisen anerkannt sein.«
Wie auch immer diese Kräfte heißen mögen und gemessen werden, es fühlt sich jedenfalls gut an, hier zwischen den zwei imposanten Felsen zu stehen und sie zu spüren und aufzunehmen.
Ich überlege gerade noch, was für mich selbst einen Kraftort ausmacht, da umarmt mich Moritz und sagt: »Danke, Eliane.«
Und in dieser Umarmung bleiben wir einen Moment lang. Pinguine halt. Nicht mehr und nicht weniger.
Am Ende kehren wir beide gestärkt, bereichert und aufgemuntert von diesem Ausflug zurück. Meine Erwartungen wurden nicht nur übertroffen, sie sind explodiert wie ein Feuerwerk. Ich machte mich auf ein mühsames Treffen gefasst und hatte eine schöne Begegnung in herrlichster Umgebung. Die Zeit verging wie im Flug. Ich komme zwar heim in die leere Wohnung und spüre den üblichen Schmerz: Mario ist nicht da. Aber ich hatte immerhin einen Nachmittag, der mir wirklich guttat. Und ich glaube, ich tat Moritz gut.
Ich muss kurz auf dem Sofa eingenickt sein. Die frische Höhenluft hat mich müde gemacht. Jedenfalls schrecke ich auf, als plötzlich jemand vor mir steht.
»Mama? Alles okay? Mama!«
Es ist Marie, die wieder einmal unangemeldet zu Besuch gekommen ist. Ja, ich freue mich, und ein Besuch muss nicht immer angemeldet sein. Aber muss mich meine Tochter jedes Mal so erschrecken?
»Ja, ja, ja«, stammle ich. Ich setze mich vorsichtig auf, bin noch nicht richtig wach. »Ich habe nur kurz geschlafen.«
Warum erkläre ich mich?
Marie bietet an, mir Kaffee zu machen. Ich finde das nett und folge ihr in die Küche, wo sie sofort zu hantieren anfängt.
»Geht es dir gut?«, frage ich vorsichtig, als wir dann wieder auf dem Sofa sitzen.
»Geht so«, antwortet sie.
Sie scheint keine Lust zu haben, etwas zu erzählen. Warum besucht sie mich dann?
»Was heißt das: Geht so?«, bohre ich deshalb.
»Ich hatte vorhin einen Anruf von Peter, einem Schulkollegen, mit dem ich wieder häufiger Kontakt habe.«
»Schön«, sage ich.
Ich bin froh um jeden Kontakt, den meine schöne Tochter hat.
»Er hat dich gesehen«, sagt sie.
»Gesehen?«, frage ich verständnislos.
Man darf mich sehen. Ich bin kein Geheimnis. Ich bin nicht unsichtbar. Also was will mir Marie sagen?
»Du warst auf der Rigi.«
»Stimmt.«
Ach, du meine Güte! Langsam verstehe ich, wo Maries Problem liegt und warum sie hier aufgekreuzt ist. Aber so leicht mache ich es ihr nicht. Ich warte ab und gebe mich meinerseits wortkarg.
»War es schön?«, fragt Marie harmlos.
»Ja, wirklich schön. Ich sollte viel öfter in die Berge fahren. Sie tun gut. Kommst du auch mal mit?«
»Mama! Du warst mit einem Mann da!«
»Stimmt. Moritz hat mich eingeladen.«
»Moritz? Wer ist das? Warum weiß ich nichts von einem Moritz? Peter hat euch gesehen, in inniger Umarmung!«
Na, jetzt ist es wenigstens raus. Ich lache. Ich muss lachen, denn sonst müsste ich weinen. Ich soll mich also bei meiner Tochter für jedes Treffen mit einem Mann rechtfertigen?
Ich spüre, dass ich dennoch etwas sagen muss, weil sie sonst wahrscheinlich ganz durchdreht: »Marie, Moritz ist ein Bekannter aus meiner Trauergruppe. Ein privates Treffen gehörte zu unserer Hausaufgabe. Völlig harmlos.«
Gern würde ich anfügen: Und wenn es nicht harmlos wäre, ginge es dich auch nichts an. Aber ich liebe meine Tochter, möchte ihr nicht wehtun. Und ich möchte so gern wieder einen lockeren, fröhlichen, liebevollen Umgang mit ihr haben. Stattdessen verletzen wir uns gegenseitig.
Immerhin bleibt Marie heute länger. Wir kochen und essen zusammen. Wir plaudern über dies und das, aber es fehlt das Lockere, das Selbstverständliche. Es ist, als müsste ich ständig über Eis gehen, extrem vorsichtig und behutsam sein. Trotzdem ist dieses Treffen irgendwie ein Fortschritt, vielleicht sogar ein Neuanfang, zumindest eine Chance.
Marie. Unsere wunderschöne Tochter. Sie wird immer mein Kind bleiben, ist aber längst eine wirklich attraktive Frau. Sie leitet erfolgreich die Musikschule Vitznau-Weggis, ist aktiv und innovativ. Marie ist beliebt, obwohl sie natürlich in ihrer Funktion immer zwischen Behörden, Eltern, Lehrerschaft und Kindern steht. Bei ihrer Berufswahl ließ sie mich zum Glück mitreden, zumindest als Mario sie zur Bürokauffrau ausbilden lassen wollte. Er könne ihr eine Lehrstelle beim Kanton besorgen, und so habe sie gleich einen sicheren Arbeitsplatz und habe ausgesorgt.
Ausgesorgt!
Ein sicherer Arbeitsplatz!
Ich konnte Mario nicht verstehen.
Oder doch: Ich verstand ihn schon. Ihm war Sicherheit immens wichtig, und er liebte seinen Job auf dem Amt. Und für seine Tochter wollte er natürlich das Allerbeste. Es fiel ihm nur sehr schwer, zu begreifen, dass Marie selber wusste, was für sie das Allerbeste war.
Ja, ich verstand Mario, vor allem aber verstand ich Marie und ihre Liebe zur Musik. Doch die ließ sich natürlich nicht so einfach mit einer Lehre verbinden. Ich holte mir Schützenhilfe bei Maries Klavierlehrerin, die dann mehrmals bei uns antanzte und Mario erklärte, wie begabt ihre Lieblingsschülerin sei und wie viele Möglichkeiten sie – je nach Studium – als Musikerin haben würde. Zudem versicherte sie meinem Steuerbeamten, dass Marie bestimmt nicht unter der Brücke landen würde oder sich am Ende als Straßenmusikantin durchschlagen müsse.
Die Stunden, die Marie und ich heute miteinander verbringen, empfinde ich mit der Zeit trotz der gewissen Spannung fast schon als harmonisch. Wir streiten nicht mehr. Das tut uns beiden gut. Nur am Ende zerstöre ich den Frieden beinah wieder, weil ich Marie unseren Staubsaugerroboter mitgeben will. Ich ertrage das Gerät nicht mehr. Es war Marios Lieblingsspielzeug. Er behandelte den Staubsauger wie ein Haustier. Ich hörte ihn manchmal mit ihm sprechen, wenn er dachte, ich sei beschäftigt. Mario nannte den Roboter Kurt, und der Klang seiner Stimme war sehr liebevoll, wenn er fragte: »Was hast du, lieber Kurt? Warum saugst du nicht? – Lass mal sehen! – Oh, du Armer! Du hast dich mit einer Schnur stranguliert. Warte, das haben wir gleich!«
Marie versteht nicht, warum ich das Ding nicht mehr haben will, klemmt es sich dann doch kopfschüttelnd unter den Arm und geht. Immerhin lädt sie mich vorher noch zu einem Musikschulkonzert ein. Da sitze ich immer in der ersten Reihe. Das hat Tradition.
»Du kommst doch, Mama?«, versichert sie sich.
»Ganz bestimmt!«, verspreche ich.