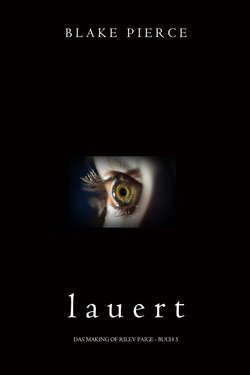Читать книгу Lauert - Блейк Пирс - Страница 6
PROLOG
ОглавлениеKimberly Dent stellte ihren Kragen gegen die Kälte hoch. Sie war später als sonst unterwegs, aber es war nur ein kurzer, sicherer Weg zu ihr nach Hause vom Haus ihrer Freundin Goldie Dowling. Die Nacht war nicht unangenehm kalt und Kimberly gefiel es, wie die kühle Luft auf ihren Wangen brannte und dass sie ihren eisigen Atem sehen konnte. Es war eigentlich sogar sehr schön und die Straßenlaternen beleuchteten die Überbleibsel des Schneefalls von letzter Woche.
Kimberly war sich sicher, dass ihre Eltern nichts dagegen haben würden, dass sie so spät noch unterwegs war. Ihre Schulnoten waren gut und Mom und Dad vertrauten darauf, dass sie sich nicht in Geschichten verstricken würde –– nicht, dass es besonders viele Geschichten zum verstricken gab, in einer kleinen, langweiligen Stadt wie Dalhart. Außerdem schliefen beide ihrer Eltern bestimmt mittlerweile. Wie die meisten Menschen in dieser Nachbarschaft gingen sie immer früh zu Bett.
Sie summte eine Pop Melodie, merkte aber, dass sie nicht wusste, um welches Lied es sich handelte.
Wahrscheinlich irgendetwas Neues, was ich im Radio gehört habe.
Es war komisch, dass sie einen Ohrwurm von einem Lied hatte, das sie nicht einmal kannte. Aber das schien ihr in letzter Zeit oft zu passieren. Natürlich würde auch dieses Lied eines Tages genauso vertraut sein, weil ein altes Paar Schuhe. Und doch würde sie niemals in der Lage sein, sich daran zu erinnern, wann und so sie es genau zum ersten Mal gehört hatte.
Dieser Gedanke machte sie irgendwie traurig.
Dann wiederum war dieser ganze Abend irgendwie traurig gewesen.
Goldie und sie hatten all die üblichen Dinge getan, die sie über die Jahre verbunden hatten –– die Fingernägel der anderen lackiert, sich gegenseitig frisiert, zu einigen ihrer Lieblingslieder getanzt, Karten gespielt, etwas ferngesehen.
Doch dann hatten sie sich gestritten –– oder zumindest war Goldie sauer auf Kimberly geworden.
Und das wegen einer Nichtigkeit, dachte Kimberly.
Kimberly hatte nichts getan, außer Goldie zu fragen, ob diese sich sicher war, dass sie nach ihrem Schulabschluss im Frühjahr hier in Dalhart bleiben wolle. Goldie hatte sie deswegen angefaucht.
„Willst du sagen, ich soll Clint nicht sofort heiraten?“, wollte Goldie wissen.
Kimbely war entrüstet. Sie wusste, dass Goldie und Clint es ernst miteinander meinten. Sie waren schon seit der Mittelstufe zusammen. Aber Goldie hatte nie irgendetwas von Heirat gesagt. Und falls Clint Goldie einen Antrag gemacht haben sollte, so hatte Goldie das sicherlich nicht erwähnt.
Natürlich wusste Kimberly, dass Goldies Eltern begeistert sein würden, wenn sie Clint heiraten und hier in Dalhart ansässig werden würde, wenn sie direkt Kinder haben würde. Doch das schien nie Goldies eigenen Vorstellungen entsprochen zu haben.
Jedenfalls nicht bis zum heutigen Abend.
Dann hatte Kimberly den Fehler begangen, Goldie an ihren langjährigen Traum zu erinnern, nach New York oder L.A. zu ziehen und eine Schauspielerin zu werden.
„Ach, werd‘ erwachsen“, hatte Goldie gesagt. „Wir sind schon zu alt für diese kindischen Träumereien.“
Diese Worte hatten Kimberly wirklich getroffen, aber nicht so hart wie das, was Goldie als Nächstes sagte.
„Oder glaubst du immer noch, dass du eine Olympiagymnastin wirst?“
Kimberly war entsetzt gewesen. Nein, sie hatte nicht mehr davon geträumt, seit sie zwölf oder dreizehn gewesen war. Es erschien ihr gemein von Goldie, dass sie das aus dem nichts wieder hervorgeholt hatte.
Trotzdem hoffte Kimberly auf viel mehr, als Dalhart zu bieten hatte. Sie konnte es kaum erwarten hier raus zu kommen. Sie dachte sich, dass sie direkt nach Memphis ziehen und den ersten Job annehmen würde, den man ihr anbot, um zur Abwechslung mal das Großstadtleben zu genießen.
Sie hatte das bisher noch zu niemandem erwähnt –– nicht einmal zu Goldie. Und der heutige Abend hatte sich ganz bestimmt nicht wie der richtige Zeitpunkt angefühlt, um es ihr zu sagen. Kimberly war sich sicher, dass ihre Eltern gegen jedwede derartige Idee sein würden. Sie hoffte bloß, dass sie stark genug sein würde, um auf dem zu beharren, was sie wollte, wenn die Zeit zum Abschied kommen würde.
Sie hatte nun die Hälfte ihres Weges hinter sich und summte immer noch dieselbe Melodie, wobei sie sich immerzu fragte, welches Lied es war. Dann hörte sie ein komisches, schrilles Geräusch. Zuerst dachte sie, dass es der Wind war. Doch eigentlich gab es grade mal eine leichte Brise in der Luft.
Sie blieb abrupt stehen und horchte.
Irgendjemand pfeift! begriff sie.
Nicht nur das. Irgendjemand pfiff dieselbe Melodie, die sie soeben gesummt hatte.
Plötzlich hörte das Pfeifen auf.
Sie rief leise, aber bestimmt: „Bist du das, Jay? Wenn ja, ist das nicht gerade witzig.“
Ihr Freund Jay hatte vor etwa einer Woche mit ihr Schluss gemacht, und seither benahm er sich wie ein Stalker. Sie hatte mitbekommen, dass er sie vor seinen männlichen Freunden schlecht redete und sich beschwerte, dass sie nicht für ihn „die Beine breitmachen“ wollte. Natürlich war das genau der Grund, aus dem er ihre Beziehung beendet hatte, aber Kimberly fand nicht, dass das sonst irgendjemanden etwas anging.
Und nun musste Kimberly sich fragen –– stellte Jay ihr nach?
Sie seufzte und dachte: Ich wäre nicht überrascht.
Sie schüttelte den Kopf und ging weiter.
Dann begann das Pfeifen erneut.
Kimberly ging schneller und schaute sich andauernd um, während sie versuchte festzustellen, wo das Pfeifen herkam. Sie konnte es einfach nicht bestimmen. Aber sie begann zu hoffen, dass es doch Jay war. Der Gedanke, dass es einer von Jays Freak-Freunden sein könnte gefiel ihr überhaupt nicht. Und sie wagte es nicht, sich vorzustellen, dass es jemand sein könnte, den sie nicht einmal kannte.
Während sie weiterlief, schaute sie sich auf all die Häuser um, in denen die Menschen lebten, die sie ihr gesamtes Leben lang gekannt hatte. Sollte sie an einer dieser Türen klopfen, damit sie irgendjemand rein ließ?
Nein, es ist spät, dachte sie.
Sie konnte in den Fenstern keine Lichter sehen. Diese Menschen schliefen mittlerweile wahrscheinlich schon alle. Selbst wenn nicht, so würden sie sicherlich nicht erfreut sein, zu so später Stunde noch gestört zu werden. Und ihre Eltern würden ausrasten, wenn sie erfuhren, dass sie die Nachbarn so spät noch belästigte.
Das Pfeifen verstummte erneut, doch das beruhigte Kimberly kein Bisschen. Die Nacht erschien ihr nun kälter und dunkler und gruseliger, als vor nur wenigen Minuten.
Als sie um eine Ecke bog, sah sie, dass in der Nähe ein Kleintransporter geparkt war. Seine Scheinwerfer brannten und der Motor lief.
Sie atmete erleichtert aus. Sie erkannte das Fahrzeug zwar nicht wieder, aber wenigstens war es irgendjemand. Wer auch immer hinter dem Steuer saß, würde sie sicherlich die restliche kurze Strecke zu ihrem Haus fahren.
Sie lief zum Wagen rüber und merkte, dass die Seitentür offenstand. Sie schaute hinein und sah, dass der leere, offene Innenraum von den Vordersitzen durch eine Art Gitter abgetrennt war. Sie konnte niemandem im Inneren des Wagens erkennen.
Kimberly fragte sich, ob der Fahrer womöglich Motorprobleme gehabt hatte und sich vielleicht gerade nach Hilfe umsah. Wenn es ein Fremder war, der nicht von hier kam, würde er nicht wissen, an wen er sich wenden sollte.
Vielleicht kann ich helfen, dachte sie.
Sie suchte in ihrer Handtasche nach ihrem Handy, denn sie dachte, sie könnte ihren Dad anrufen. Doch dann zögerte sie einen Moment lang, unsicher, ob sie Dad wirklich aufwecken wollte, selbst wenn es darum ging einem verirrten Fremden zu helfen.
Sie hörte Schritte, die sich näherten und als sie sich umdrehte, erblickte sie ein bekanntes Gesicht.
„Ach, du bist es...“, sagte sie und verspürte eine momentane Erleichterung.
Doch sein Gesichtsausdruck ließ sie alle Worte verschlucken, die hätten folgen können. Sie hatte seinen Blick noch nie so kalt und hart erlebt.
Ohne ein Wort zu sagen, griff er nach ihr und riss ihr die Handtasche und das Handy aus der Hand.
Nun stieg Angst in Kimberly hoch. Die Dinge, die sie tun könnte, rasten durch ihren Kopf.
Um Hilfe schreien, sagte sie sich. Jemanden aufwecken.
Doch plötzlich wurde sie hochgehoben und gewaltsam in den Kleintransporter geworfen.
Die Tür knallte zu und die Innenbeleuchtung erlosch.
Sie fummelte nach dem Türgriff, doch stellte fest, dass die Tür verschlossen war.
Endlich kam Kimberlys Stimme wieder.
„Lass mich hier raus!“, schrie sie und hämmerte gegen die Tür.
Dann ging die Fahrertür auf und der Mann kletterte hinein.
Der Kleintransporter fuhr los.
Kimberly klammerte sich am Gitter fest, das sie vom Fahrer trennte, und forderte: „Was machst du? Lass mich hier raus!“
Doch das Fahrzeug fuhr immer weiter durch die Straße und Kimberly wusste, dass niemand in dieser verschlafenen Nachbarschaft sie hören konnte.