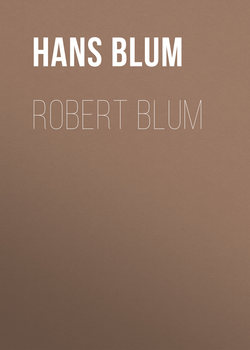Читать книгу Robert Blum - Blum Hans - Страница 3
2. Schule und Kirche
ОглавлениеVieles von dem, was erzählt wurde und noch zu berichten sein wird, ist nur dann für möglich zu halten, wenn man versucht, in die damaligen öffentlichen und wirthschaftlichen Zustände sich einzuleben. Hier können selbstverständlich nur Andeutungen gegeben werden.
Jenes großartige Gesetz, welches die gesammte preußische Monarchie, einschließlich der neuerworbenen Rheinprovinz in ein einziges Zollgebiet verwandelte, die zahlreichen Binnenzölle aufhob, welche bis dahin innerhalb der einzelnen Landestheile bestanden, und damit die Grundlage zum künftigen deutschen Zollverein legte, ist erst 1818 erlassen worden. Seine Segnungen kamen mithin den Armen Köln’s in den Hungerjahren 1816 und 1817 noch nicht zu Gute. Während der Hungerjahre stand der Preis eines Scheffels Weizen am Rhein um sechs Mark fünfundneunzig Pfennig, also beinahe sieben Mark höher als gleichzeitig in Posen[3], so kolossal waren damals die Verkehrshindernisse. In den fünfziger Jahren war der höchste Preisunterschied innerhalb Preußens eine Mark sieben Pfennig. Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß Preußen, der Staat, der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon das Größte gethan für ganz Europa, um sechshundert Geviertmeilen kleiner aus dem siegreichen Kampfe hervorging, als er vordem gewesen, und obendrein in der denkbar ungünstigsten Gestaltung seines Gebietes, zerrissen in zwei weit entlegene Massen. Der Bevölkerungszuwachs von 5½ Millionen, den die Monarchie 1815 gewann, vertheilte sich auf ein Gewirr von Ländertrümmern, vor Kurzem zu mehr als hundert deutschen Kleinstaaten gehörig, zerstreut von der Prosna bis zur Maas. In den altpreußischen Landestheilen allein galten nach dem Frieden siebenundsechszig verschiedene Zolltarife, nahezu 3000 Waarenklassen umfassend. Dazu kamen die besonderen Zollsysteme der neuerworbenen Sächsischen und Schwedischen (Neuvorpommern) Landestheile, die Zollanarchie am Rhein, wo man die verhaßten Douanen und droits réunis der Franzosen einfach gestürzt hatte, ohne einstweilen Neues an ihre Stelle zu setzen. Wer billig denkt, und namentlich Sinn besitzt für jenes Zartgefühl, mit welchem die Preußische Staatskunst von jeher das historisch Gewordene und Gegebene pietätvoll würdigte, wird begreiflich finden, daß nicht vor dem Jahre 1818 die Schöpfung eines einheitlichen Zollgebietes in Preußen verwirklicht werden konnte.
Die neue preußische Rheinprovinz besonders litt außerdem hart unter der schlechten Verkehrsverbindung mit den östlichen Provinzen der Monarchie und vor Allem unter der Concurrenz mit England. Denn mit Aufhebung der von Napoleon drakonisch gegen England durchgeführten Continentalsperre wurden die seit Jahren aufgespeicherten englischen Waaren massenhaft auf den Continent geworfen. In dem einzigen Jahre 1818 hat England für 129 Millionen Gulden Waaren nach Deutschland ausgeführt. England bedurfte damals kolossaler Baarmittel, weil es in den Jahren 1816–19 die Englische Bank zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen durch Parlamentsbeschlüsse nöthigte und das Gold demgemäß wieder zum allgemeinen Tauschmittel machte. Dieser Bedarf wurde durch vermehrte Waarenausfuhr gedeckt. Der einzige Vortheil der deutschen Industrie gegenüber der englischen, der billige Arbeitslohn, ging während der späteren Hungerjahre 1816 und 17 vollständig verloren. Am schwersten litt das Rheinland unter allen preußischen Provinzen; denn kaum waren hier unter dem napoleonischen Mercantilsystem Fabriken aufgeblüht, so verloren sie nun mit der veränderten Gebietsabgrenzung des Friedens plötzlich ihre Absatzquellen nach Frankreich, Holland, Italien, den Niederlanden; sie waren durch die Provinzialzölle der altpreußischen Landestheile vom Osten Deutschlands abgeschlossen und schutzlos der übermächtigen Concurrenz Englands preisgegeben. Die schwere Krisis, die wir jetzt durchleben, erscheint als eine Kleinigkeit gegenüber diesem wirthschaftlichen Elend.
Unter allen Städten des Rheins war nun aber wieder Köln vielleicht am härtesten durch die Franzosenzeit und die veränderte Staatsangehörigkeit heimgesucht worden. Schon mit dem Eindringen der als Retter aus aller Noth begrüßten Jacobiner war das städtische Eigenthum Nationalgut geworden, der beste und wohlhabendste Theil der Bürger geflohen, die Aufhebung der Klöster und mancher milden Stiftung beschlossen. Nach Beendigung der Fremdherrschaft konnten nur noch wenige alte Convente und klösterliche Institute Zeugniß ablegen von der Art, wie im alten Köln die Noth gelindert, die Krankenpflege betrieben worden war. Auch wurde Köln unter der neuen Regierung wichtiger Institute und Behörden beraubt, die ihm wohl gebührt hätten. Die Universität ward nach Bonn, das Oberpräsidium nach Coblenz, die Malerakademie nach Düsseldorf, das Polytechnikum nach Aachen verlegt. Erst später verstand die betriebsame Stadt, sich trotz der Ungunst der Verhältnisse zum Mittelpunkt des rheinischen Großhandels zu machen.
Damit dürfte zur Genüge erklärt sein, wie das Elend der Hungerjahre sich zwei Jahre lang in der großen Stadt behaupten, wie Robert Blum auf seinem ferneren Lebenswege so gut wie gar keine unterstützende Aufmerksamkeit von Seiten der Vaterstadt finden konnte.
Wir sahen, daß der junge Robert schon mit dem siebenten Jahr lesen, schreiben und rechnen konnte. Er hatte sich bis zum zehnten Jahr in diesen und allen sonstigen Künsten, die in seiner Pfarrschule gelehrt wurden, so weit vervollkommnet, daß er anfing, manchem Lehrer als unbequemer „Ueberflieger“ zu gelten, das heißt als ein Bursche, dem Alles zu leicht wird, dem nichts mehr gelehrt werden kann.
In diesem Stadium seiner Bildung bethätigte seine Tante Agnes Blum (wie wir sahen, die einzige Tochter seines Großvaters Robert) die volle Staatskunst der Frauen, indem sie nach dem alten machiavellistischen Grundsatz den gefährlich-oppositionellen Denker in das Ministerium ihres Lehramtes berief und ihm zunächst das Portefeuille der Mathematik verlieh – mit zehn Jahren!
Das ging so zu. Die gute Tante Agnes hatte sich niemals träumen lassen, Lehrerin zu werden. Sie war vielmehr Jahre lang blos Pflegerin einer alten Dame gewesen, welche in dem Gebäude der Elementarschule der St. Maria-Himmelfahrts- oder Jesuiten-Pfarre wohnte. Als diese Dame das Zeitliche gesegnet hatte, wurde Agnes die Universalerbin der Verstorbenen und als solche sehr wohlhabend. Sie übernahm nun gleiche Samariterdienste bei der Lehrerin der genannten Schule, wohnte ihrem Unterrichte vielfach bei, vertrat sie in der Schule, als die Lehrerin kränker und kränker wurde, und erhielt – wahrscheinlich zu ihrem eigenen nicht geringen Schrecken – die Lehrerinstelle der hochehrwürdigen Jesuiten-Pfarr-Elementarschule angetragen, als die Lehrerin die Augen für immer geschlossen hatte. Freilich tobte damals noch nicht der Culturkampf. Auch der Schulzwang und die Schulordnung hatten die Pforten der Hölle noch nicht überschritten. Jeder konnte nach seiner Façon Lesen, Schreiben und Rechnen lehren. Jeder, der zahlen konnte, schickte seine Kinder wohin ihm beliebte. Wer nicht zahlen konnte, schickte sie – in die Stecknadelfabrik zum Verdienen. So war’s unter dem menschenfreundlichen Krummstab gewesen. So war’s auch noch Anno 1817. Das Geld, welches für die Schulstunden zu entrichten war, gehörte der „Lehrperson“. Dieser letztere Gesichtspunkt scheint für Tante Agnes entscheidend gewesen zu sein, als sie sich entschloß, ohne jegliche ausreichende Vorbildung zum Amte einer Elementarlehrerin, dem an sie ergangenen Rufe Folge zu leisten. Immerhin blieb ja doch der große Trost, daß in der Hauptsache, in der Religion, die armen Kinder von der Pfarrgeistlichkeit direct unterrichtet wurden. Nur in einem Punkte konnte sich ihr zartes Gewissen mit dem übernommenen Amte nicht abfinden: im Einmaleins, in den vier Species, vollends im Bruchrechnen, der Regeldetrie &c. Diesen Geheimnissen gegenüber war sie völlig rathlos. Um so besser, daß der kleine Neffe Robert so ausgezeichnet darin bewandert war. Er wurde also als Rechenlehrer bei Tante Agnes angestellt.
Die Einkünfte, die er für diese Thätigkeit genoß, waren verhältnißmäßig bedeutend. Denn Tante Blum überzeugte ihre Schülerinnen natürlich mit Leichtigkeit, daß die wunderbare Kunst des Rechnens nicht für den gewöhnlichen Unterrichtspreis mit verabreicht werden könne, daß vielmehr zur Aneignung dieser ungewöhnlichen Kenntnisse Privatstunden nothwendig seien. Selbstverständlich konnten auch nur die reiferen Schülerinnen an dieser Sahne des Unterrichts der Pfarrschule naschen. Der Preis von einem Stüber (vier bis fünf Pfennig) für zwei Rechenstunden in der Woche erschien als eine Kleinigkeit gegenüber der Errungenschaft dieses Wissens, welches – die Lehrerin selbst nicht besaß. Für Robert aber, der an vier Tagen der Woche Nachmittags von vier bis fünf Uhr zwei Classen der Tante unterrichtete, waren diese Kupfermünzen gerade ausreichend, um seiner guten Mutter die Ausgabe für einen Communionanzug zu ersparen. Denn Tante Agnes sammelte ihm die Einnahmen seines Rechenunterrichtes auf das Genaueste. Sie gab ihm aber außerdem durch eine bei ihrer Genauigkeit wahrhaft splendide Naturalleistung schamhaft zu verstehen, aus welcher Verlegenheit er sie durch seinen Rechenunterricht erlöste: sie verabreichte ihm nämlich, wenn er um vier Uhr aus seiner Schule zum Unterricht in die ihrige kam, eine ganze Tasse Kaffee und ein Brödchen. Die Tasse Kaffee mußte er nun schon als unübertragbare persönliche Rechtswohlthat für sich selbst hinnehmen. Aber das Brödchen allein zu genießen, ging über seine brüderlichen Begriffe. Sein Schwesterchen besuchte ja dieselbe Schule als Schülerin, in der er lehrte. So oft es ging, suchte er ihr das kleine Gebäck zuzustecken. War sie im Garten, auf dem Spielplatz, im Schulzimmer, so scheute er keinen Vorwurf, um seinem Liebling den hohen Genuß frischen Weißbrods zuzuwenden.
Der schmutzige Geiz dieser Tante und die Kränkungen, die sie Robert und seinem Schwesterchen durch Zurücksetzung der Kinder hinter die reichere Verwandtschaft zufügte, haben in Robert’s Herz früh die schmerzlichsten Eindrücke hinterlassen. Höchst charakteristisch für ihn ist ein in diese Zeit fallender kleiner Vorfall, der in der Familie noch heute als die „Geschichte von den Hobelspänen“ streng wahrheitsgetreu erzählt wird. Schwester Gretchen hatte mit etwa sechs Jahren – man staune nicht über die fanatische Menschenquälerei, welche die fromme Geistlichkeit zu Wege brachte! – aus Christoph Schmidt’s biblischer Geschichte ein unendlich langes, in kleinen lateinischen Lettern gedrucktes Stück „Jesu letzte leidensvolle Nacht“ auswendig lernen müssen, und was noch wunderbarer ist – das „Stück“ auch fehlerlos ihrem armen Gedächtniß eingeprägt und am Sonntag in der Kirche heruntergesagt. Diese Quälerei zur größeren Ehre Gottes war speciell in dem jungfräulichen Haupte der Schultante Agnes Blum ausgeheckt worden und sie war keineswegs gewillt, blos in der Kirche mit ihrer Wundernichte Staat zu machen. Sie gab unmittelbar danach auch eine Kaffeevisite, zu welcher selbstverständlich der Herr Pfarrer, ihr Bruder Heinrich Blum, der kräftige Böttcher mit Frau, und einem Gretchen Blum beinahe gleichalterigen Töchterchen u. A. eingeladen waren. Als das Gespräch zufällig auf die Wundernichte gelenkt war, wurde diese aus ihrer Schule heruntergeholt und mußte Jesu leidensvollste Nacht noch einmal ohne Murren zum Kaffee hersagen – den Andere tranken. Den Blick hoffnungsvoll auf den Teller mit „Hobelspänen“ – einem geringelten Butterteiggebäck – gerichtet, sagte das Kind „sein Sprüchel und forcht sich nit“ und so ging denn auch diese „leidensvollste Nacht“ rasch und anstandslos vorüber. „Ach wie schön!“ „Das ist viel für ein so kleines Kind!“ „Brav Gretchen, das hast Du gut gemacht!“ rief es in der Runde. Das Auge des geplagten Kindes haftete gespannter als je auf den Hobelspänen. Da greift denn auch einer der Herren nach dem Teller mit dem Gebäck – und schüttet fast dessen ganzen Inhalt der Cousine des kleinen Gretchen zu. Die brave Tante Agnes aber sagt zu dem Staatskind: „Gretchen, Du kannst nun wieder in die Schule gehen.“ Sie mußte die Aufforderung mehrmals, dringlicher wiederholen.
Darüber waren mehrere Jahre vergangen. Die Mutter nähte nach wie vor für die Leute und sandte eines Tages ihre kleine Tochter ein fertiges Kleid auszutragen und sechzehn Stüber Arbeitslohn dafür zu verlangen. (Dreizehn Stüber machten fünfzig Pfennig). Das Kind verlangte und erhielt siebzehn Stüber, und lief spornstreichs zum Hofconditor Maus – ich vermuthe beinahe, daß er zeitlebens wenig für den Hof conditort hat – und verlangte hier in der höchsten Aufregung für einen Stüber Hobelspäne. Der „Herr“ am Ladentisch fragte ängstlich, ob das Kind die Hobelspäne essen wolle – sie sah offenbar so aus, als ob sie damit zu jedem anderen Verbrechen fähig gewesen wäre – und als das Kind diese Absicht entschieden bejahte und als glaubhaften Beweggrund hinzufügte, daß sie ein andermal habe zusehen müssen, ohne welche zu kriegen, machte er ihr für den einen Stüber eine ganze Düte voll.
Aber das Verhängniß schreitet schnell. Die Empfängerin des Kleides beschwert sich bei Robert’s Mutter, daß sie soviel habe bezahlen müssen, und die Mutter stellt die Tochter zur Rede. Sprachlos vor Angst blickt Gretchen die Mutter an und vermag kein Wort herauszubringen. Robert ist zugegen und sagt: „Aber liebe Mutter, wie soll Gretchen nach so langer Zeit noch wissen, was Du ihr damals bestellt und was sie erhalten hat?“ Die Mutter stand von weiterem Forschen ab. Sowie aber Robert ausgehen mußte, sagte er: „Ich möchte Gretchen gerne mitnehmen.“ Er schlug einen ungewöhnlichen Weg mit ihr ein. In einer stillen Straße bleibt er stehen, sieht sie eindringlich an und fragt: „Gretchen, warum hast Du der Frau einen Stüber mehr abverlangt, als die Mutter gesagt?“ Sie erzählte ihm nun die ganze Geschichte. Da ballte er die Hände und knirschte mit den Zähnen. Die Schwester bat ihn, es der Mutter zu sagen, damit sie ihre Strafe bekomme. „Sei ruhig,“ erwiderte er stirnrunzelnd, „ich werde es der Mutter nicht sagen. Aber warum hast Du mir damals nichts gesagt, als man Dich zusehen ließ?“ „Dann hättest Du geweint,“ sagte Gretchen schluchzend. „Jetzt bin ich groß und weine nicht mehr,“ entgegnete Robert. „Du aber sollst mir versprechen und es nie vergessen, daß Du Dich stets an mich wenden willst, wenn Dir etwas fehlt, wenn Du Dir etwas wünschest, wenn Dir bange ist.“ Er hat redlich Wort gehalten.
Jener Fall mit den Hobelspänen war natürlich nicht der einzige, bei welchem die Tante die armen Kinder zurücksetzte. Als Robert eines Tages trübselig zu Hause saß, äußerte er seiner Mutter den Wunsch, ein wenig zur Tante zu gehen. Er ging, kam aber bald zurück mit der Nachricht, daß er nicht vorgelassen worden sei, weil die Tante Besuch habe. Neugierig, den Besuch zu sehen, hatte er durch das Glasfenster der Besuchsstube geschaut und den Onkel Heinrich nebst Frau bei der Tante sitzen sehen. Tief gekränkt, faßte er seinen Schmerz in die für einen so jungen Knaben höchst überraschende Wendung zusammen: „Die Schwester meines Vaters konnte mich nicht empfangen, weil sie den Bruder meines Vaters zum Besuch da hatte.“
So war das elfte Jahr seines Lebens herangekommen, in welchem Robert zum ersten Male das heilige Abendmahl empfing. Wohl der Einzige unter den gleichalterigen Genossen, hatte Robert die Festkleidung, die er am Altar des Herrn trug, sich selbst redlich verdient. Aber auch der kindlich tiefe Glaube an das Wunder des Gnadenmahls des Heilandes mochte vielleicht keinem seiner Gefährten so rein und kräftig innewohnen, wie ihm. Diesen schon seit seinem vierten Jahr durch täglichen Messebesuch und Messedienst bethätigten Glauben bezeugte Robert nun auf’s Neue, indem er seine Eltern nach der Communion bat, ihm zu gestatten, daß er in der St. Martinskirche (seiner Pfarrkirche) in die Reihe der Meßdiener eintreten dürfe. Da mit diesem Amte kleine Einnahmen verbunden waren, die Robert seiner Mutter zuzuwenden hoffte, und außerdem das Recht, die Pfarrschule der Kirche zu besuchen, so gaben die Eltern mit Freuden ihre Zustimmung.
Robert wurde also Meßdiener. Da dieser Dienst die Knaben nur in frühen Morgenstunden und an Sonn- und Feiertagen beschäftigte, so hinderte er nicht am Schulbesuch. Aber aus diesem Dienst, der Alles in sich zu vereinigen schien, was Robert glücklich machte, erwuchsen dem Knaben zum ersten Male in seinem jungen Leben seelische Leiden, die ihn mit tiefem Schmerz erfüllten und in ihrem Verlaufe den festen, treuen Kinderglauben Robert’s zerstörend ergriffen und vernichteten. Den ersten Anlaß hierzu bot folgender Vorgang. Die jungen Meßdiener verweilten in der Kirche schon ehe sie den Gläubigen geöffnet wurde und noch nachdem sie von den Kirchenbesuchern verlassen war. Die Jungen – mindestens aber Robert – beobachteten genau das Benehmen der Geistlichkeit in diesen Momenten, wenn diese unter sich zu sein glaubte. Klagend und weinend berichtete Robert der Mutter: „Er habe die traurige Bemerkung gemacht, daß die stets mit dem Heiligen beschäftigten Leute nicht frömmer als die Anderen seien, ja noch viel weniger fromm. Es falle Keinem derselben ein, vor dem Hochaltar das Knie zu beugen, wenn die Kirche von Menschen leer sei. Sie gingen vielmehr lachend und schwatzend vorbei. Er wolle aber versuchen, durch sein besseres Beispiel auf die Andern zu wirken.“ Bald klagte er der Mutter von Neuem: „Nein, nein, sie Alle sind nicht fromm. Sie haben keine Achtung und Ehrfurcht vor dem im Altar verborgenen Heiland. Es ist nur Scheinheiligkeit, wenn sie in der von Menschen gefüllten Kirche Ehrenbezeugungen an den Tag legen.“ Armes, reines Kinderherz! Du wußtest nicht, daß Jahrhunderte vor dir ein anderes Kind, aus so armem Hause wie du, am zehnten November geboren wie du, denselben Weg zur Erkenntniß gewandelt war, dessen rauhe Bahn du nun betratest. Auch Martin Luther war nicht zuerst irre geworden an der Lehre der römischen Kirche, sondern an ihren geistlichen Dienern. Und als er diese voller Lug und Trug fand, erstreckte sich sein Zweifel auch auf den von solchen Priestern verkündeten Glauben. Denselben Weg der Erkenntniß wandelte Robert Blum.
Jeder wahrhaftigen treuen Natur ist die erste Berührung mit Lüge und Heuchelei eine überaus peinliche Erfahrung. Hier wurde sie um so peinvoller, als die bisher untrügliche letzte Instanz in allen wichtigen Fragen, die Mutter, in ihrem blinden Glauben an die Heiligkeit und Frömmigkeit der Diener der Kirche, die Zweifel Robert’s nicht lösen konnte oder wollte. Er wurde daher nun auch der Mutter gegenüber einsilbig und verschlossen. Seine letzten Gedanken behielt er für sich. Finster und argwöhnisch ging er seinen kirchlichen Functionen nach. Immer weiter griff sein grübelnder Zweifel um sich. Das Nächste, was ihn aufregte, war zum Glück noch eine rein weltliche Betrachtung. Bei Trauungen, Kindtaufen, Begräbnissen &c. legten die Betheiligten Trinkgelder in eine für die Meßdiener bestimmte Büchse. Robert glaubte bemerkt zu haben, daß der Inhalt der Büchse, wenn er zur Vertheilung kam, mit den Einlagen nicht stimme, und seit der letzten Theilung begann er förmlich Buch zu führen über jeden Stüber, der eingelegt wurde. Bei der nächsten Vertheilung des Büchseninhaltes fand sich nicht einmal die Hälfte der von Robert berechneten Einlagen vor. Er nahm seinen geschmälerten Theil, brachte ihn weinend der Mutter, legte ihr sein Verzeichniß vor und berechnete ihr danach, wie viel jeder der jungen Meßdiener eigentlich hätte erhalten müssen.
Die Mutter nahm Geld und Verzeichniß ging zum Hülfsküster, der die Büchse in Verwahrung hatte, und beschwerte sich über solchen „Betrug“. Dieser hörte die Klage staunend an; dann lachte er laut auf und rief einmal über das andere: „Also jetzt rechnen die Jungens nach, was in die Büchse kommt!“ Die gute Mutter mochte in diesem Gebahren des Küsters auf die schwere Anklage nur die Bestätigung Alles dessen finden, was Robert ihr bisher aus seinem vollen Herzen geklagt hatte, und war deshalb wenig geneigt, die Sache von der heiteren Seite aufzufassen. Sie nannte daher dem Küster die Namen aller Personen, die Geld in die Büchse eingelegt hatten, und gab genau die Summe an, die ein Jeder gegeben. Da legte sich der Küster auf’s Beruhigen. Er versprach, die Büchse solle in Zukunft besser aufgehoben, Veruntreuung dadurch unmöglich gemacht werden. Und er hielt Wort.
Für Robert war jedoch dieser Sieg, den sein Scharfsinn für sich selbst und die Kameraden erfochten hatte, mit nichten erfreulich. Bot er ihm doch die traurige Bestätigung, daß er mit seinem Argwohn auf richtiger Fährte gewesen. Da die Mutter nur einen Theil seiner Zweifel zu lösen vermochte und sein Glaube ihm gebot, alles Herzeleid und alle seelische Bedrängniß in der Beichte dem verschwiegenen Priester anzuvertrauen, so flüchtete er mit seinem stillen Weh in den Beichtstuhl. Alles, was er der Mutter geklagt, und mehr noch, so namentlich auch den Zweifel an dem Glauben, daß der mächtige Herrgott in Person sich tagtäglich leiblich von den Gläubigen werde verzehren lassen wollen, schüttete er vor dem lauschenden Ohre des Beichtigers aus. Rauhe Worte und Drohungen mit ewiger Verdammniß waren die Antwort. Er ging nun von einem Beichtvater zum andern. Manche gaben ihm freundlichen Zuspruch, liebevolle Ermahnungen. Aber harte Zurechtweisung war vorherrschend. Der letzte Beichtvater namentlich, an den er sich gewandt, nannte ihn einen verstockten Sünder und verweigerte ihm die Absolution.
Kurze Zeit darauf wurde er zum Pfarrer beschieden. Er ging natürlich hin und fand eine ganze Anzahl Geistlicher beisammen, unter ihnen auch Denjenigen, bei dem er, von Zweifeln gefoltert, Trost, Beruhigung, Glauben suchend, gebeichtet hatte. Vor Allen nimmt dieser Beichtvater das Wort und schildert Robert als einen frechen, anmaßenden Buben, der sich unterstehe, den Lauscher und Aufpasser abzugeben, sich erdreiste zu beurtheilen, ob das Betragen eines geweihten Priesters passend oder unpassend sei, der Rebellion unter den Meßdienern gestiftet und sie gelehrt, ihren Vorgesetzten zu mißtrauen, ihnen aufzupassen, sie wohl gar zur Rechenschaft zu ziehen. Der Knabe, aufgefordert sich zu rechtfertigen, stottert, verwirrt durch den ungeheuren Vertrauensbruch, die Worte heraus: daß er im Beichtstuhl sein Herz offenbart und nun unverbrüchliche Geheimnisse verrathen sehe. „Ach, wir wissen doch Alles“, wird ihm höhnisch entgegengerufen, mit zeitlicher und ewiger Strafe, mit Hölle und Verdammniß ihm gedroht und, um sein Elend vollzumachen, die Mutter gerufen, um auch sie von der Ruchlosigkeit ihres Sohnes in Kenntniß zu setzen. So endete Robert’s Rolle als Meßdiener.
Seine gute Mutter trug vor Allem Fürsorge für das Seelenheil ihres Kindes, dessen Herz sie so ganz anders geartet kannte, wie das grausame Ketzergericht, das nun gesprochen hatte. Sie brachte ihren Robert zu dem alten, würdigen, gutmüthigen Geistlichen, der sie und Robert schon so lange kannte, klagte diesem, wie Alles gekommen, und bat ihn, sich ihres armen Kindes anzunehmen und ihn auf den Weg des Glaubens zurückzuführen. Robert folgte lammfromm den Worten des Einzigen, dem er vertraute, erhielt die früher verweigerte Absolution, ging nach wie vor zur Beichte und Communion – aber trotzdem war für ihm immer dahin die selige Glaubenswelt seiner Kindertage. Als er mehr als ein Vierteljahrhundert später sich öffentlich lossagte von der römischen Kirche und das praktischste und energischste Haupt der neuen Deutsch-katholischen Kirche wurde, hat, wie später an seinen eigenen Bekenntnissen gezeigt werden wird, gewiß der Gedanke, politische Ziele durch die religiöse Bewegung zu fördern, vollen Antheil an seinen Entschließungen gehabt. Dennoch aber war dieser Schritt nur die letzte Consequenz jener Seelenkämpfe, die in ihm erregt wurden in Jahren, wo wir kaum über uns und Andere zu denken beginnen.
Den Besuch der Pfarrschule wegen dieser Ketzereien Robert zu verbieten, wagte man doch nicht. Er lernte hier mit gleichem Eifer fort. Da ließ eines Tages Robert’s Lehrer, der verwachsene, fleißige und hochgeachtete Herr Burg, die Mutter zu sich bitten und sagte ihr: „er sei jetzt fünfunddreißig Jahre lang Lehrer an einer und derselben Schule – aber ein Talent und solchen Fleiß, wie er bei Robert gefunden, sei ihm in dieser langen Zeit noch nicht vorgekommen. Er rathe der Mutter, Alles aufzubieten, um ihn studiren zu lassen.“ Die Mutter wendete ein, sie sei nur eine arme Frau, der Knabe habe einen Stiefvater, es werde ihr unmöglich sein, Robert studiren zu lassen. Da meinte Herr Burg: „gerade für strebsame und arme Kinder und Waisen habe ja die Stadt ihre reichen Stiftungen. Er rathe, ihren Sohn nach dem Gymnasium zu bringen und dann sich um Erlangung einer ‚Stiftung‘ zu bemühen.“
Robert war selig, als er von diesem Plane hörte, und ließ es natürlich an Bitten nicht fehlen, um das hohe Ziel zu erreichen. So brachte ihn denn die Mutter nach dem Kölner Jesuitengymnasium. Seine Freude, sein Fleiß waren grenzenlos. Immer hatte er zu wenig Arbeit. Als er die Sexta durchlaufen hatte und am Schlusse des Schuljahrs öffentliche Prüfung stattfand, wurde ihm, dem Fleißigsten und Aermsten, der erste Preis, das „goldene Buch“, zuerkannt. Vor mir liegt unter all den ähnlichen Zeugnissen, welche Robert aus seiner Schulzeit davongetragen, auch das Zeugniß über dieses letzte Vierteljahr seines Schulbesuchs. Es lautet: „Vierteljährige Censur. Vorbereit. Classe des Jes. – Gym. Nro. Ein. Schuljahr 1819–20, viertes Vierteljahr. Namen Robert Blum. Betragen gegen Mitschüler gut, gegen Vorgesetzte lobenswerth. Fleiß lobenswerth in allen Fächern; der häusliche Fleiß sehr groß, und mit dem besten Erfolge. Fortschritte vorzüglich in allen Fächern. Abwesend und zu spät gekommen vacat. Also ausgestellt von den Lehrern Weiß, Breuer, Religionslehrer. Unterzeichnet von dem Director Heuser. Köln, 27. August 1820.“ An den Fuß dieses Zeugnisses hat die ungelenke Hand des Stiefvaters geschrieben: „Mit Freuden gesehen von Caspar Georg Schilder.“
Mit noch erhöhter Freude ging Robert natürlich zu Anfang des folgenden Jahres nach Quinta. Die Mutter hatte sich nun ein volles Jahr übermäßig angestrengt, um Schulgeld, Bücher, Kleidungsstücke &c. zu beschaffen. Aber trotz aller unablässigen Bemühungen wollte es ihr nie gelingen, eine Stiftung für ihren Sohn zu erlangen. Immer hieß es: es seien keine Gelder vorhanden. Jetzt wurde ihr eröffnet, es könne noch anderthalb Jahr währen, ehe er in den Genuß einer solchen Freistelle treten könne. Das war ein furchtbarer Schlag. Es fehlte an Allem, an Büchern, Geld, vor Allem an dem so nöthigen Anzuge. Aber es gab ja noch eine Hoffnungsaussicht, welche die Mutter um ihretwillen nie angerufen hatte, aber um des reichbegabten Sohnes willen nicht unversucht lassen wollte: die wohlhabende Verwandtschaft. Trostsuchend wandte sich die Mutter zuerst an den früheren Lehrer Robert’s, Herrn Burg, und auch von diesem wurde sie vertrauensvoll gewiesen an Alles, was sich Robert gegenüber mit dem Namen „Onkel“ schmückte. Verheißungsvoll wiesen sämmtliche Onkels ihrerseits auf die reiche Tante Agnes, zumal da Robert sie ja in ihrer bekannten mathematischen schweren Noth über Wasser gehalten hatte. Diese treffliche Dame aber sagte: „Ich habe keine Kinder. Wer Kinder hat, mag dafür sorgen!“ Damit war die Entscheidung gesprochen. Robert mußte der Hoffnung, weiter zu lernen, entsagen und zu Hause bleiben.
Schweigsam und traurig, alle bisherigen Genossen seiner Studien sorgsam meidend, schlich der sonst so muntere, frohe Knabe einher. Ernstlich fürchteten seine Eltern und Alle, die ihn damals sahen, er möchte in Gemüthskrankheit verfallen. Dann aber, als er, finster vor sich hinbrütend, Tag und Nacht sein Mütterlein an der Arbeit sah, um ihm und seinem Schwesterchen Brod zu schaffen, ohne ein Wort des Vorwurfs für seine Unthätigkeit, da warf er den letzten schmerzlichen Blick rückwärts nach den für immer verlorenen Gefilden der ewigen Jugend des Alterthums und beugte seinen kräftigen Nacken unter das Joch gewöhnlicher Handarbeit. Als er etwa fünfzehn Jahre später um Aufnahme in den Freimaurerbund nachsuchte, faßte er selbst den Schmerz seiner Seele, der ihn damals bewegte, und die heroische Entscheidung, die er am Ausgange seiner Knabenjahre traf, in die schönen Worte zusammen: „So mächtig mich auch damals die Sehnsucht festhielt am Wissen, ich war gezwungen, ein Handwerk zu erlernen, und trat nach vollendetem siebenzehnten Jahre eine traurige Selbstständigkeit an, indem die Kindespflicht mich hinaustrieb in das Leben, um meinen Eltern die Sorgen für meinen Unterhalt abzunehmen.“
Fussnote_3_3
Treitschke, die Anfänge des Zollvereins, Preuß. Jahrb. 30. Band. S. 897 fg.