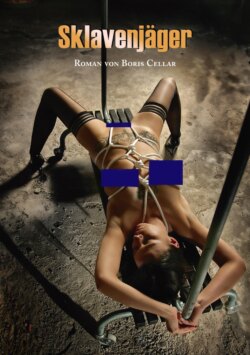Читать книгу Sklavenjäger - Boris Cellar - Страница 6
Оглавление2
Oh Gott! Mein Kopf dröhnte. Wütende Schmerzen loderten direkt hinter der Stirn. Kopfschmerzen! Ich hasse sie! Spitze Nadeln bohrten sich durch die Schädeldecke. Die Haut am Hals spannte, als ob sie von einem Wahnsinnigen in die Länge gezogen wurde. Pochende Wellen pulsierten durch den gesamten Körper.
Ich fühlte mich wie gegessen und wieder ausgespuckt. Was war los mit mir? Was war bloß geschehen? Gedanken rasten wild umher. Hier stimmte etwas nicht! Panik, Ungewißheit, Dunkelheit. Carola, komm zur Ruhe! forderte ich mich auf. Du mußt dich jetzt beruhigen!
Ich lag auf etwas Hartem. Das war das erste, was ich bewußt feststellte. Mein Körper war in einer unbequemen Position darauf zusammengekauert. Alle Muskeln schmerzten, als ob sie durch extreme Kraftanstrengung überanstrengt wären. Unter mir ertastete ich glatten Stein, auf dem ich wohl schon seit einiger Zeit gelegen hatte.
Nun, nicht direkt glatter Stein. Die Oberfläche war nicht gänzlich blankpoliert, wie zuerst vermutet, sondern mit unzähligen feinen Poren übersät. Ähnlich einem Reibeisen. Ich mußte sogar aufpassen, daß ich mir beim Darüberstreifen nicht die Haut aufriß. Wo war ich? Wie in aller Welt kam ich hierher?
Dunkelheit! Um mich herum war alles tiefschwarz. Finster wie die Nacht. Meine Lider waren offen. Dennoch konnte ich nichts sehen. Überhaupt nichts! Nicht einmal die geringsten Konturen waren erkennbar. Blind! Keine Lichtquelle vorhanden. Meine Augen versuchten, sich an das Fehlen von Licht zu gewöhnen; versuchten, irgend etwas – auch wenn es nur die geringste Kleinigkeit war – zu erkennen. Nichts! Keine Chance! Dunkelheit!
Völlig desorientiert versuchte ich mir klarzuwerden, wo ich mich befand. Ich hatte überhaupt keinen Hinweis. Es gab nichts, was mir helfen konnte. Die poröse Bank und ich. Im Gedanken versuchte ich, mich auf die letzten Momente vor der Bewußtlosigkeit zu konzentrieren. Wie durch Watte kämpfte sich das Gedächtnis zu den Erinnerungen durch, die in den hintersten Windungen meines Gehirns zu schlummern schienen.
Schließlich wurden sie fündig, und ich erinnerte mich an das, was geschehen war, bevor ich in der Dunkelheit wieder zu mir kam. Ich stand wie gebannt vor einer Eisernen Jungfrau in einem Folterkeller mitten im Nirgendwo Belgiens. Dann kamen der schmerzhafte Blitz und der Verlust jeglicher Kontrolle über Geist und Körper. Was danach passierte, lag ebenso im Dunkeln wie die Umgebung, in der ich mich wiederfand. Und wieder drängte sich die Frage auf, wo ich war und warum man mich hierhergebracht hatte.
Vorsichtig hob ich den rechten Arm von der harten Unterlage. Dabei ignorierte ich die protestierenden Muskeln in Arm und Schulter. Ich mußte etwas tun, mußte mich bewegen. Es war nicht richtig, auf der harten Unterlage zu verharren und zu warten, daß etwas passierte. Ich war nicht zur Lethargie verdammt – brauchte mich nicht einfach dem Schicksal in der Dunkelheit zu ergeben.
Vielleicht konnte ich ja ertasten, wo ich mich befand, wenn ich schon der Funktion meiner Augen beraubt war. Verlaß dich auf deine Gefühle, Carola! redete ich mir ein, während ich mich in die Höhe stemmte.
Ich meinte zu spüren, daß etwas um die Handgelenke gelegt war, ebenso um die Knöchel und den Hals. Ein leichter, aber konstanter Impuls drückte dort auf die Haut. Bei den Bewegungen hörte ich Metall rasseln und stutzte. Auf meinem Bauch lag etwas, das sich wie Glieder einer Kette anfühlte. War ich etwa angekettet?
Mit beiden Händen griff ich an die gegenüberliegenden Handgelenke und fühlte darum jeweils einen kalten Eisenring. Die beiden Ringe waren durch eine stabile Kette verknüpft. Ungläubig befühlte ich das geflochtene Metall, das meine Hände miteinander verband. Zwischen Haut und Eisen ertastete ich eine Art schützendes, gummiertes Lederband. Ich war gefesselt. Verdammte Scheiße!
Die Erkenntnis traf mich wie ein Schwall kaltes Wasser. Klammerte ich mich vorher noch an die abstruse Hoffnung, daß ich mich einfach nur in Dunkelheit befand, hatte ich jetzt die Gewißheit, daß etwas Böses mit mir geschehen war. Hektisch versuchte ich, die Bänder abzustreifen. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte mich nicht befreien. Gefangen! Ich war, verdammt noch mal, gefangen!
Immer wilder riß ich an den unnachgiebigen Fesseln, immer unkontrollierter wurden meine Bewegungen. Nur ein Wunder und die Beschaffenheit der Fesseln verhinderten, daß ich mich bei den Befreiungsversuchen ernsthaft verletzte. Irgendwann war ich zu erschöpft, um weiter gegen die Ketten anzukämpfen, und gab geschlagen auf. Frustriert ließ ich mich zurücksinken und starrte in die Dunkelheit.
Tief durchatmen! Ich war einfach zu aufgewühlt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Konzentriert versuchte ich, zurück zu meinem inneren Mittelpunkt zu kommen, mein Gleichgewicht zu erlangen. Ich war hin- und hergerissen zwischen kühler Analyse und wilder Panik. Es war so surreal! Gerade befand ich mich noch auf spannender Entdeckungstour in einem privaten Foltermuseum, dann wurde ich niedergestreckt und erwachte, mit schweren Ketten gefesselt, an einem unbekannten, dunklen Ort. Wenn mich irgendwer hierhergebracht hatte, mußte dieser Irgendwer doch sicher noch in der Nähe sein. Man würde mir bestimmt erklären, warum ich hier war und was man mit mir vorhatte.
»Hallo!« machte ich mich vorsichtig bemerkbar und schickte noch ein »Kann mich jemand hören?« in das schwarze Nichts hinein.
Meine Stimme erzeugte ein schwaches Echo. Die Beschaffenheit des Widerhalls ließ darauf schließen, daß ich mich in einem größeren Raum befand. In einer Halle vielleicht? Seltsam.
Aber ich agierte. War nicht länger passiv. Das war gut. Die lähmende Panik der ersten Momente nach dem Aufwachen hatte sich gelegt. Mein Gehirn arbeitete wieder normal – so wie das einer Studentin, einer Wissenschaftlerin, die ich ja werden wollte. Ich versuchte, die Situation zu analysieren, Lösungsstrategien zu entwickeln. Ich kam langsam in die Gänge. Als erstes mußte ich herausfinden, was passiert war und wie ich aus dem Ganzen wieder herauskam.
Auf meine Frage kam keine Antwort. Obwohl ich angestrengt lauschte, war weit und breit kein Ton zu hören. Nicht der geringste! Die Stille in der Dunkelheit war ohrenbetäubend. Ich wartete – vergeblich. Nichts geschah! Kann Stille tatsächlich laut und Dunkelheit gleißend hell sein? Die vermeintlichen Widersprüche kamen mir plötzlich sehr bezeichnend vor. Ich fühlte mich ziemlich unsicher und hilflos. Das war kein schönes Gefühl.
Das Warten war zudem ernüchternd. Die Leere zehrte an der Substanz, fraß mich auf. Aus der Finsternis kam keine Stimme, die mir meine Lage erklären wollte. Es erschien kein Held, der mich befreien wollte. Stumm verharrte die Welt und ließ mich alleine auf dem Steinblock zurück.
Meine Augäpfel wanderten in den Höhlen hin und her – auf der vergeblichen Suche nach vagen Konturen, um wenigstens irgend etwas erkennen zu können. Langsam, bloß keinen Muskel überanstrengend, richtete ich den Oberkörper auf. Alles tat weh! Die Muskeln spannten und waren kurz davor, sich schmerzhaft zu verkrampfen. Mein Magen rebellierte und forderte mit einem tiefen Knurren Nahrungsmittel ein. Angespannt wartete ich. Doch nichts geschah.
»Hallo!« sagte ich nun etwas lauter. Ich drückte mich hoch, streckte den Kopf, um ja nichts zu verpassen. Sobald mir jemand antwortete, sobald sich der kleinste Lichtstrahl auftat, bekäme ich es mit und könnte darauf reagieren. Ich wartete. Bald würde etwas geschehen. Das war sicher! Man konnte mich doch nicht einfach so alleine im Dunkeln liegenlassen. Das ging doch nicht.
Beim Aufrichten und Drehen des Kopfes spürte ich wieder dieses feste Etwas um meinen Hals. Tastende Fingerkuppen bestätigten, daß etwas – ähnlich den Metallbändern um die Handgelenke – darumgelegt war. Jedoch war dieses Etwas wesentlich dicker, breiter und schwerer, hatte jedoch ebenfalls je eine Ausbuchtung an der Vorder- und Rückseite. Auch hier schützte ein Lederband meine Haut davor, aufgescheuert zu werden. Um die Knöchel trug ich ebenfalls zwei gleichartige Bänder mit einer Verbindungskette dazwischen.
Was war noch alles mit mir geschehen, während ich bewußtlos war, fragte ich mich ängstlich und spürte, wie die Gedanken Kapriolen schlugen, sich in blühender Phantasie wilde Dinge ausmalten. Hektisch griff ich an meine Kleidung. Statt des weichen Wanderhemds und der kurzen Hose fühlte ich rauhen Stoff – ähnlich grobgewebtem Leinen. Die Beine waren unbekleidet. Meine Unterwäsche war ausgezogen worden. Ich fühlte mich verletzlich.
Der BH war weg! Uhr und Schmuck fehlten. Sogar die Ringe an Fingern, Zehen und Ohren waren abgezogen. Sicher war der Rucksack ebenfalls verschwunden. Ich war hier ohne Taschenlampe und Handy, nackt und gefesselt, nur mit einem kratzenden, oberschenkellangen Kleid am Leib. Das war zu viel.
Der Puls beschleunigte sich rapide in ein dumpf pochendes Inferno, bis mir schließlich schwindelig wurde. Alles drehte sich. Der Druck im Kopf wuchs. Ein stechender Schmerz breitete sich in der Brust aus. Panik und Hilflosigkeit gewannen in meiner Gefühlswelt die Oberhand. Ich war, verdammt noch mal, gefangen. Kämpfen oder Weglaufen, die natürlichen menschlichen Reaktionen auf eine Gefahr, waren mir verwehrt. Drüsen schütteten Unmengen von Streßhormonen aus. Das vernünftige Denken hörte auf. Instinktives Handeln übernahm die Kontrolle. Doch der Instinkt ist nicht abhängig vom Intellekt und neigt zu spontanem und vor allem unüberlegtem Handeln.
»Hilfe!« schrie ich voller Verzweiflung. Tränen füllten meine Augen. »Hilfe! Hilfe! Hilfe!«
Immer wieder brüllte ich das eine Wort heraus, bis ich heiser wurde. Es war kein Rettungsanker, den ich auswarf, um mich aus der mißlichen Lage zu befreien. Trotzdem versuchte ich es verzweifelt immer und immer wieder. Irgend jemand mußte mich doch hören und mir endlich einmal antworten. Schreien war das einzige, was ich tun konnte. So schrie ich, als ob es um mein Leben ginge. Die letzten Töne verließen als trauriges, leises Krächzen die aufgerauhte Kehle.
Schluchzend vergrub ich den Kopf in den Händen. Verzweiflung vergiftete meine Gedanken und ließ nicht zu, daß ich mich beruhigen konnte. Zitternd saß ich auf dem Steinblock. Bitterlich weinend.
Vorsichtig, um mich mit der schweren Kette nicht zu verletzen, ließ ich die Beine auf den Boden sinken. Unter den nackten Fußsohlen spürte ich Staub und kleine spitze Steinchen, die mir unentwegt in die empfindliche Haut pieksten. Ich war keine Barfußläuferin, hatte dort unten keine Hornhaut, die mich vor den unangenehmen Reizungen schützen konnte.
Ich fühlte mich wie nach einem Schock, bei dem die Empfindungen vom Körper gelöst waren. Alles lief vor mir ab wie in einem Traum. Das Geschehen nahm ich wahr und versuchte vergeblich, das Aufgenommene zu verarbeiten. Es war, als ob ich neben mir stünde. Mein Gehirn weigerte sich einfach, die Gegebenheiten als Realität zu akzeptieren.
Mit dieser Situation konnte ich nicht umgehen. Alles, was ich hier erlebte, alles, was an Emotionen auf mich einprasselte, war unwirklich und fremd. Der analytische Verstand, den ich schon immer als meine große Stärke betrachtet hatte, war einfach ausgeschaltet. Ich konnte nicht erfassen, was das Ganze bedeuten sollte. Es machte mich unsicher und verletzlich. Ich haßte Unsicherheit. Kontrolle war wichtig. Losgelöst im luftleeren Raum zu schweben, das war keine Handlungsoption. Doch was sollte ich tun? Mir war die Kontrolle entzogen worden. Gefangen und alleine saß ich irgendwo im Dunkeln. Niemand beantwortete meine Rufe. Verzweiflung bestimmte meine kleine Welt.
Moment! Ich war ein junges, selbstbewußtes Mädchen im Alter von 22 Jahren. Ich hielt mich bislang für intelligent, scharfsinnig und mutig. In meinem Leben konnte mich bisher nichts erschüttern. Meinen Weg ging ich immer geradlinig ohne fremde Hilfe. Das Abitur hatte ich mit einer ordentlichen Note geschafft, ohne mich groß anzustrengen zu müssen. Das Studium lief hervorragend. Meine Organisationsfähigkeit war herausragend. Ich hatte wunderbare Freunde und eine Zimmergenossin, die stets für mich da war. Obwohl sich meine Eltern scheiden ließen, konnte ich zu beiden ein tolles Verhältnis halten. Die Studienreise nach Belgien hatte ich ganz alleine geplant, mich darauf vorbereitet, sie organisiert und schließlich durchgeführt. Nicht einmal dieses abstruse Thema meiner Arbeit für die Uni hatte mich erschüttern können.
Ich war kein ängstliches und leicht zu verunsicherndes kleines Mädchen. Im Gegenteil! Ich war eine Macherin! Also, Carola, dann beruhige dich wieder! Reiß dich zusammen! Hör auf zu flennen und finde eine Lösung für deine Situation! Das schaffst du, so wie du schon so vieles in deinem Leben gemeistert hast!
Selbstmotivation war etwas Tolles, wenn sie funktionierte. Tatsächlich wirkte es. Ich wischte mir mit dem Handrücken die Tränen aus dem Gesicht und ignorierte dabei das rasselnde Kettenband. Mit klopfendem Herzen beruhigte ich mich langsam.
Für eine gute Analyse waren zuverlässige Daten notwendig. Diese mußte ich mir jetzt zusammensuchen. Dann konnte es mir sicher auch gelingen, eine Lösung für das Dilemma zu finden, in dem ich mich befand. Ich war eine Wissenschaftlerin! Ich hatte gelernt, analytisch zu denken und Probleme zu lösen. Das mußte ich doch für mich nutzen können!
Ich begann die Beurteilung der Lage mit meiner Kleidung. Man hatte mir also einen unbequemen Leinensack angelegt, als ich ohne Bewußtsein war. Die Stoffe an der Körpervorderseite und am Rücken waren mit Klettbändern verbunden. Die Oberbekleidung konnte also trotz Fesselung ohne größere Schwierigkeiten angezogen oder abgelegt werden. Es war ein Hinweis, daß mein Aufenthalt und die Fesselung wohl für einen längeren Zeitraum geplant waren. Nicht gut! Wo waren meine Kleidung, der Schmuck und der Rucksack? Ich konnte sie nicht sehen. In meiner unmittelbaren Umgebung standen sie nicht, sonst hätte ich sie bestimmt schon bemerkt.
Der Raum, in dem ich mich befand, war nicht besonders kühl. Trotz der spärlichen Bekleidung fror ich nicht. Zwar zitterte ich am ganzen Körper; das war aber aus Frust und Wut, nicht vor Kälte. Der Boden selbst war etwas kälter als die Umgebungsluft. Es war aber nicht unangenehm. An den Sohlen pieksten ein paar kleine Steinchen. Immerhin war der Boden trocken und nicht feucht. Es roch weder schimmelig noch modrig. So schlimm war dieser erzwungene Aufenthaltsort doch gar nicht, sprach ich mir Mut zu, den ablenkenden Mut der Verzweifelten. Alles in allem hätte es wesentlich schlimmer kommen können.
Noch schlimmer? fragte die sarkastische Stimme in meinem Kopf. Carola, vielleicht wartet irgendwo da draußen der Tod auf dich. Was soll da noch schlimmer sein?
An Händen und Füßen war ich gefesselt. Um den Hals lag ein Eisenring. Meine Haut wurde von gummiertem Leder vor Verletzungen durch das starre Material geschützt. Ein weiteres Indiz für eine längere Zeit, die ich hier verbringen sollte. Was oder wo auch immer dieses »Hier« auch sein mochte. Man wollte mich also nicht unnötig quälen oder verletzen, was grundsätzlich schon einmal recht beruhigend war. Was für ein schwachsinniger Gedanke, so etwas als beruhigend zu empfinden!
Es fiel mir unglaublich schwer, die Situation objektiv einzuschätzen. Ich hatte eine Riesendummheit begannen, den Folterkeller auf eigene Faust aufzusuchen. Jetzt war ich ein Kettensträfling oder so etwas in der Art. Im Internet gab es ja die schlimmsten Geschichten über Menschen, die auf eine solche Art gefangengehalten wurden. Was würde mich noch alles erwarten? Was würde noch alles geschehen? Todesangst, Carola? fragte wieder diese hinterhältige Stimme in meinem Inneren.
Trotz der Ketten, die meine Gelenke banden, konnte ich mich einigermaßen frei bewegen. Ich probierte ein wenig und testete meine Grenzen aus. Die Hände konnten sich hinter dem Rücken berühren, wenn ich den Bauch nicht nach vorne streckte, sondern etwas einzog. Zum Glück war er ziemlich flach, worauf ich schon immer recht stolz war. Die Beine ließen sich fast einen Meter spreizen, bevor die Verbindungskette vollständig gespannt war. Den Hals konnte ich nur ein wenig nach vorne oder zur Seite neigen, doch zumindest hatte er ein klein wenig Spiel in der Bewegung.
An den Eisenfesseln ertastete ich jeweils zwei Öffnungen, eine an der Vorderseite und eine hinten. An den Vorderseiten waren die Verbindungsketten befestigt, die Rückseiten waren frei. Selbst am Halsband war an einer Öse eine Kette angebracht. Diese befand sich an der Vorderseite und führte irgendwohin in die Finsternis. Ich zog an der Kette und hatte schnell den Punkt erreicht, an dem sie gespannt wurde. Ein kleines Stückchen Freiheit – zumindest ein kleines. Vorsichtig folgte ich dem Verlauf der Kette, wobei ich das kalte Material durch die Finger der linken Hand gleiten ließ. Mit der Rechten tastete ich mich vorwärts und versuchte mich davor zu schützen, daß ich nicht irgendwo dagegen stieß.
Die Kette verschwand in einem schmalen Loch in der Wand. Ich legte die Handflächen daneben und spürte rauhen Stein, der es umschloß. Dieser fühlte sich wesentlich grober an als der Block, auf dem ich gelegen hatte. Wenn man darüber strich, rieselte an manchen Stellen feiner Staub zu Boden, der mich sogleich in der Nase kitzelte. Mühsam unterdrückte ich einen sich anbahnenden Niesanfall.
Das Loch selbst war etwas breiter als der Durchmesser der Kettenglieder. Die Öffnung fühlte sich glatt und künstlich an. Nach der Beschaffenheit des Materials zu urteilen, sollte die Kette wohl beim Hinausgleiten und Zurückfahren keine hörbaren Geräusche verursachen und möglichst reibungslos hindurchgleiten. Auf jeden Fall paßte es nicht zu dem mittelalterlichen Ambiente, welches der Keller mit den Folterinstrumenten verströmt hatte. Entweder befand ich mich in einem anderen Gebäude, oder das Verlies war im nachhinein verändert worden.
Langsam tastete ich die Wand ab, von oben nach unten. Auf Hüfthöhe konnte ich neben dem Steinblock zwei kreisrunde Platten fühlen, die sich millimeterweit in die Wand drücken ließen. Weiter ging es nicht. Die Platten wurden von einem festen Widerstand blockiert. Zwei weitere, ähnliche Platten befanden sich auf Höhe der Knöchel. Ihr Abstand voneinander entsprach etwas über einem Dreiviertelmeter – eine Entfernung, die zustande kam, wenn man mit gespreizten Beinen an der Wand stehen mußte.
Die Seitenwände meines Gefängnisses fühlten sich im Gegensatz zur Rückwand künstlich an. Ich klopfte gegen glattes Material. Ein dumpfer Ton entstand. War das etwas Plexiglas? Na toll, Stein und Plastik! Ich unterdrückte die aufkommenden Gedanken über Sinn und Unsinn der menschlichen Bauweisen, die es nicht schafften, mit der Natur im Einklang zu stehen. Eine Erinnerung, die mich in die bunte Farbenwelt auf dem Wanderweg zur Burg versetzte.
Das war doch so was von egal! Natürliche und künstliche Materialien bildeten für mich hier gleichermaßen undurchdringliche Barrieren. Haut, Knochen und Fleisch würden die Wände nicht durchdringen können, egal wie sehr und wie oft ich es versuchen würde. Ob ich es dennoch irgendwann noch einmal probierte?
Die Front der Zelle war klar durch Gitterstäbe definiert. Ich befand mich also in einer Kerkerzelle, in einer Art Verlies! Angekettet wie ein Sträfling. Im Dunkeln gelassen. Isoliert …
»Ihr verdammten Arschlöcher!« brüllte ich. »Laßt mich frei, oder ihr werdet es bereuen! Ich will hier raus!«
Wütend hämmerte ich mit meinen Fäuste gegen die Gitterstäbe. Die Ketten an den Handgelenken rasselten dabei im Takt der Schläge. Das Gewummer und Gehämmer vertrieb die bedrückende Stille. Ich steigerte mich in Rage, schreiend und trommelnd. Es tat gut – einfach nur gut!
Doch schon bald vertrieb der Schmerz den willkommenen Zorn. Ich mußte mich zwingen aufzuhören, bevor ich die Haut an den Händen endgültig zu blutigen Klumpen geschlagen hatte oder mir ein paar Knochen brach. Zähneknirschend verzog ich das Gesicht und spuckte auf den Boden.
»Ihr Wichser!« murmelte ich mit gepreßter Stimme. Ich hatte erkannt, daß alle Bemühungen sinnlos waren und nichts bewirkten. Ernüchterung wischte den Elan beiseite.
»Laßt mich frei!« forderte ich trotzig.
Meine Fäuste pochten. Mit zusammengebissenen Zähnen verbat ich mir jede weitere Träne. Trotz lähmender Verzweiflung holte ich aus und schlug erneut nach dem Gitter. Die Kette zwischen den Handgelenken krachte scheppernd dagegen. Erst einmal, etwas langsamer. Dann schneller und heftiger.
Das Sausen des Metalls und der darauffolgende, klirrende Aufprall waren Musik in meinen vor Stille tauben Ohren. Immer wieder hämmerte ich die Kette gegen das Gitter. Doch es gab keine Reaktion. Ich schlug zu, bis mich die körperliche Anstrengung erschöpfte. Ein aus blindem Ärger entfesselter, langgezogener Schrei bahnte sich seinen Weg aus dem Mund nach draußen, breitete sich aus zu einer ohrenbetäubenden Kakophonie und verhallte schließlich ungehört. Heulend ließ ich mich zu Boden sinken – wie ein Häufchen Elend. Alles war um sonst!
»Bitte …« brachte ich flüsternd heraus. Verzweiflung tränkte meine bebende Stimme. Ernüchterung und Sinnlosigkeit. Niemand war durch diese schmerzhafte Aktion beeindruckt worden. Keine Reaktion wurde erzwungen. Alles war wie gehabt. Finsternis und Einsamkeit.
Nach einer unbestimmten Zeit voller Niedergeschlagenheit und Tränen drückte ich mich schließlich vom Boden hoch. Kein Zeitgefühl – keine Ahnung, wie lange ich dort saß. Hier gab es weder Sekunden noch Minuten. Die Zeit verstrich nach ihren eigenen Gesetzen, die mir verborgen blieben. Ich hatte keine Möglichkeit einzuschätzen, wieviel Zeit nach dem Eindringen in die Burg bis jetzt verstrichen war.
Es war erschreckend. So langsam verlor ich jeglichen Halt. In mir breitete sich ein Gefühl des freien Schwebens aus. Losgelöst von der Realität befand ich mich irgendwo zwischen hier und dort, dem Jetzt und irgendwann. Es zehrte an den Nerven, war beunruhigend, gruselte mich, bescherte mir eine Gänsehaut. Ich konnte es nicht leiden, keine Kontrolle über eine Situation zu haben. Hier gab es nichts zu kontrollieren. Ich konnte nur warten und hoffen, daß nicht noch Schlimmeres geschah. Mehr blieb nicht! Nur die Hoffnung – und die stirbt bekanntlich zuletzt.
Als ich wieder zu meinem Schlafblock zurückgehen wollte, trat ich in der Zellenmitte unvermittelt in ein Loch und wäre um ein Haar gestolpert. Mit einem beherzten Schritt – natürlich in einen spitzen Stein – gewann ich das Gleichgewicht zurück. Was war das gewesen?
Der Schreck lähmte mich nicht lange. Sogleich ließ ich mich auf die Knie sinken und erkundete mit den Fingern die Öffnung im Boden. Sie war etwa eine Hand breit und hatte eine runde Form. Es fühlte sich an, als sei hier ein Rohr, ähnlich einem Abfluß, in den Steinboden eingelassen worden. Dessen Wände fühlten sich glatt, fest und vor allem künstlich an. In einer Tiefe von etwa sechs Zentimetern spürte ich Feuchtigkeit und zog meine Hand schleunigst zurück. Das Wasser war so warm wie die Luft des Gefängnisses. Warmes Wasser bedeutete nichts Gutes. Abgestanden lockte es Unmengen schrecklicher Bakterien an. Dieses nicht erkennbare Ungeziefer brauchte ich nicht in meiner Nähe. Nein, wirklich nicht!
Meine Nase berührte fast den Boden, als ich mich noch weiter herunterließ, um an der Brühe zu schnuppern. Es roch etwas abgestanden, hatte aber noch nicht den spezifischen Geruch von Brackwasser. Jemand mußte das Wasser erst vor kurzem hier eingelassen haben. Vielleicht war das Wasser doch nicht so schlimm verseucht wie zunächst befürchtet.
Was war das für ein Rohr, fragte ich mich. Warum hat jemand in diese Zelle ein Stück Plastik eingelassen? Wozu sollte das gut sein? Dann dämmerte es mir langsam. Ein Abwasserrohr. Nein, bitte nicht! War das etwa meine Toilette? Sollte ich mein Geschäft mitten in dem Raum verrichten? Ohne Toilettenspülung? Was passierte, wenn die Schmutzbrühe überlief? Ich wollte nicht darüber nachdenken. Wie abartig war das denn?
Angeekelt verzog ich das Gesicht und schob mich von dem Loch zurück. Waschwasser konnte das beim besten Willen nicht sein. Zum Reinigen bräuchte ich frisches Wasser. Wie sollte ich mich denn bitteschön hier drinnen waschen? Was war mit meinem perfekten Gebiß, auf das ich so stolz war? Schon ein Tag ohne Zahnbürste und Zahnseide war bereits die Hölle für meine kleinen Beißerchen. Wie sollte ich ohne Spülung meine langen Haare in Schuß halten und dafür sorgen, daß sie weiterhin so schön rot glänzten? Falls ich die nächsten Tage überleben sollte …
Im Zellenboden eingelassen fand ich noch zwei metallene, kuppelförmige Ausbuchtungen von etwa einem Viertelmeter Durchmesser. Der Sinn der beiden Gegenstände erschloß sich mir leider nicht. Was sollten sie bedeuten? Was war ihr Zweck?
Ich resümierte meine Situation, als ich mich auf dem Steinblock niederließ. Ein Unbekannter hatte mich betäubt, als ich in einer Burg im östlichen Belgien einen Folterkeller erkundete. In die Umfriedung der Burg war ich unerlaubt eingedrungen. In das Gebäude mit dem Keller selbst war ich mit einem Dietrich eingebrochen. Das war nicht rechtmäßig, okay – das mußte ich anstandslos zugeben.
Beim Erkunden der Gerätschaften wurde ich außer Gefecht gesetzt, vermutlich mit einem Elektroschocker. Da war ich mir aber nicht sicher. Sollte das die Strafe für das Betreten des Anwesens ohne Wissen des Burgherrn sein? War das nicht ein wenig unverhältnismäßig für einen einfachen Hausfriedensbruch?
Nach meiner Ohnmacht erwachte ich in einer circa vier Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Zelle mit Wänden aus Stein und Plexiglas sowie einer Gitterfront aus Metall. In der Zelle gab es ein Abwasserloch, zwei Metallkuppeln im Boden und einen Steinblock, der mir als Schlafstatt dienen sollte. Irgendwelche Metallplatten waren neben dem Bett angebracht, deren Zweck ich nicht verstand.
Gab es noch etwas Wichtiges? Ach ja, ich war professionell für eine Langzeitinhaftierung in Eisen geschlagen und mit einer schweren Kette quasi an die Wand geschmiedet. Richtig! Ich steckte ganz schön in der Klemme.
Geknickt lehnte den Rücken gegen die Plexiglasscheibe und ließ die gezogene Bilanz auf mich wirken. Leise wimmerte ich in die Dunkelheit.