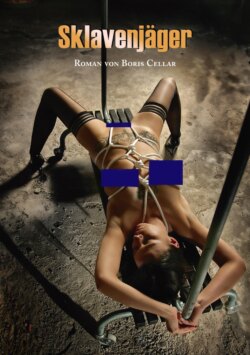Читать книгу Sklavenjäger - Boris Cellar - Страница 7
Оглавление3
Alle Muskeln waren immer noch – oder besser schon wieder – hart wie Stein, als ich die Augen vorsichtig öffnete. Ich mußte wohl auf dem unbequemen Steinblock eingeschlafen sein. Noch immer saß ich im Dunkeln; noch immer war ich in dem schweigenden Verlies gefangen. Ganz langsam richtete ich mich auf, meinem protestierenden Körper die Bewegung abtrotzend. Rücken und Schultern schmerzten, die verspannten Muskeln waren zu Knoten verklumpt. In halbsitzender Position drückte ich mich in die unbequeme Ecke zwischen rauher Steinwand und glattem Plexiglas. Langsam nahm das Gehirn seine Arbeit auf. Computer hochfahren, Analyseprogramm starten …
Noch immer war ich alleine. Noch immer war ich mit Eisenbändern und Verbindungsketten gefesselt, und noch immer trug ich nichts weiter als ein kratziges, knielanges Stoffkleid am Leib. Der Schlaf steckte mir ziemlich in den Knochen. Das Liegen auf dem harten Stein hatte mich ganz schön mitgenommen. Die Gelenke knirschten, als ich mich gähnend streckte. Es war kein guter Morgen.
Wehmütig erinnerte ich mich an den süßen Duft der Freiheit. Zu gerne läge ich jetzt in dem weichen Bett meiner Studentenbude oder zumindest in der gemütlichen Schlafstatt in der Pension, die ich vor ein paar Tagen ganz in der Nähe dieser unheilbringenden Burg bezogen hatte. Am liebsten hätte ich mich in ein Kissen gekuschelt und eine flauschige Decke über den Kopf gezogen, um mich dann, befreit von diesem Albtraum, aus dem Bett zu schälen. Zu gerne hätte ich jetzt diesen Hasen mit dem lustigen Gesicht und den kleinen Ohren geknuddelt, den ich von meiner lieben Zimmerkollegin Theresa für diese Reise geschenkt bekommen hatte.
»Ist für dich!« hatte sie gesagt und ihn mir freudestrahlend überreicht, während sie sich mit der anderen Hand gedankenverloren eine brünette Strähne aus dem Gesicht strich. »Einfach so! Weil du so eine liebe Freundin bist und dir der Film gefallen hat. Denk an mich auf deiner Studienfahrt!«
Ich mochte sie. Sie war eine wahre Freundin. Mit ihr konnte ich über alles sprechen – egal, was es war. So oft hatten wir schon über Jungs gelästert, die uns verletzt hatten, oder waren bei einem Glas Rotwein über unsere Dozenten hergezogen. Mit ihr zu plaudern und lachend von meinen Abenteuern in den Ardennen zu berichten wäre schön … Stattdessen saß ich hier in einer Zelle und starrte in die Dunkelheit.
Meine Blase erinnerte mich, daß ich auf Toilette mußte. Dringend! Ein morgendliches Ritual. Der Körper hatte sich daran gewöhnt. Immer und immer wieder praktiziert – jetzt mit einer gewissen Vehemenz eingefordert. Die Zunge fühlte an den Zähnen pelzigen Belag – na super! Wie sollte ich hier Zähne putzen? Ich benetzte die Lippen. Sie waren trocken und spröde. Der Lippenstift schmeckte verbraucht. Der Magen knurrte; und Durst hatte ich auch.
Es war kein guter Morgen. Nein! Das Aufwachen war überhaupt nicht gut gewesen. Es erinnerte mich unbarmherzig daran, daß ich eine Gefangene war. Eine Gefangene, deren Situation sich nicht verbesserte, sondern vielmehr mit jeder verstrichenen Sekunde immer weiter verschlechterte.
Was sollte das alles hier? War das ein schlechter Scherz? Das war nicht lustig, machte mir überhaupt keinen Spaß! Ich wurde dieser Situation langsam, aber sicher überdrüssig. Was sollte noch alles kommen? Was hatte man mit mir vor? Es wurde Zeit, daß meine Entführer – oder was immer sie waren – kamen und mich endlich versorgten. Ich hatte doch ein Recht darauf.
Nicht in Panik verfallen, Carola. Du hast zwar keine Ahnung, wie lange du hierbleiben mußt, aber ewig kann man dich nicht festhalten. Bestimmt wird schon nach dir gesucht. Bald kommt jemand und holt dich raus. Die belgische Polizei ist sicher recht fix. Dann läßt sich das ganze Mißverständnis klären, und du kommst wieder frei. So schlimm war ja eine Nacht in Ketten auch wieder nicht. Unangenehm, ja; aber nicht wirklich schlimm, versuchte ich mir einzureden. Ich war hier schließlich eingebrochen und hatte eine Nacht in der dunklen Zelle verdient. Jetzt hatte ich meine Lektion gelernt. Man muß doch nur miteinander reden, dann kann man sich doch einigen.
»Hallo?« fragte ich vorsichtig in das leere Nichts. Warten … Natürlich kam keine Antwort. War da niemand? Hörte mich überhaupt jemand? Hatte man mich vergessen? Sollte ich in der Zelle verrotten?
»Ist da jemand?« versuchte ich es erneut. »Hört mich jemand? Bitte antwortet mir! Es tut mir leid, daß ich hier eingedrungen bin. Bitte laßt mich gehen!«
Meine nackten Füße trugen mich die wenigen Schritte vor zu den Gittern. Ich schlug die Ketten zwischen den Handgelenken gegen die Metallstäbe. Es nervte, daß sich nichts tat. Wofür hielten die sich überhaupt? Eine Frau gefesselt im Dunkeln schmoren zu lassen …!
Meine Wachen oder Aufpasser oder was auch immer würde ich mit dem Geklapper so lange nerven, bis sie endlich zu mir kämen. Dann würde ich gegen die Behandlung protestieren und ihnen meine Sicht der Dinge darlegen. Aber hallo! Denen würde ich die Meinung geigen! Isolationshaft in Dunkelheit verstößt gegen das Völkerrecht. Amnesty International wird euch Loosern den Arsch aufreißen! Wir werden schon sehen, wer als erstes nachgibt! Ich habe Ausdauer. Ich habe Kondition. Ich war motiviert. Schließlich wollte ich aus diesem Loch herauskommen.
Doch sie hatten den längeren Atem. Ich gab zuerst nach. Das Klingen von Metall auf Metall verhallte ungehört. Es blieb dunkel. Niemand zeigte sich. Frustriert schlurfte ich zum Steinblock zurück, ließ mich darauf nieder und preßte den Rücken gegen die Steinwand. Niedergeschlagen starrte ich in die Dunkelheit.
Alles war so sinnlos! Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Irgend jemand würde mich vermissen. Bald würde man nach mir suchen. Meine Freunde wußten, wo ich mich aufhielt. Mit vielen hatte ich über mein Ziel in Belgien gesprochen. Wenn ich im Netz nicht mehr präsent war, keine Mails mehr schrieb und auch sonst nicht mehr erreichbar war, würde das auffallen. Dann würden Hundertschaften der Polizei nach mir suchen, und ich würde gefunden werden. Und dann würde der Spuk vorbei sein. Oh ja! Ich zog eine Grimasse und versuchte der schwindenden Entschlußkraft entgegenzuwirken. Was redete ich mir bloß ein! Das war doch alles eine reine Energieverschwendung!
Bis mich irgendwann einmal jemand fände, würde bestimmt noch einiges an Zeit verstreichen. Schließlich war ich ja aus der Pension mit Zelt und Schlafsack aufgebrochen, um ein paar Tage um die Burg zu streifen. Mit einem Linienbus war ich direkt vor der Unterkunft losgefahren. Das Personal wußte Bescheid. Immerhin hatten sie mir ein großes Lunchpaket mit auf den Weg gegeben, das noch in meinem Rucksack verstaut lag.
Noch vermißte mich niemand. Bis es soweit sein würde, mußte ich wohl in dem dunklen Verlies verweilen. Was konnte ich hier unten tun? Ich beantwortete mir die Frage selbst: nichts! Es war langweilig. Ziemlich langweilig sogar! Meine Zehen durchfurchten den staubigen Boden und malten ein chaotisches Linienmuster auf den Grund, welches meine Gefühlswelt perfekt widerspiegelte.
Die Kette zwischen den Füßen strich über den Boden und erzeugte schleifende Geräusche. Finger trommelten einen stereotypen Takt auf dem toten Steinblock. Der Rhythmus war monoton, gleichmäßig und unveränderlich. Langeweile! Es wiederholte sich alles in einem bizarren Kreislauf. Immer wieder. Immer wieder von neuem. Wie bei Monopoly. »Geh zurück auf Los.« Immer und immer wieder. Noch einmal von vorne. Ewiger Gleichlauf. Wiederholung. CAROLA! Aufwachen!!
In den Interviews für meine Studienarbeit hatten Gefängnisinsassen häufig davon berichtet, wie schlimm Langeweile für sie war. Mit allem konnte man in Gefangenschaft fertigwerden: mit den Mitgefangenen; den Wärtern; der Verpflegung; den Hierarchien, Sitten und Gebräuchen in den Justizanstalten. Sogar Krankheiten waren behandelbar. Irgendwie bekam man alles auf die Reihe. Nur die Langeweile – die bekam man nicht in den Griff. Die hielt einen im Griff, zerstörte die Psyche. Es gab nichts, was man dagegen tun konnte. Man konnte nur warten. Warten – und zwar jeder für sich alleine! Da half niemand. Damals konnte ich mir das nicht vorstellen, konnte das nicht verstehen. Mittlerweile hatte ich eine gewisse Vorstellung davon gewonnen, was mir die Interviewpartner sagen wollten.
Durst! Der Durst konkurrierte mit der Langeweile, entwickelte sich sogar zu einem gleichwertigen Kontrahenten.
Könnte ich endlich etwas zu trinken haben? Ich habe schon ziemlich lange nichts mehr getrunken. Falls es jemanden interessiert. Mein Rachen ist ganz trocken, und die Zunge klebt am Gaumen - wie Gummi. Außerdem muß ich auf Toilette. Meine Blase zerreißt gleich, und ich möchte nicht auf den Boden pinkeln. So etwas ist ekelhaft; außerdem stinkt es bereits nach kurzer Zeit. Hallo! Ich bin ein zivilisierter Mensch. Meine Eltern haben mich zu einem anständigen Menschen erzogen. Ich habe Manieren. Ich bin schmutzig und möchte mich waschen und die Zähne putzen. Bitte! Habt Erbarmen. Ich breche auch nie wieder ein. Es war falsch. Das sehe ich doch ein. Leute! Bitte!!
Meine stummen Klagen verhallten ungehört. Ich konnte all die Emotionen nicht in Sprache umsetzen, konnte das Flehen und die Entschuldigungen nicht artikulieren. Mir fehlten dazu Kraft und Wille. Außerdem ging es in meinem Kopf gerade viel zu chaotisch zu. Die Gedanken überschlugen sich. Unstet wanderten meine aufgerissenen Augen umher, ohne etwas zu erkennen. Finsternis hatte mich verschlungen. Sie arbeitete entschlossen daran, mich in den Wahnsinn zu treiben.
Instinktiv tastete ich das grobe Kleid nach meinem Handy ab. Wie absurd war dieses Handeln! Keine Taschen, kein Telefon. So einfach war das! Das Mobiltelefon war noch immer sicher im Rucksack verstaut.
Du kannst hier niemanden anrufen, Carola. Deine Verbindungen sind gekappt! Du bist ganz alleine. Hungrig. Durstig. Blind.
Du kannst dir vielleicht die Zeit mit Gedankenspielen vertreiben, brauchst aber nicht hoffen, daß dich jemand in absehbarer Zeit aus der Zelle holt. Du bist gefangen. Vielleicht für immer. Hast du daran schon einmal gedacht?
Ich versuchte, die fiese Stimme in meinem Kopf zu ignorieren. Zum Trost beschwor ich in Gedanken die kleine Pension in dem malerischen Ort an dem Flüsschen Ourthe, in der ich vor ein paar Tagen abgestiegen war. Angst vermeiden – wenn man den Teufel nicht an die Wand malte, erschien er auch nicht.
Die Pensionswirte bewirtschafteten die Unterkunft liebevoll. Jeden Vormittag standen nach einem leckeren Frühstück frische Schnittblumen als Sommergruß auf dem kleinen Tischchen in meinem kleinen Zimmer. Aus dem Fenster sah ich direkt auf den Marktplatz des Ortes, der typisch für die belgischen Ardennen war. Die Bänke einer Pommesbude luden unterhalb der Fensterbank zum Verweilen ein. Nicht, daß jemand etwas gegen belgische Pommesbuden sagt! Hier machen die Einheimischen die besten Pommes Frites der Welt. Ein wunderschönes Idyll; es war zu schön gewesen, um wahr zu sein.
Das Zimmer verfügte über W-lan, was mir bei der Informationsbeschaffung für die Studienarbeit sehr behilflich war. Dank Laptop, Email und Internettelefonie konnte ich mit der Uni in Kontakt bleiben und mich mit meinem Professor abstimmen. Mit wenigen Mausklicks konnte ich im World Wide Web alles über diese Burg in Erfahrungen bringen – unter anderem leider auch, daß man mich auf legalem Weg nicht hineinlassen würde. Hätte ich mal lieber auf die Warnungen auf der Homepage gehört! Aber im nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt saß ich hier, eines Besseren belehrt, hilflos und gefangen.
Im Hinterkopf kramte ich einige bruchstückhafte Erinnerungsfetzen hervor. Die Adresse der Pension und dieser Burg hatte ich von einem Kommilitonen erhalten, der irgendwie vom Thema meiner Arbeit erfahren hatte und sich ziemlich interessiert zeigte. Wie hieß der Typ noch gleich? Hm … es wollte mir nicht einfallen.
Die Not trieb mich wieder zurück in das Hier und Jetzt und zerstörte die schönen Gedankenspielereien. Kopfkino war etwas Schönes, solange es funktionierte! Doch bei mir funktionierte es auf Dauer hier in der Zelle einfach nicht. Die Erinnerung an die Welt da draußen vertrocknete bereits wie mein Körper. So langsam hätte ich wirklich gerne etwas zu trinken gehabt. Ich spürte regelrecht, wie die Haut spröder und spröder wurde.
Die Lage, in der ich mich befand, paßte mir überhaupt nicht. Ich konnte mich nur wiederholen. Die Dunkelheit und die körperlichen Strapazen zehrten bereits jetzt schon ziemlich arg an meinen Nerven. Ich hatte genug. Das Abenteuer könnte so langsam zu Ende sein. Die Zelle war, so gut es ging, erkundet. Jeden Quadratzentimeter hatte ich mit bloßen Händen abgetastet, die Beschaffenheit der Grenzen ausgelotet. Die Fesseln waren störend, auch wenn sie mich nicht sonderlich behinderten. Und die Langeweile war kaum auszuhalten.
Alles in allem kotzte mich die Situation einfach nur an. Und ein wenig Angst hatte sich bereits im Unterbewußtsein eingenistet, um leise die Frage zu stellen, was passierte, wenn ich doch nicht wieder freikam. Doch diese Möglichkeit war undenkbar, einfach absurd! Daher ignorierte ich das Unbehagen, welches sich langsam, aber sicher in mir einquartierte.
Mir war kalt. Ich war es nicht gewohnt, den ganzen Tag nur im Hemdchen herumzusitzen, selbst wenn dieses aus festem Leinen bestand. Woher auch? Normalerweise befand ich mich nicht in einem dunklen Loch in Gefangenschaft! Der robuste Stoff kratzte über die Haut, was meine darunterliegende nackte Brust ziemlich empfindlich machte.
Mißmutig stellte ich die Füße auf die Steinliege, zog die Knie an und schlang die Arme fest um die Schienbeine. Ich wollte mich ganz klein machen, mich tief in die Ecke der immer enger werdenden Zelle verkriechen. Irgendwoher vernahm ich ein leises Schluchzen. Angestrengt lauschte ich in die Schwärze, bis mir bewußt wurde, daß es mein eigenes klägliches Wimmern war.
Warum antwortete mir niemand? Warum ließ man mich alleine? Was wollten diese Leute von mir? Wann bekam ich endlich etwas zu essen? Und wenn ich etwas bekäme, würde ich dann etwas dafür tun müssen? Würde man mich zu etwas Widerwärtigem zwingen? Ich wollte kein Opfer sein wie in den bösen Internetgeschichten – Opfer, die von gemeinen Sadisten bis aufs Blut gequält wurden. Vielleicht sollte ich mir endlich einmal klarwerden, in was für einer Lage ich mich tatsächlich befand.
Die fiesen Gedanken verseuchten sukzessive das Gehirn. Was wurde hier gespielt? Sollte ich eine Sklavin werden? Wurde ich hier langsam gebrochen? Wurde zuerst mein Wille zerstört und dann mein Körper? Immerhin war hier irgendwo in der Nähe eine perfekt ausgestattete Folterkammer. Jedes Glied konnte separat geschunden werden, ganz nach Belieben. Man konnte mich hier unten tagelang, wenn nicht gar wochenlang, festhalten und martern, ohne daß es jemand mitbekam – vielleicht sogar bis zu meinem Tode.
Wer auch immer mich festhielt, den Bastarden war ich schutzlos ausgeliefert. Sie konnten mit mir machen, was sie wollten. Den Gedanken an eine sexuelle Erniedrigung versuchte ich ganz weit wegzuschieben. Zu abstoßend war diese Vorstellung. Eigentlich saß ich ganz schön in der Klemme. Die starke, alles unter Kontrolle habende Carola Reinhart war sprichwörtlich im Eimer!
Apropos. So einen hätte ich jetzt gerne in der Zelle. Es drückte und zwickte immer noch im Unterleib. Ich hatte keine Ahnung, wann ich das letzte Mal das WC benutzt hatte. Es dürfte schon einige Zeit her gewesen sein. Zumindest wurde es langsam höchste Zeit, erneut zu gehen. Entgegen allen anderslautenden Gerüchten brauchen wir Frauen keine zweite Person, um austreten zu können. Wir schaffen das ganz alleine. Wenn wir müssen, müssen wir. Da brauchen wir keine andere. Würdet ihr mich bitte auf Toilette lassen?
Ich kniff die Beine zusammen und preßte die flache Hand in den Schritt. Verkrampft beugte ich mich in die Hocke. Die Gesichtshaut spannte schon vor Anstrengung. Meine Zelle sollte sauber bleiben. Es war so peinlich. Doch ich konnte es nicht mehr länger halten.
Mit Trippelschritten – bloß nirgendwo dagegenstoßen oder in dieser Hockposition umkippen – gelangte ich in die Raummitte. Die Kette der Fußfessel schob ich vor mich außer Reichweite. Dann hob ich das Sträflingskleid und ließ es in den Abflußschacht laufen. Das Plätschern unter mir war einfach nur demütigend. So, wie es sich anhörte, hatte ich wohl das Loch getroffen, ohne daß etwas danebenging. Es war widerlich und ekelhaft! Im Geiste weitete sich der Abfluß zu einer bodenlosen Kloake, die randvoll mit scheußlichen, stinkenden Sachen gefüllt war und mich in die Tiefe ziehen wollte.
Mit verzerrtem Gesicht schluckte ich die Galle herunter, die den Hals herauf gekrochen kam. Die Vorstellung der Toilette im Raum war so abstoßend, daß mir schlecht wurde. Würgend rollte ich mich auf dem staubigen Boden zusammen, möglichst weit entfernt von dem scheußlichen Abgrund, und schloß angewidert die Augen. Mühevoll brachte ich Atmung und rebellierenden Magen unter Kontrolle. Ich wollte einfach nur noch weg von hier.
Mir war klar, daß Rufen und Schreien meine Lage nicht verbessern würde. Ich tat es aber trotzdem. Vielleicht würde mich ja doch endlich jemand hören und kommen, mich zu retten. Zumindest wollte ich meinen Häschern auf die Nerven gehen. Wenn ich etwas tat, dann verschwand die Übelkeit ja vielleicht wieder. Vielleicht konnte ich sie ignorieren oder zumindest verdrängen. Ablenkung war immer gut. Ich hatte noch nicht aufgegeben, konnte – nein, mußte mich aufraffen und etwas tun. Noch immer war ich Herrin meiner Sinne. So leicht gibt eine Reinhart nicht auf! Mein Vater hatte in seiner schweren Zeit auch nicht aufgegeben. Er hat gekämpft und gewonnen, zumindest was die Justiz anging. Ich würde am Ende auch gewinnen. Irgendwie. Das war sicher.
Die Sprüche sollten mich aufmuntern und zum Durchhalten motivieren. Doch in Anbetracht meiner Situation klangen sie einfach nur schal. Wo war ich denn eine Kämpferin? Alles, was ich tun konnte, war herumliegen, schreien und heulen. Sonst nichts. Meine Eltern würden sich für mich schämen, wenn sie mich so sähen.
Meine Mutter war – wie Vater – eine Kämpfernatur – im Gegensatz zu mir. Sie hatte nach der Scheidung ihr Leben gemeistert. Ganz ruhig hatte sie alles fair geregelt. Es gab keinen Rosenkrieg um winzige Beträge, Unterhalt oder Kinderbesuchszeiten. Vater tat meiner Mutter nach seinem Prozeß einfach nur leid, jedoch konnte sie nicht länger mit ihm unter einem Dach zusammenleben. Sie hatten sich nicht bekämpft, nicht gestritten. Sie waren einfach nur auseinandergedriftet, bis es nichts Gemeinsames mehr gab. Dann hatte sie ihn in Würde verlassen.
Mama hatte nach der Trennung viele Liebhaber gehabt und beherrschte die Kunst des Lebens und des Überlebens. Sie genoß jede schöne Minute, die ihr geschenkt wurde, und gab dafür gerne Liebe und Großzügigkeit zurück. Wer sie ärgerte, mußte büßen. Sie verstand es, sich zu rächen. Oh ja! Sie war ganz und gar Frau, eine Meisterin der kleinen Gemeinheiten. Doch sie war keine gute Lehrmeisterin. Ich war anders und glaubte noch an das Gute im Menschen. Rache ist keine Option! Sie ist der Grund für eine Spirale aus körperlicher und mentaler Gewalt, die alles um sich herum mit Freuden in den Abgrund reißt. So wollte ich mich nicht definieren. So war ich nicht.
Es stank. Mein empfindliches Riechorgan beendete den Rückblick auf die Geschichte meiner Eltern. Mein Körper stank. Das Verlies stank. Die Luft stank. Der Staub stank. Die Fesseln stanken. Mein Schweiß stank. Der ekelhafte Geruch hatte sich schon überall festgesetzt, lag in der Luft wie ein chemischer Kampfstoff, der mich zu zermürben drohte. Atmete ich durch die Nase, heftete er sich an die Scheidewände. Öffnete ich den Mund, setzte er sich an Gaumen und Rachen fest. Atemzug um Atemzug brachte mehr Gestank in meinen Körper. Dieser schied den Mief wieder aus, und der Kreislauf des Widerwärtigen begann erneut. Dann stank es noch mehr. Es war einfach nur degoutant! Ich ekelte mich vor mir selbst. Wonach roch es überhaupt? Roch es vergammelt, verfault, wie zu lange liegengebliebenes Fleisch oder nach Exkrementen? Roch es einfach nur nach Schweiß? Schimmel? Es war nicht bestimmbar. Ich konnte lediglich behaupten, daß es schlimm war. Ach was, schlimm … Es war fast nicht mehr zu ertragen!
Einsamkeit, Dunkelheit, Ekel, Gestank, Hunger, Durst. Die Liste der Dinge, die mich quälten, wurde immer länger. Ich befürchtete, daß das noch nicht alles war. Wahrscheinlich gerade mal der Anfang. Wie würde ich mich verhalten, wenn noch mehr passierte? Wenn tatsächlich einmal etwas mit mir passierte? Würde ich den Verstand verlieren? Nein. Das hatte ich doch bereits.
In der Stille hörte ich ganz leise ein Rascheln. Kaum wahrnehmbar. Doch ich hatte das Geräusch erhaschen können. Winzige Füße tippelten hektisch über den Zellenboden. Die kleinen Pfötchen eines kleinen, ekelhaften Tieres, die widerliche kleine Töne machten. Das war bestimmt eine Ratte. Ich haßte Ratten, trotz ihrer Verniedlichung in Filmen.
Ratten waren Träger von Krankheiten. Das wußte doch jeder. Sie brachten Tod und Verderben. Vor Ratten hatte man sich zu ekeln. Ratten sind unrein. Ratten stinken! Man soll sie ja auch nicht essen, sagt man. Obwohl …? Ob sie gut schmecken? Ich sollte es einmal versuchen und probieren, mir eine zu fangen.
Beißen Ratten eigentlich? Wo eine Ratte war, waren ihre Artgenoßen meist nicht weit. War hier irgendwo ein verdammtes Rattennest? Würde ich von den Viechern bei lebendigem Leib gefressen werden? Vielleicht wenn ich zu schwach war, um mich zu bewegen – oder wenn ich wieder eingeschlafen war? Viele kleine Rattenzähne auf vielen kleinen Rattenbeinen würden sich an meiner stinkenden Haut laben – wie bei einem Festmahl.
Lockte sie der ekelhafte Geruch meines kalten Schweißes an? Unbewußt kratzte ich mich am Kopf und strich durch meine wohl nicht mehr so perfekt sitzenden roten langen Haare. Ich schnupperte an der Hand und roch den Gestank einer verschwitzten, ungewaschenen Frau. Ratten und Gestank, das paßte sowas von zusammen. Morgen würden mich meine Häscher halb aufgefressen finden, nachdem diese kleinen Monster sich an mir gelabt hatten.
Teilten noch andere Tiere mit mir die Zelle? Nistete sich gerade irgendwo ein Heer von Kakerlaken, Ratten und Spinnen ein? Hallo Carola, wir haben dir zum Einzug Brot und Salz mitgebracht – auf eine gute Nachbarschaft …!
Ob ich mir ein paar Ratten zähmen sollte? Aber womit sollte ich sie gefügig machen – mit Stückchen meines stinkenden Körpers? Na ja, ich bin eine Frau, ein paar Gramm zu viel hier und dort hätte ich schon abzutreten. Wenn ich hier keinen Sport mache, setze ich bestimmt bald Fett an. Aber wovon? Dazu bräuchte ich erst einmal etwas zu essen und zu trinken. Und da schließt sich der Kreis wieder. Ich habe Hunger und Durst. Verdammt!
Das Getrippel war irgendwann verstummt. Die unerträglich laute Stille hatte mich wieder im unbarmherzigen Griff. Ich kratzte mit den Fingernägeln über die krustige Oberfläche des Steinblocks, um zumindest einige leise Geräusche zu hören. Damit es nicht ganz so furchtbar leise war. Die manikürten Supernägel hatten sich bestimmt längst in zerklüftete Ruinen verwandelt. Aber was soll’s? Ich hatte eine Beschäftigung und hörte etwas in der Grabesstille. Das war doch schon mal etwas.
Schlaf übermannte mich irgendwann. Ich träumte wild und unruhig. An die Nachtmahre konnte ich mich nach dem Aufwachen nicht mehr erinnern. Jedenfalls waren sie unheimlich und furchteinflößend. Erholung war mir dank des unruhigen Schlummers nicht vergönnt. Als ich erwachte, war ich noch verspannter als zuvor und fühlte mich hundeelend. Die Bedürfnisse Hunger und Durst dominierten mein Verlangen. Dunkelheit, Einsamkeit und Stille lauerten direkt dahinter. TRINKEN! BITTE!
Ich bebte, wobei ich nicht wußte, ob vor Wut, Kälte oder Flüssigkeitsmangel. Der Kopf dröhnte. Das war doch ein Anzeichen von Dehydration. Wasser. Irgend etwas. Ich erinnerte mich an die Brühe im Abwasserrohr. Mit meinem Wässerchen hatte ich es kontaminiert. Die Flüssigkeit werde ich bestimmt nicht trinken. So viel stand fest. Es hatte so viel schon festgestanden hier in der Finsternis. So viele Werte waren schon zerbrochen. Wann würde ich anfangen, meinen eigenen Urin zu trinken, nur um irgendeine Flüssigkeit zu bekommen?
»Hallo«, krächzte ich. »Wasser! Bitte!«
Der Ruf hörte sich an wie eine schreckliche Imitation meiner eigenen Stimme. Er klang, als hätte sie ein untalentierter Komiker parodieren wollen und wäre daran gescheitert, weil er zuvor eine Nacht mit rauchigem Whisky verbracht hatte. Ach egal, mich hörte doch eh niemand! Man ignorierte mich. Aber ich mußte es versuchen, durfte nicht aufgeben. Ich mußte zeigen, daß es mich noch gab. Wie lange konnte ein Mensch ohne Flüssigkeit überleben? Wann schwanden einem die Sinne? Wann wurde man vor Hunger und Durst wahnsinnig? Es dauerte bei mir sicher nicht mehr lange.
Was sollte man in einer Situation wie dieser tun? Beten? Seine Eltern im stillen für all die Verfehlungen und Unzulänglichkeiten um Verzeihung bitten? Schreien und toben? Oder verzweifelte man einfach im stillen? Halt die Klappe und stirb!
Ich entschied mich zu weinen; ließ alles heraus, was sich seit Beginn meines Aufenthaltes in diesem dunklen Loch aufgestaut hatte. In meiner stillen Ecke mit angewinkelten Beinen heulte ich Rotz und Wasser, den Gefühlen freien Lauf lassend. Es war alles sinnlos, einfach sinnlos. Genauso war es egal, ob ich mich zusammenriß oder nicht.
Während ich so dasaß, zwang ich meine Erinnerungen in die Vergangenheit, weg von diesem garstigen Ort. Aus dem Gedächtnis holte ich die schönen Zeiten meiner Kindheit in die Gegenwart, als sich Mama und Papa noch geliebt hatten und wir eine glückliche Familie waren. Trotz seiner Arbeit bei der Polizei konnte man mit Papa die sprichwörtlichen Pferde stehlen. Wir hatten so viel Spaß, wenn wir auf dem Bett kämpften und er mir spielerisch beibrachte, wie man sich als schwache Frau wehrte.
Bei den schönen Erinnerungen schlich sich ein Lächeln auf die aufgeplatzten Lippen, selbst als ich schniefend die Nase hochzog. Ich erinnerte mich an die Situation, wie er versuchte, mit einem Draht seinen alten Opel zu öffnen, nachdem er sich ausgesperrt hatte. Seine Kollegen hatten ihn von einem Streifenwagen aus mindestens eine halbe Stunde lang beobachtet und gelacht. Nachdem das Auto endlich offen war, hatten sie mich auf ein Eis eingeladen. Das war schön. Nur, daß es in einer anderen Welt geschehen war.