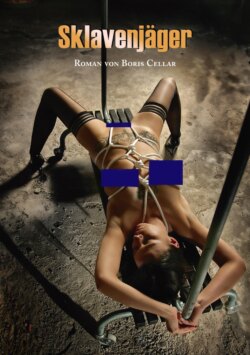Читать книгу Sklavenjäger - Boris Cellar - Страница 8
Оглавление4
Das schrille Tröten einer Sirene unterbrach die Stille. Ohne Vorwarnung wurden alle mir zur Verfügung stehenden Sinne mit einem Schlag hinweggefegt. Ein leises, metallisches Klingeln nistete sich vor dem Trommelfell ein und war auch durch wiederholtes Anspannen der Kiefermuskeln nicht mehr wegzubekommen. Vor Schreck fuhr ich hoch und schrie laut in die Dunkelheit.
»Ihr Dreckschweine!« krächzte ich und erhob mich von dem kalten Stein. Angriffsbereit plazierte ich mich mit nach hinten versetzten Beinen mitten in die Zelle. Ich war gewappnet. Sie hatten mich soweit.
Wild drohte ich den unsichtbaren Feinden. Meine Finger preßten sich schmerzhaft in die verschwitzten Handflächen. Abgebrochene Nägel bohrten sich durch Haut ins Fleisch. Fäuste wurden zum Schlag gehoben. Sollten sie bloß kommen; ich war vorbereitet. So leicht würde ich nicht aufgeben. Sie würden schon sehen, wozu ich fähig war. Mir war alles egal.
»Warum tut ihr das?« Meine Stimme überschlug sich. Schallwellen schliffen, gleich Schmirgelpapier, über die Stimmbänder und bahnten sich mit scharfen Krallen den Weg hinaus in die Finsternis. Das Krächzen brannte in der Kehle. Jedes Wort war eine Qual.
Warum wollte niemand mit mir reden? Sollte ich verzweifeln? Einfach nur stehen und warten? Ich konnte nicht mehr! Die Luft war raus! Alles war plötzlich zu viel. Der Kampfgeist erlosch. Zerbrochen ließ ich die Hände sinken, ließ den kläglichen Rest meiner Würde los. Der Wahnsinn suchte mich heim, und ich ließ ihn gewähren. Wer würde zusehen, wie ich weinte? Wen kümmerte, was ich tat? Niemanden! Es war egal. Alles war so scheißegal.
Wasser! Ich zuckte aufjaulend zusammen, stieß gegen den Steinblock und ruderte mit den Armen. Um ein Haar hätte ich das Gleichgewicht verloren und wäre der Länge nach hingeschlagen.
Eiskaltes Wasser kam von der Decke, benetzte mich und durchtränkte den alten Sack, den ich am Leib trug. Wasser, so viel Wasser! Das kostbare Naß! Durst ist schlimmer als Heimweh, sagt man. Und bei Gott, ich hatte hier drin bereits genug Durst gelitten! Ich brauche nicht zu verdursten. Danke, wer immer ihr seid!
Die kühlen Tropfen strömten bereits in Bächen von den Haaren, bis mir die Idee kam, die Handflächen zu einer Schale zu formen. Schnell füllte sich das Gefäß aus rauher Haut. Erwartungsvoll verharrte ich, bis der Wasserspiegel auf ein gewisses Maß gestiegen war. Endlich konnte ich trinken. Triumphierend führte ich die Hände zum Mund und ließ das feuchte Element in den Rachen fließen. Gierig schluckte ich den Trank …
… um alles sofort wieder herauszuwürgen. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand den Mund mit Seife ausgewaschen. Ein Meer aus Bläschen blubberte aus mir heraus. Hustend versuchte ich, dieses schleimige, blasige Etwas loszuwerden. Frechen Kindern wurde das Maul mit Seife ausgewaschen. Aber warum mir? Was hatte ich verbrochen? Ich war am Verdursten! Wollte man mich vergiften? War das ein besonders subtiler Mordversuch? Ist das die Art zu sagen, du bist eine Verdurstende in einem See voll Wasser? Ihr habt mich doch schon gebrochen! Was wollt ihr denn noch von mir?
Vornübergebeugt und von Krämpfen im Bauch geschüttelt, stand ich in dem Regen und ärgerte mich maßlos. Röchelnd verschluckte ich mich und hustete aus Leibeskräften. Wasser war in die Luftröhre gedrungen. Ich übergab mich auf den Zellenboden und spie alles heraus, was noch im Magen geblieben war.
Warum nur handelte ich so überhastet? Hier hatte schließlich alles einen Haken. Warum nahm ich an, daß mir jemand etwas Gutes tat? Alles war gegen mich. Warum also hätte das Wasser meine Qual lindern, den allgegenwärtigen Durst stillen sollen? Wie konnte ich so etwas nur erwarten? Dabei wußte ich doch, daß sich jemand einen Spaß daraus machte, mich zu piesacken. Nicht um sonst hatte man mich schon so lange einsam und alleine in der Dunkelheit gelassen.
Zu meinen Füßen hatte sich eine schmierig feuchte Schicht aus Schmutz und Staub gebildet, die den Boden ganz schön rutschig machte. Jeder Schritt mußte vorsichtig gesetzt werden, damit ich nicht plötzlich ausrutschte und irgendwo dagegen stieß. Mit gesenktem Kopf stellte ich mich erneut in Kampfhaltung. Die Unterarme gegen den Kopf gedrückt, schützte ich das Gesicht, um kein Seifenwasser mehr in das Gesicht zu bekommen. So verharrte ich bewegungslos und wartete Atemzug für Atemzug. Zumindest war das Pfeifen aus den Ohren gewichen. Ein kleiner Erfolg in der übrigen Trostlosigkeit.
Seifenwasser, schoß es mir durch den Kopf. Das war kein Wasser, um den grausamen Durst zu lindern. Ich war schmutzig und hatte die Zelle verunreinigt. Das war eine Dusche, eine Reinigung. Man wollte, daß ich den ganzen stinkenden Dreck von meinem Körper wusch. Anscheinend sollte ich wohl eine saubere Gefangene werden – weswegen auch immer …
Zumindest konnte man dadurch der Sache etwas Positives abgewinnen. So begann ich, mit den Händen die fettigen, nassen Haare zu durchwühlen, und spürte, wie sich langsam zwischen den Fingern eine Schaumkrone auftürmte. Das beschissene Wasser war mit einem Duschgel versetzt. Was es nicht alles gab!
Endlich konnte ich den Gestank loswerden! Mit hektischen Bewegungen seifte ich mich ein, vom Kopf bis zu den Zehen. Die gesamte Zelle verwandelte ich in das Chaos einer außer Kontrolle geratenen Schaumparty. Vielleicht würde es mir ja etwas bringen, wenn ich mich gefügig zeigte und mich ordentlich wusch – jetzt, da endlich etwas passierte.
Um mich komplett zu reinigen, öffnete ich die seitlichen Klettverschlüsse des klatschnassen Strafkleides. Den kratzigen Fetzen riß ich vom Leib und schleuderte das glitschige Ding voll Abscheu auf den Boden. Kratzend, streichend und reibend säuberte ich meinen Körper und befreite ihn von Dreck und Gestank.
Ich wusch Haut, Haare und besonders die Intimzonen, als ob es kein Morgen gäbe. Ich schrubbte wie eine Verrückte, koste es, was es wolle. Mit den Zeigefingern fuhr ich über die ungeputzten Zähne. Es war völlig unwichtig, wie der Schaum schmeckte und ob etwas davon im Mund zurückblieb. Es zählte alleine Sauberkeit. Keine Zahnfäule! Kein Gestank! Keine Ratten, die mich auffressen wollten, weil ich den Duft von leckerem totem Fleisch verströmte.
Speichel und Seifenwasser sprühten aus dem Mund, als ich wie wahnsinnig zu lachen begann. Sollte ich denn im Waschwasser ertrinken oder vor lauter Schaum in der kläglichen Zelle ersticken? Wie zynisch war das denn? Hörte die Dusche vielleicht irgendwann wieder auf?
Hysterisch lachte ich meinen Frust aus der Seele. Lachen tat gut. Lachen war besser als Weinen. Aber was zählt schon ein noch so herzhaftes Lachen, wenn es nur die pure Verzweiflung übertünchte? Er zählte nichts! Weder nach außen noch nach innen. Tief drinnen wollte ich einfach nur noch heulen. Doch ich trotzte dem und lachte weiter. Ich lachte laut, schrill und wahnsinnig – bis das Wasser wärmer wurde.
Die Dusche wurde angenehm – richtig angenehm. So etwas war ich gar nicht gewohnt in der Zeit meiner bisherigen Gefangenschaft. Jemand tat mir etwas Gutes! Oho! Fünfsternehotel »Schwarzer Kerker« – gehen Sie doch schon mal vor, der Concierge kümmert sich um ihr Gepäck. Denken Sie an ein angemessenes Trinkgeld. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt!
Das Wasser bekam genau die richtige Temperatur. So, wie ich es selbst eingestellt hätte. Klare, reine Flüssigkeit spülte den Schaum aus Haare und Gesicht. Welch wunderbares Gefühl! Ich ließ das Naß in den Mund laufen, spülte durch und spuckte alles im hohen Bogen wieder aus. Obwohl noch Reste der seifigen Substanz in den Schleimhäuten klebten und ein Meer von kleinen Bläschen produzierten, trank ich tiefe Schlucke. Das Wasser schmeckte besser als der erlesenste Wein. Es war einfach wunderbar!
Dankbar sank ich auf die Knie und ließ mich gehen. Das letzte Lachen wurde von einem Strom salziger Tränen ausgelöscht, wie Wasser ein loderndes Feuer erstickte. Irgendwie fühlte ich mich erleichtert. Endlich geschah etwas. Man hatte mich nicht vergessen. Ich wurde geduscht und durfte trinken. War das nicht wunderbar? Ich versank im Wechselbad der Gefühle und heulte wie ein Schloßhund. Schluchzend rollte ich mich auf dem feuchten Boden zusammen und jammerte mein gesamtes Leid in die schwarze Leere.
Das Wasser wechselte erneut die Temperatur und wurde von einem Moment zum anderen bitter kalt. Erschrocken fuhr ich hoch. Wie kleine Nadeln bohrten sich die Wassertropfen in die ungeschützte Haut. Hier – mitten in der Zelle – gab es kein Entkommen. Ob der frostigen Kälte verweigerten die Lungen ihren Dienst. Der Brustkorb war wie zusammengeschnürt. Am ganzen Körper zitterte ich gotterbärmlich. Die Kälte war kaum auszuhalten.
Nach unermeßlich langer Zeit schaffte ich es endlich, mich bebend zu erheben und zu den Gittern zu wanken. Mit klammen Fingern rüttelte ich an den Stäben. Aufhören! Hört doch bitte auf! BITTE!
Während ich wie eine Wahnsinnige an den Streben hing, merkte ich, daß das Wasser mich an dieser Stelle nur bis zu den Schulterblättern erreichte. Haare und Gesicht wurden nicht mehr getroffen. Die Dusche war scheinbar nur auf die Mitte des Raumes ausgerichtet. Vielleicht gab es ja einen Ort, an dem ich mich vollständig vor der feuchten Plage schützen konnte.
Vielleicht sollte ich es mit dem Steinblock versuchen? Das war gar keine so schlechte Idee, sprach ich mir Mut zu. Doch um diesen zu erreichen, mußte ich den kompletten Raum durchqueren und noch einmal dem kalten Regen trotzen. Ich brauchte einen kleinen Moment, um mich zu überwinden. Dann stolperte ich mit angehaltenem Atem platschend durch den frostigen See, der sich bereits auf dem Zellenboden gebildet hatte.
Vor lauter Hetze schlug ich mir den linken großen Zeh an dem Steinblock an. So ein Dreck! Das tat richtig weg! Ich hätte besser aufpassen müssen. Egal! Ich mußte weiter! Den pochenden Schmerz ignorierend, kletterte ich etwas vorsichtiger auf das robuste Podest. Tatsächlich konnte mich hier der Schauer nicht mehr erreichen. Lediglich ein feiner Tropfennebel strich über meine klamme Haut. Wunderbar! Ich hatte ein Schlupfloch finden können.
Zitternd vor Kälte stand ich aufrecht auf dem feuchten Stein. Ich war durchnäßt und ausgekühlt. Unter mir stand die Zelle unter Wasser. Doch ich war gewissermaßen im Trockenen! Hatte die Teufel überlistet, die mich gefangenhielten. Ich hatte einen Ort gefunden, an dem mich die kleinen, kalten Wassermonster nicht erreichen konnten. Triumphierend reckte ich die Fäuste in die Höhe und streckte der Dunkelheit beide Mittelfinger entgegen.
»Ihr könnt mich nicht besiegen!«, kreischte ich mit stolz erhobenem Haupt und grinste breit. »Niemals werdet ihr mich besiegen können! Keiner kann mich unterkriegen. Niemand! Ihr erst recht nicht!«
Das Plätschern unter mir erstarb. Nur noch ganz vereinzelt klatschten Tropfen auf den See. Zu gerne hätte ich die kleinen Wellen betrachtet, die ihr Auftreffen verursachten. Zumindest irgend etwas hätte ich gerne wiedergesehen. Doch noch immer lagen die Zelle und alles um mich herum in totaler Finsternis.
Das Finden des Schlupflochs beflügelte mich. Vor lauter Euphorie hätte ich in die Luft springen können. Na gut, so ein bißchen mußte ich mich wegen des schmerzenden Zehs schon zurückhalten.
Ein gurgelndes Geräusch erfüllte den Raum, wie ein Strudel ablaufenden Wassers. Der See löste sich in dem Abflußrohr irgendwo unter mir auf. Auf dem Stein wartete ich, bis das Wasser schließlich abgeflossen oder zumindest bis von dem Gurgeln nichts mehr zu hören war. Erst als das letzte, schmatzende Glucksen verhallt war, setzte ich vorsichtig die Fußsohlen auf den schmierigen Boden. Dort verharrte ich frierend. Mir war kalt.
Der ungleiche Kampf mit dem Wasser war beendet. Nur ich blieb zurück – nass und durchgefroren, einsam und allein. Doch der Sieg schmeckte schal. Die letzten Rinnsale verliefen sich im Zellenboden. Das verhaßte Kleidungsstück lag auf dem Fußboden, sicherlich voll Waschmittel und Dreck. Vor lauter Emotionen und Selbstmitleid hatte ich verpaßt, es auszuwaschen.
Die Kette am Halsband wurde behutsam, aber mit gleichmäßigem Druck in die Wandöffnung zurückgezogen. Sie war bei meiner Flucht auf den Stein klatschend auf das Wasser getroffen und lag nun auf dem Boden. Das Kürzen meiner Leine war nicht ruckartig oder unangenehm. Auch wurde der Hals nicht plötzlich in eine zufällige Richtung gezogen. Es geschah ruhig und gleichmäßig. Wahrscheinlich wurde die Länge nur gekürzt, um das Eisen vor schädlichem Rost zu schützen.
Schritte! Langsame, schwere Schritte kamen auf mich zu – oder eher auf die Zelle. Unvermittelt waren diese Schritte plötzlich da; waren aus dem schwarzen Nichts in meine kleine Welt gekommen. Ich hatte weder Tür noch Tor gehört. Irgendwie war es gespenstisch – als ob jemand die ganze Zeit in der Nähe gestanden und mich beobachtet beziehungsweise mir zugehört hätte.
Trotzdem kam es mir vor, als ob ein lang ersehnter Wunsch endlich in Erfüllung gegangen war. Jemand war gekommen – und dieser Jemand war mit Sicherheit die Person, die mich hier gefangenhielt.
»Hallo!« versuchte ich den Unbekannten anzusprechen. Es gab so viel zu sagen, unendlich viele Fragen zu stellen. Die Zeit war gekommen, sich zu beweisen, sich vor den Häschern zu behaupten. Doch meine Stimme, ausgestoßen aus vor Kälte zitternden Lippen, hörte sich weder selbstbewußt noch kraftvoll an, wie es eigentlich geplant war. Stattdessen war sie ängstlich und zögerlich, ja schon fast weinerlich schwach.
»Geben Sie mir doch bitte eine Antwort!« bettelte ich schließlich. Wo war die mutige, triumphierende Carola geblieben? Wahrscheinlich zusammen mit dem Abwasser im Abflußrohr verschwunden.
Die Schritte gehörten zu festen Stiefeln, so viel konnte ich aus den Geräuschen analysieren. Die Schritte waren ruhig und gemächlich, fast schon gleichmäßig. Langsam, aber kräftig trafen die Sohlen auf knirschenden Boden. Nach der Art der Bewegung zu urteilen, dürfte ein Mann diese Stiefel tragen. Der Träger schien sich alle Zeit der Welt zu lassen. Er hatte es überhaupt nicht eilig. Leider konnte ich noch immer nichts in der Dunkelheit erkennen und mußte mich alleine auf das Gehör verlassen. Man sagt, wenn das Augenlicht ausgeschaltet ist, sollten die anderen Sinne um so besser funktionieren.
Ein leises, kaum wahrnehmbares Geräusch war am Rande der Wahrnehmbarkeit zu hören. Es klang, als ob etwas – beinahe geräuschlos – in den Boden glitt. Wurde etwa gerade das Zellengitter versenkt? Ich lauschte angestrengt. Doch es war nichts mehr zu hören – Stille und Dunkelheit. Nur mein Atem und das Zittern meines Körpers verursachten noch leise Töne.
Ein Licht erschien in der Finsternis. Der rote, grelle Punkt hatte seinen Ursprung an einer Quelle auf der anderen Seite des vermeintlichen Gitters. Das Pendant ruhte auf meinem Brustkorb, genau zwischen den Brüsten. Ich hatte diese Art von Licht schon einmal gesehen – bei einer Art Laserpointer.
Langsam hob ich die Arme und bedeckte die intimen Stellen. Ich senkte den Kopf, so gut es das Halseisen zuließ, und sah, daß der Lichtpunkt weiterhin auf dem Brustkorb ruhte, noch immer an der gleichen Stelle genau mittig auf dem rechten Handrücken. Die angespannte Ruhe zerrte an den Nerven. Was geschah als nächstes? Warum sprach der Mann nicht mit mir?
In den Ohren pochte der Pulsschlag. Mein Herz raste vor gespannter Aufregung. Ich bebte am ganzen Körper. Die Sekunden dehnten sich zu Minuten. Der Mann in den schweren Stiefeln war nicht mehr zu hören. Er atmete anscheinend nicht einmal. Zitternd stieß ich den Atem aus. Wenn der rote Punkt nicht auf mir geruht hätte, hätte ich fast glauben können, daß mir meine Sinne einen Streich gespielt hatten.
Wie aus dem Nichts traf mich ein furchtbar harter Wasserstrahl. Er preßte mir die Hand gegen die Brust und stieß mich gegen die Wand nach hinten. Beinahe hätte ich mir deswegen den Kopf geschlagen. Instinktiv reagierte ich und drehte mich weg, bot dem Angreifer nur noch den Rücken und schützte die weichen, empfindlichen Stellen der Körpervorderseite.
Der kräftige Strahl strich über die Schulterblätter und preßte mich gegen die kalte Zellenwand. Es gab kein Entkommen – es gab nur noch die Ecke, in der ich hilflos zwischen Stein und Plastik kauerte, und das Wasser. Ich wurde mit voller Wucht an Rücken, Hintern und Oberschenkeln getroffen. Dabei ließ mein Peiniger sich viel Zeit, kostete meine demütigende Lage genüßlich aus. Ich hatte keine Chance auszuweichen, war auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Bis der Strahl schließlich auf dem Po verharrte. Es war, als ob sich etwas Gewaltiges durch meine Kehrseite in den Körper drängte. Schmerzen – bisher nicht gekannte Schmerzen. Widerwärtig und ekelhaft! Sadistisch erniedrigend. Ausweichen war unmöglich. Es war die Hölle!
Bald konnte ich es nicht mehr aushalten. Der Druck war unermeßlich! Ich rollte mich auf dem Steinblock zu einer Kugel aus schützender Haut zusammen. Verletzt und durchgefroren zog ich Knie und Ellenbogen an die Brust und wartete auf das Ende. Wegen der Kälte und des Drucks des Wasserstrahls versagte mir die Atmung. Schnappend versuchte ich, trockene Luft in die Lungen zu pumpen. Doch die Lungen blieben verschlossen. Nach ewigen Sekunden hörte die Marter endlich auf. Die fürchterlichen Schmerzen blieben.
Bibbernd preßte ich ein »Es tut mir leid!« heraus. Der Stein, auf dem ich kauerte, blieb weiter naß, kalt und unbequem. Die knirschenden Stiefelsohlen entfernten sich langsam wieder, bis sie nicht mehr zu hören waren. Wieder ertönte das fast geräuschlose Gleiten. Das Gitter wurde hochgefahren.
Wie war die Lage? Zunächst einmal das Positive: Der Durst war vorerst gelöscht. In gewisser Weise wurde ich sogar sauber. Das Wässerchen im Abflußloch war weggespült, der eklige Geschmack nach dem Aufwachen aus dem Mund verschwunden.
Dennoch befand ich mich, mit Ketten gefesselt, in einer Zelle ohne Licht. Ich war alleine und fror. Dank des Erbrechens war mein Magen noch leerer als vor der Wasseraktion. Irgend jemand hielt mich gefangen und trieb Psychospielchen mit mir. Von der demütigenden Aktion mit dem Strahl an meinem Hintern ganz zu schweigen. Die Lage war prekär – und ziemlich aussichtslos!
Ganz langsam versuchte ich, die Beine zu lockern und etwas auszustrecken. Vor Kälte und Anspannung waren sie völlig steif gefroren und versahen nur widerwillig ihren Dienst. Langsam krümmte ich die Zehen und entspannte sie wieder. Die Gelenke knackten. Das war kein gutes Zeichen. Vorsichtig tastete ich mich mit den Füßen über den Zellenboden. Der linke große Zeh, den ich mir angeschlagen hatte, pochte noch immer im Takt meines Herzschlags. Zum Glück linderte die Kälte den Schmerz ein wenig. Hoffentlich war der Zeh nicht verstaucht oder gar gebrochen. Das hätte noch gefehlt!
Auf dem Boden lag noch immer der durchweichte Sträflingskittel. Angewidert hob ich den schmierigen Stoff auf und wrang ihn aus. Ein Schwall Wasser ergoß sich hörbar auf den Boden. Hätte ich das vielleicht doch lieber über dem Abflußrohr machen sollen? Zu spät!
Obwohl es mich einiges an Überwindung kostete, streifte ich den nassen Sack schließlich über. Das war immerhin besser, als nackt und frierend in der Zelle zu stehen – den Blicken meiner unsichtbaren Wärter schutzlos ausgeliefert. Sie mußten mich in der Dunkelheit sehen. Irgendwie! Immerhin hatten sich mich mit dem Strahl direkt auf der Brust getroffen.
Angeekelt verzog ich das Gesicht, als der glitschige Stoff meine Haut berührte. Vorsichtig verschloß ich die Klettstreifen an den Seiten. Das Kleidungsstück war widerlich und versprühte die Wärme eines naßkalten Novembertags, an dem man nicht einmal den Hund vor die Türe schickte. Das bloße Tragen war schlichtweg unangenehm. Aber zumindest bedeckte es meine Blöße. So konnte ich zumindest das letzte bißchen Würde wahren, das mir noch geblieben war.
Blind krabbelte ich zurück auf den Steinblock – den guten alten Freund – und ließ mich darauf nieder. Mein Rücken lehnte gegen Plexiglas. Die Knie zur Brust gezogen, saß ich schweigend auf dem schmerzenden Po. Ich machte mich klein, wollte ein möglichst geringes Angriffsziel für die nächste Attacke bieten. Wer weiß, auf welche teuflischen Ideen die da draußen noch kamen.
Verzweiflung, mein treuer Wegbegleiter, gesellte sich zu mir. Eifersüchtig um meine Gunst, vertrieb sie Hoffnung und Glaube. Sie flüsterte mir zu, verschlagen wie die Schlange Ka, daß ich doch gerade aufs heimtückischste gefoltert worden war. Psychoterror – keine sichtbaren Spuren! Willen brechen! Persönlichkeit zerstören! Gefügig machen!
Das waren die Methoden der Handlanger von Diktatoren in geheimen Gefängnissen überall in der Welt. Genau das war ein wichtiger Teil meiner Recherchen für die Studienarbeit gewesen. So etwas sollte es doch nicht mitten in Europa geben. Aber wenn es das nicht gab, warum passierte es mir dann genau hier, genau jetzt?
Ein Albtraum suchte mich heim. Ich war gefangen und saß gefesselt auf einem Verhörstuhl. Um mich herum stand eine Vielzahl von Leuten, die stumm auf mich herabblickten. Ich wollte schreien, mich verständlich machen, mich erklären. Doch ich konnte nichts sagen, war wie geknebelt, obwohl mein Mund frei war. Ich saß einfach nur da, den Unbekannten ausgeliefert. Menschen standen vor mir und sahen mich mit großen, unpersönlichen Augen an. Diese Augen waren genauso leblos wie die Gesichter, in die sie eingepflanzt waren.
Ich riß die Augen auf und war sofort wach. Gleich machten sich die Sorgen und Bedürfnisse bemerkbar, die artig neben dem Steinblock auf mich gewartet hatten. Hunger und Durst waren spürbar gegenwärtig. Das Kleid war noch immer feucht und klebte mit seiner kratzigen Oberfläche auf der Haut.
Während ich geschlafen hatte, hatte sich an meiner Situation nichts geändert. Der Po tat von dem harten Wasserstrahl noch immer weh, und die Fesseln saßen unverrückt an Ort und Stelle. Vor und in der Zelle lauerte etwas auf mich in der Dunkelheit und wartete. Irgend etwas. Vielleicht war es nicht sichtbar, doch ich konnte deutlich spüren, daß es in der Nähe war.
»Hallo?« fragte ich in die Schwärze. »Hallo? Hört mich jemand? Könnte ich bitte etwas zu essen und zu trinken bekommen? Bitte! Ich habe so Hunger und Durst! Bitte!«
Mist! Ich wollte doch nicht betteln. Ich wollte keine Schwäche zeigen. Doch das Wollen zählte hier im Dunkeln nicht. Der Überlebenswille hatte allen Stolz beseitigt. Jetzt war die Zeit gekommen, den Körper vor dem Untergang zu retten. Nichts anderes! Bedürfnisbefriedigung. Der Stolz durfte gerne später zurückkehren. Dann hatte ich vielleicht wieder dafür Verwendung. Doch hier und jetzt war er fehl am Platz. Das Überleben zählte – und nur das!
Die nächsten Stunden verstrichen in purer Frustration. Ich durchlebte sämtliche Stadien negativer Emotionen. Ich litt an Hunger und Durst, an beidem gemeinsam und dann wieder an jedem einzelnen getrennt. Dazwischen mußte ich so stark auf Toilette, daß ich mich erneut in das Abflußrohr erleichterte. Dabei empfand ich zwar noch immer eine gewisse Scham – das Gefühl verschwand aber schon bald irgendwo in der Dunkelheit. Wie schnell man sich doch an manche Sachen gewöhnen kann, die man früher für unmöglich hielt!
Wut, Haß, Verzweiflung, Trauer, Selbstvorwürfe, Hunger, Durst, Müdigkeit, Kälte, Depression, Selbstzerstörung, Leere, Angst, Panik, Selbstmitleid. Die Stimmungen drehten sich wie in einem Karussell und hinterließen erste Narben auf der Seele. Ein bodenloser Strudel zog mich mit den Zellenabwässern in die Tiefe. Die Isolation in der Schwärze trieb mich in den Wahnsinn.
Die paranoide Angst, daß etwas oder jemand vor der Zelle lauerte und nur darauf wartete, mich in einem unaufmerksamen Augenblick zu schnappen, verwandelte die Gefangenschaft in einen Horrortrip. Man brauchte keine Drogen, um mich verrückt zu machen. Wenn ich mich nicht in der Ecke meines Schlafblocks verkroch, rannte ich unkontrolliert nach vorne zu den Gittern und spähte mit weit aufgerissenen Augen in die Finsternis. Dann wieder drehte ich mich bitterlich weinend an den Plexiglasscheiben entlang und zischte unverständliche Laute durch zusammengebissene Zähne.
War ich wach? Schlief ich? Halluzinierte ich? Hörte ich Stimmen? Schrie ich etwa? Waren Schritte zu hören? Kam das rote Licht wieder? Wurde der Wasserstrahl vorbereitet, um mich naßzuspritzen? Rattenfüße? Kaltwasserdusche? Wandkettenloch? Lachen oder Weinen? Flossen Tränen vom Himmel? Tanzte ich in meinen Ketten? Leckte ich den Boden, um die letzte Feuchtigkeit aus dem Staub zu saugen? Ist eine Zunge ein Reibeisen, mit dem man Fesseln durchscheuern kann?
STOP!!
Du mußt dich konzentrieren, Carola. Du wirst hier drin nicht heulend nach deiner Mami schreien. Sie kann und wird dir nicht helfen. Deine Eltern haben dir beigebracht, wie du dir selbst helfen kannst – daß du dir selbst helfen mußt. Beruhige dich! Zieh dich zurück und harre der Dinge. Entweder es passiert etwas oder nicht. Aber du, Carola Reinhart, kannst es nicht beeinflussen. Du kannst überhaupt nichts beeinflussen. Du kannst alles höchstens nur noch schlimmer machen. Darum: Verhalte dich still und warte.
Aber bewahre deine Seele!