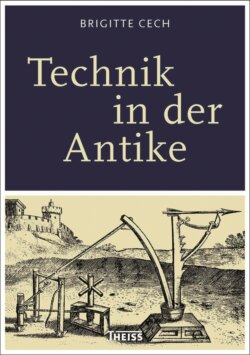Читать книгу Technik in der Antike - Brigitte Cech - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Wasserleitungstunnel des Eupalinos auf Samos
ОглавлениеDieser wahrscheinlich berühmteste Wasserleitungstunnel der Antike wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. erbaut. Herodot gibt eine Beschreibung des Tunnels und nennt den Namen des Baumeisters. „Sie [die Samier] durchbohrten einen Berg von 150 Klafter Höhe von unten her und gruben einen Tunnel mit zwei Öffnungen. Seine Länge beträgt sieben Stadien, die Höhe und Breite je acht Fuß. Durch seine ganze Länge ist ein anderer Kanal geführt, zwanzig Ellen tief, drei Fuß breit, durch den das Wasser in Röhren zur Stadt geleitet wird; er kommt aus einer starken Quelle. Baumeister dieses Tunnels war Eupalinos aus Megara, Sohn des Naustrophos“ (Her. hist. 3, 60). Der 1036 m lange, zur Wasserleitung von Samos gehörende Tunnel wurde im Gegenortverfahren vorgetrieben. Vor dem nördlichen Portal diente ein Fixpunkt auf dem Gegenhang als Orientierungspunkt für die Flucht, und im Süden wurde ein Visierschacht abgeteuft. Zunächst wurde ein horizontaler Tunnel mit einem Querschnitt von 1,8 × 1,8 m aufgefahren. Von den Portalen beider Baulose ausgehend wurden an den Seitenwänden des Tunnels in Abständen von rund 10 orgyiai (Klafter: Mittelwert 20,6 m) Markierungen angebracht. Wie man aus dem Grundriss sehen kann, gab es im südlichen Baulos keine Probleme. Die Strecke ist relativ gerade, und um die Trassenführung einzuhalten, nahm man regelmäßige Kontrollmessungen vor und korrigierte die Streckenführung dementsprechend. Dabei achtete man darauf, dass die Sichtverbindung zum Tunnelportal möglichst lange erhalten blieb. Im nördlichen Baulos stieß man jedoch auf erhebliche Probleme. Ohne es zu bemerken, wich man um rund 0,5° von der geplanten Trassenführung nach Osten ab. Knapp hinter Messmarke 12 stieß man auf die erste geolo gische Störung, die man mit einem kleinen Haken nach Osten umging. Bei Messmarke 14 kehrte man auf die geplante Trassenführung zurück und stieß kurz danach auf eine weitere geologische Störung, die man großflächig mit einem Haken nach Westen umging. Anhand des Grundrissplanes lässt sich rekonstruieren, wie Eupalinos die Umfahrung und die Rückkehr zur geplanten Trassenführung plante und ausführte (Abb. 13). Anhand des Bauplanes wusste er, dass er noch etwas weniger als 20 Maßeinheiten vom geplanten Treffpunkt entfernt war. Aus dem Grundriss des Tunnels kann man ersehen, dass Eupalinos die Umfahrung zunächst auf seinem Bauplan einzeichnete und ihr zur Orientierung einen Raster zugrunde legte. Bei der Umfahrung behielt er 10 Klafter als Maßeinheit bei. Damit verkürzen sich die Maßeinheiten auf der ursprünglichen Tunneltrasse. Um nach dem Haken wieder zur geplanten Trassenführung zurückzukehren, entschied sich Eupalinos für ein gleichschenkeliges Dreieck mit einem Tangensverhältnis von 1 zu 3 als Ausgangswinkel. Unter Anwendung des Pythagoräischen Lehrsatzes lässt sich für die verkürzten Maßeinheiten eine Länge von 19,53 m errechnen. 3 m hinter Messmarke 12 befindet sich Markierung 13, die nicht in das ursprüngliche System passt. Das dürfte eine Orientierungshilfe gewesen sein, denn wenn man von hier aus auf der ursprünglichen Trasse die Messmarken im Abstand von 19,53 m einzeichnet, ergeben sie mit den Messmarken der Umfahrungsstrecke (Abstand 20,6 m) einen Raster mit Marke 21 auf der ursprünglichen Trasse und Marke 20 auf der Umfahrung als Scheitelpunkt des Dreiecks. Als Bezugspunkt für beide Systeme ist die erste Messmarke in der Umfahrung (Punkt 15) anzunehmen. Dieser Punkt liegt drei verkürzte Maßeinheiten (58,45 m) von Punkt 13 entfernt. Von Messmarke 15 aus wurden wieder Maßeinheiten von 20,6 m Länge markiert. Die verkürzten Maßeinheiten auf der ursprünglichen Trasse gab es natürlich im Gelände ab Punkt 15 nicht, sondern nur auf dem Bauplan. Aber anhand des Planes wusste Eupalinos immer, wo er sich in Bezug auf die ursprüngliche Trasse befand. Im Einklang mit diesem System wendet sich die Umfahrung bei Punkt 20 wieder zur ursprünglichen Trasse zurück. Ab hier führt die Umgehungsstrecke steiler als geplant zur ursprünglichen Trasse zurück. Der Abstand der Messmarken beträgt hier dementsprechend rund 20,7 m.
Abb. 13 Eupalinos-Tunnel: Planung und tatsächliche Ausführung der Umfahrungsstrecke und des Treffpunkts der beiden Baulose (kursiv: verkürzte Maßeinheiten auf dem Bauplan).
Da sich Eupalinos nun nicht mehr sicher sein konnte, den planmässigen Treffpunkt beider Baulose auch wirklich zu erreichen, legte er im südlichen Baulos einen Versicherungshaken mit basisparalleler Endstrecke 8 Klafter (16,5 m) östlich der Basislinie an. Im nördlichen Baulos behielt er die Richtung so lange bei, bis er ebenfalls 8 Klafter östlich der Basislinie war und begann den basisparallelen Vortrieb. Nun wirkte sich die Richtungsabweichung von 0,5° aus. Um die daraus resultierende Abweichung von 5 m zu korrigieren, schlug Eupalinos einen Haken und traf so auf das südliche Baulos.
Nach erfolgtem Durchstich teufte man den Wasserleitungsgraben ab. Er hat ein Gefälle von 0,36 %, ist 70 cm breit und liegt rund 7 m tiefer als der horizontal geführte Tunnel. Wahrscheinlich setzte man die Wasserleitung so viel tiefer, um die Terracotta-Rohre zu schützen. Der Tunnel war bis in das 5. Jahrhundert n. Chr. in Betrieb.