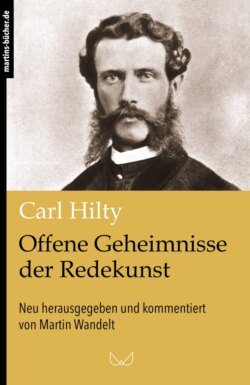Читать книгу Offene Geheimnisse der Redekunst - Carl Hilty - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Natürlichkeit
ОглавлениеDer Ausgangspunkt ist der: Bleibe natürlich, aber verbessere deine Natur da, wo sie es bedarf. Wolle also nicht im geringsten durch die Rede irgendetwas scheinen, was du nicht bist. Rede individuell, niemals mit Nachahmung irgendeines Anderen, sondern stets im vollsten Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.8
Auch alles sonstige Gesuchte soll vermieden werden, beispielsweise eine übermäßige Bescheidenheit (die überhaupt im Leben gewöhnlich das innere Gegenteil verrät) etwa in Ausdrücken wie: »das Unbedeutende, was ich vorzutragen habe«, oder in der Versicherung »tiefgefühlten Dankes« am Schlusse »für die Geduld und Nachsicht, mit der man angehört worden sei«, und dergleichen öfter vorkommende, unwahre Redensarten, die auch niemand wirklich für Ernst ansieht.9
Eine besondere Marotte einiger Redner ist es, um jeden Preis unvorbereitet scheinen zu wollen, wo sie es nicht sind. Es ist keine Schande, vorbereitet zu sein, wenn auch, wie wir noch sehen werden, nicht immer zweckmäßig. Weshalb also den Zuhörer darüber täuschen wollen?10
Manche Personen haben die üble Gewohnheit, vorzugsweise witzige Reden halten zu wollen, während sie doch von Natur nicht witzig sind. Der Witz ist gänzlich eine freie Gottesgabe. Wer sie nicht hat, soll sie nicht suchen und namentlich nicht etwa in bloßen Wortpointen suchen, in der Weise, wie sie besonders in der Umgegend der deutschen Reichshauptstadt gedeihen. Witze sind, wie das Sprichwort sagt, Blitze, man könnte auch mit Laboulaye sagen »einzelne Sonnenstrahlen«, rasch und leicht im Augenblick aufleuchtende Gedanken. Wer dagegen, wie jener Professor, an den Rand des Kollegienheftes schreiben muss: »Hier pflege ich gewöhnlich einen Witz zu machen«, der sollte es lieber bleiben lassen.
Ganz in die nämliche Kategorie wie der Witz gehört die Anekdote, namentlich die selbsterlebte. Sie hat, wenn sie zutreffend ist, einen Wert als Beweismittel für das Gesagte, das dem Zuhörer die Sache deutlicher macht; besteht aber eine Rede aus lauter solchen Geschichtchen, so hinterlässt sie leicht einen zu wenig ernsten Eindruck.
Ebenso wenig passt in den mündlichen Vortrag ein übermäßiger gelehrter Apparat. Nichts ist langweiliger anzuhören als eine Reihe abgelesener Büchertitel oder das Zitieren einer Menge würdiger Autoren, deren Verdienste den meisten der Zuhörer wahrscheinlich unbekannt sind.
Ein einem besonderen Stande angehörender Fehler gegen die Natürlichkeit ist der sogenannte Kanzelton. Es ist dies jener eigentümliche Tonfall, wie er nur bei geistlichen Rednern vorzukommen pflegt. Der nämliche Pfarrer redet ganz anders schon in der Kinderlehre, vollends gar bei einem Toast oder in einer Bürgerversammlung. Bedarf der geistliche Gegenstand der Rede wirklich eines andern Tons als der geistige? Oder liegt darin nicht vielmehr die Aufforderung an den Zuhörer, den Pfarrer auf der Kanzel von dem Menschen im Leben zu unterscheiden und anzunehmen, er würde vielleicht ganz anders reden, sobald er seinen »natürlichen« Ton annehmen dürfte oder müsste?11
Die Herren Geistlichen stehen übrigens in diesem ihnen öfters begegnenden Verstoß gegen die Natürlichkeit keineswegs allein.12 Er findet sich auch häufig in Grabreden, die von Weltleuten gehalten werden, wobei sie gröblich gegen die Wahrheit und innere Überzeugung reden. Ein solches bloß formales Totenopfer kann nie eine wirksame Rede sein.
Ebenso kommt dergleichen vor bei juristischen Kriminalverteidigungen, besonders vor den Geschworenengerichten, wo Anfänger in der Verteidigungskunst oft eine Rührung über die Schicksalsschläge ihres Klienten und eine tiefe Bekümmernis um das Los seiner Angehörigen an den Tag legen, die ihnen sonst im Leben nicht eigen ist.13
Die rechte Natürlichkeit in der Sprache hält stets die richtige Mitte zwischen dem Trivialen und dem gesucht Pathetischen. Denn einerseits erfordert es der Respekt, den der Redner vor dem Zuhörer haben muss, dass er ihn nicht mit bloßen Gemeinplätzen oder in einer trivialen Ausdrucksweise anrede, die immer ein Urteil über den Zuhörer enthält. Eine Rede wird umso besser sein, je höher der Redner von seinen Zuhörern denkt, und man darf in dieser Hinsicht im Allgemeinen wohl sagen, er sollte sich eigentlich stets in den Gedanken hineinversetzen, zu der ganzen gebildeten Menschheit zu reden, und immer das Beste geben, was er überhaupt hat.14
Dagegen ist andererseits heutzutage der vorzugsweise Geschmack am Pathos der Rede, der zu Anfang des Jahrhunderts und bei uns bis in die Dreißigerjahre hinein vorherrschte, fast gänzlich abhandengekommen. Die Redner der Französischen Revolution, Bergniaud, Gensonné, Mirabeau, würden auf uns den Eindruck nicht mehr machen, den sie auf ihre Zeitgenossen hervorbrachten. Wir sind um ein Jahrhundert älter geworden und jetzt eher geneigt, das Urteil eines späteren Franzosen zu unterschreiben, welcher von ihnen sagt: »leur éloquence ètait théâtrale comme leur liberté.« [Ihre Beredsamkeit war so theatralisch wie ihre Freiheit.]15